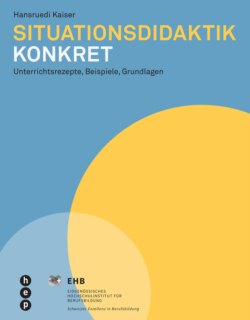Читать книгу Situationsdidaktik konkret (E-Book) - Hansruedi Kaiser - Страница 36
A5.4 Unrealistisch?
ОглавлениеMan kann sich die Frage stellen, inwiefern das diesem Rezept zugrunde liegende Szenario für den schulischen Unterricht in der Berufsbildung heute und/oder in Zukunft überhaupt realistisch ist.
Das CAD-Beispiel hat sich genau so zugetragen – bis zu dem Punkt, wo die Lernende der Lehrperson demonstriert, wie sie mittels des CAD-Programms die Höhe der Decke misst. Das skizzierte weitere Vorgehen (die Frage der Lehrperson und die gemeinsame Entwicklung eines Vorgehens) bleibt im Rahmen dessen, was auf der Stufe berufliche Grundbildung möglich ist. Und da ein echtes, akutes Problem gelöst wird, ist die dafür benötigte Zeit sicher gut investiert (ähnlich: B2 Randumfang einstellen).
Etwas anders liegt das Roboterbeispiel. Hier entwickelt sich im Extremfall ein umfangreicheres Projekt unter Einbezug mehrerer Betriebe und verschiedener Fachpersonen etwa aus einer Fachhochschule oder einer Universität. Auch für die berufliche Grundbildung ist dies denkbar. Beispielsweise führten bereits 2016 die Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal mit Lernenden in Automobilmechatronik ein Projekt zum Thema «Elektroautos» durch, obwohl dieses Thema laut Bildungsplan damals noch nicht zur Diskussion stand (EBL 2016). Realistischer sind solche ausgewachsenen Projekte, bei denen sowohl Teilnehmende wie auch Dozentinnen und Dozenten Neuland betreten, wohl eher auf der Ebene höhere Berufsbildung.
Wird ein Thema nicht im Bildungsplan berücksichtigt und folglich auch in der Schlussprüfung (QV) nicht geprüft, fragt sich, wie Lehrpersonen legitimieren können, trotzdem darauf im Unterricht einzugehen (C8 Gewisse Ungewissheit). Diese Frage stellt sich allerdings in der Berufsbildung immer wieder. Bereits 1995 waren Lehrpersonen für die Ausbildung medizinisch-technische Radiologieassistentin/Radiologieassistent mit dem Problem konfrontiert, dass im damals gültigen Ausbildungsreglement (Schweizerisches Rotes Kreuz SRK 1985) computerbasierte Verfahren wie Computertomografie etc. mit keinem Wort erwähnt wurden, ihre Lernenden diese aber an ihrem Arbeitsplatz ständig antrafen. 1998 reagierte man darauf, indem man ein neues, technologieneutrales Reglement erstellte. Dort hiess es neu unter anderem: «Analysiert Ursachen, welche die Qualität der Apparate, Verfahren und Bilder verändern, und trifft die entsprechenden Massnahmen» (SRK 1998, S.19). Dies gab den Lehrpersonen die Möglichkeit, flexibel auf technologische Neuentwicklungen und neue Situationen zu reagieren, und dürfte ein gültiges Bildungsziel bleiben, solange Röntgenfachpersonen mithilfe von Apparaten und Verfahren Bilder herstellen. Will die Berufsbildung angesichts einer sich beschleunigenden Technologieentwicklung flexibel bleiben, sind nicht nur die Lehrpersonen gefordert, flexibel auf Neues und Unerwartetes zu reagieren, sondern auch Reglemente, Verordnungen und Bildungspläne müssen so angepasst werden, dass sie solche Flexibilität zulassen beziehungsweise sogar fordern.