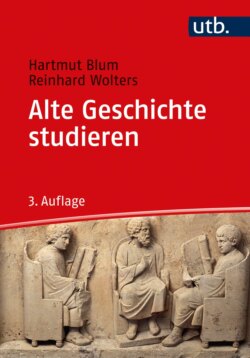Читать книгу Alte Geschichte studieren - Hartmut Blum - Страница 33
2.2.7 QuellenkritikQuellenkritik und ‚Quellenforschung‘
ОглавлениеDiese Beobachtung wirft eine weitere Kardinalfrage der QuellenkritikQuellenkritik auf: Woher konnte der Autor überhaupt das wissen, was er uns berichtet? Im Idealfall führt diese Frage zu älteren, den geschilderten Ereignissen näherstehenden Historikern, am Ende vielleicht gar zu Zeitzeugen des Geschehens. Solche Werke sind jedoch oft nicht mehr – oder zumindest nicht mehr vollständig – erhalten: Zum Beispiel wurde das monumentale Werk des Titus LiviusLivius (59 v. Chr.–17 n. Chr.), in dem er die Geschichte Roms von der Gründung der Stadt bis in das Jahr 9 v. Chr. behandelte, so stilbildend und erfolgreich, dass ein Großteil der von ihm verarbeiteten älteren römischen Geschichtsschreibung verloren ging. Hier gilt es nun, die Zuverlässigkeit der jeweiligen Gewährsmänner abzuschätzen, und zwar ebenfalls auf der Grundlage dessen, was man über Leben und Werk der betreffenden Personen in Erfahrung bringen kann. Allerdings sollte diese Art von Quellenforschung nicht zu schematisch vonstatten gehen. Es ist nämlich oft nicht klar, wie viel ein späterer Autor an einer bestimmten Stelle von einem älteren Werk unverändert übernommen hat, und in welchem Ausmaß eigene Umarbeitung vorliegt. Gerade bei Livius hatte eine auf die Spitze getriebene Suche nach den ‚Quellen der QuelleQuelle‘ in der Vergangenheit sogar zur Folge, dass die wesentlichen Fragen aus dem Blick zu geraten drohten: „Allzu oft konzentrierte sich das Bemühen darauf, einzelne Passagen (…) einer bestimmten Vorlage zuzuweisen, wobei das Ergebnis wegen der Schattenhaftigkeit der Vorgänger des Livius in vielen Fällen eine bloße Etikettierung war, ohne ersichtliche Relevanz für die Erforschung der geschichtlichen Ereignisse“ (J. v. Ungern-Sternberg).
Quellenforschung als Selbstzweck, das zeigt sich an diesemBeispiel, führt die Geschichtswissenschaft also eher in eine Sackgasse. Dabei kann die Antwort auf die Frage, ob unsere Quellen wirklich wissen, was sie zu wissen vorgeben, durchaus auch negativ ausfallen. Insbesondere die Berichte über die frühe römische Geschichte bis etwa 350/300 v. Chr. stehen unter dem Generalverdacht, fast völlig frei erfunden zu sein. Ein deutlicher Hinweis auf derartige Geschichtskonstruktionen sind so genannte Doubletten, d.h. beinahe identische Schilderungen verschiedener Ereignisse, sei es in ein und demselben Werk, sei es in verschiedenen Geschichtswerken. Es ist kein Zufall, dass Doubletten gerade in der frührömischen Geschichte häufig vorkommen. Schon LiviusLivius selbst konnte es seinen Vorlagen nicht glauben, dass sowohl die Latiner 340 v. Chr., als auch die Campaner 216 v. Chr. von den Römern angeblich gefordert haben, in Zukunft einen der beiden Konsuln stellen zu dürfen. Er hielt freilich die spätere Forderung für die Imitation der früheren (Livius 23,6,6–8; vgl. Livius 8,5,5), eine Annahme, die nicht unbedingt der historischen Wahrscheinlichkeit entspricht: Man wird bei der Beurteilung der Historizität von Doubletten vielmehr entweder das Erzählmuster insgesamt für eine Fiktion halten oder davon ausgehen, dass eher das ältere Ereignis einem realen jüngeren nachgebildet wurde als umgekehrt. Denn im Grundsatz ging es den römischen Geschichtsschreibern natürlich darum, Wissenslücken in der Frühzeit mit Material aus der besser belegten späteren Periode zu stopfen.