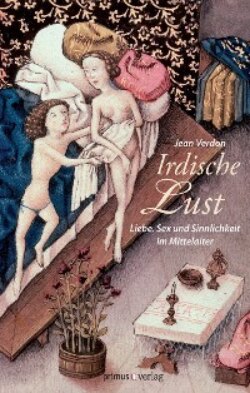Читать книгу Irdische Lust - Jean Verdon - Страница 12
Konversation
ОглавлениеEs genügt nicht, das geliebte Wesen zu bewundern. Man muss ihm auch seine Liebe erklären, also die Initiative ergreifen, vom Betrachten zur Konversation, vom Monolog zum Dialog übergehen.
Der Roman Flamenca ermöglicht es, eine derartige Entwicklung zu verfolgen, hier eine besonders komplexe. Während all der Wochen von Mai bis August offenbart Guillaume bei jeder Messe mit einem Wort der jungen Frau seine Liebe. Sie entschließt sich, ihm zu antworten, und empfindet schließlich dieselben Gefühle.
An einem Sonntag Anfang Mai befindet er sich vor seiner Dame, als diese das Gebetsbuch sinken lässt. Er sagt ihr sanft: »Oh weh!« Flamenca glaubt, dass der junge Ritter sich über sie lustig macht, denn ihr Ehemann hält sie als Gefangene. Aber, denkt sie, er hat sich aus Angst, gehört zu werden, davor gehütet, zu laut zu sprechen, seine Gesichtsfarbe hat sich verändert, und er hat einen langen Seufzer ausgestoßen. Um seine Absichten kennenzulernen, entscheidet sie sich – auf Rat ihrer Hofdame Alis –, mit einer Frage zu antworten: »Was klagst?« Als sie am folgenden Sonntag diese Worte spricht, während Guillaume ihr den Friedensgruß überbringt, erhebt sie ihren Kopf und beobachtet das Mienenspiel ihres Gefährten. Sie wird sich bewusst, dass er besonnen, gewitzt und diskret ist, dass er gut singt und schöne Haare hat.
Wiederum einen Sonntag später trägt sie anders als üblich kein Haarband, um die Friedensbitte besser zu hören. Guillaume sagt: »Ich sterb’«, und entfernt sich rasch.
Marguerite, eine andere Begleiterin Flamencas, empfiehlt ihr ein Wort, das zu den anderen passt, nämlich »Woran?«.
Guillaume hört und erwägt dieses Wort sehr wohl und sagt sich: »Da sie mir so überlegt geantwortet hat, könnte man annehmen, dass sie mir etwas zuliebe tun möchte. Wollte sie mir nicht wohl, dächte sie nicht an mich; dächte sie nicht an mich, spräche sie nicht zu mir. Daher ziehe ich folgenden Schluss: Ich bin ihr nicht gleichgültig […].«
Am Himmelfahrts-Donnerstag lässt er sich an die Seite seiner Dame gleiten, die ihn perfekt versteht, als er »Aus Lieb’« sagt. Dann zieht er sich zurück.
Als Flamenca am Pfingstsonntag den Friedensgruß empfängt, fragt sie sogleich: »Zu wem?«, was Guillaume in Erstaunen versetzt.
Am nächsten Morgen fragt sie sanft: »Was tun?« Guillaume geht verwirrt weg, denn, so sagt er sich, diese Worte trösten ihn einerseits und ängstigen ihn andererseits, bedeuten sie doch weder ja noch nein.
Am Sonntag acht Tage nach Pfingsten murmelt Guillaume: »Heilt mich!« Die besorgte Flamenca fragt sich, wie sie ein Heilmittel für die Schmerzen herbeischaffen könne, an denen er ihretwegen leidet. Ihre jungen Hofdamen raten ihr also, »Und wie?« zu fragen, denn sie wissen nicht, womit die Liebe geheilt werden könnte.
Am folgenden Samstag, dem Tag des heiligen Johannes (24. Juni), fragt Flamenca ihn ganz sanft: »Und wie?«, und es fehlt nur wenig, und sie hätte seinen Finger mit ihrem berührt, als sie den Psalter nimmt. Aber wir sind noch nicht bei den Berührungen.
Am Sonntag nach Johannis kommt Guillaume mit leichtem Herzen zu seiner Dame, und als er ihr den Friedensgruß weitergibt, murmelt er: »Durch List!« Tatsächlich hat er von den anderen Gästen erreicht, dass sie die Herberge verlassen, und er hat einen unterirdischen Gang ausheben lassen, der sein Zimmer mit den Bädern verbindet, die Flamenca mit Erlaubnis ihres Ehemannes von Zeit zu Zeit besuchen darf.
Die jungen Hofdamen raten ihrer Herrin, »Brauch’ sie!« zu antworten.
Am folgenden Donnerstag, dem Festtag Peter und Paul (29. Juni), versichert Flamenca Guillaume ihre Liebe.
Sobald er wieder zu seiner Dame sprechen kann, sagt er ihr: »Ich tat’s.« Was nicht unerwidert bleibt: »Da staunte sie und blickt ihn gar lieblich an, so dass sich im Augenblick ihre Blicke küssten und ihre Herzen umarmten.«
Am folgenden Sonntag bittet Flamenca: »So sprich!« Wieder acht Tage vergehen, und Guillaume antwortet: »Geht hin!«, aber er präzisiert nicht wohin. Daher fragt Flamenca am Tag der heiligen Magdalena (22. Juli), beim nächsten Anlass: »Wohin?«, und am nächsten Tag antwortet Guillaume: »Ins Bad.«
Am Tag des heiligen Jakob von Compostela (25. Juli) erkundigt sich die junge Frau besorgt: »Und wann?« Am nächsten Sonntag erklärt er: »Demnächst.«
Sie wartet bis Dienstag, den Tag von Petri Kettenfeier (1. August), um zu sagen: »Ich will’s«, und dabei geschieht es: »mit ihrer linken Hand berührt sie, indem sie dem Gesetz der Liebe folgt, leicht und diskret die rechte Hand von Guillaume, dann setzt sie sich wieder, denn sie kann sich nicht mehr auf ihren Beinen halten«.
Als sie ihrem Ehemann gegenüber vorbringt, bedrückt zu sein, erhält sie am Mittwoch die Erlaubnis, das Bad aufzusuchen. Mit ihren Hofdamen schließt sie sich in dem Raum ein. Diesen sagt sie: »Glaubt aber nicht, dass ich mich ausziehe. Ich bin ja nicht hergekommen, um zu baden, sondern um mit ihm zu sprechen.«
Nach diesem langen Vorspiel können die beiden Liebenden sich also frei miteinander unterhalten. Guillaume, der eine Bodenplatte gelöst hat und so in das Bad eingedrungen ist, erklärt der jungen Frau seine Liebe. Sie antwortet ihm: »Lieber Herr, da Gott mir die Gunst schenkt, mit Euch zusammen zu sein, sollt Ihr beim Abschied nicht sagen, dass ich Euch etwas vorenthalten habe, seid Ihr in meinen Augen doch so schön und edel, höfisch und klug, dass Ihr rechtens und der Minne halber seit langem mein Herz besitzt. Nun ist noch der Körper dazugekommen, um Euch glücklich zu machen.«
Aber kommen wir zurück zu den Worten, bevor wir zu den Taten übergehen. Für Andreas Capellanus gibt es fünferlei Art und Weise, wie man die Liebe eines anderen Menschen gewinnen kann: »durch leibliche Schönheit, rechtschaffenes Verhalten, seltene Redegewandtheit, großen Reichtum und übergroße Freigebigkeit«. Aber, so fügt er hinzu, nur die ersten drei Eigenschaften sind geeignet, wirklich Liebe zu wecken, und die Sittsamkeit oder Rechtschaffenheit ist es, die allein die Krone der Liebe verdient. Von der Redegewandtheit an sich glaubt er nicht, dass sie geeignet ist, um Liebe beim Gegenüber zu wecken – schließlich kann ein guter Redner auch zu Unrecht glauben machen, dass er zahlreiche Tugenden besitzt. Weil andererseits wohlgesetzte Worte auf die Rechtschaffenheit desjenigen schließen lassen, der sie vorbringt, widmet unser Autor imaginären Dialogen zwischen einer Frau und einem Mann, die in verschiedenen sozialen Milieus angesiedelt sind, lange Passagen seines Werkes. Nehmen wir als Beispiel das Gespräch eines Mannes aus dem Volk mit einer Frau aus dem Volk: Er beginnt damit, sie gemäß der Sitte zu grüßen, und auch nach der Begrüßung darf er nicht gleich damit loslegen, ihr seine Liebe zu erklären. Vielmehr soll er einige Zeit verstreichen lassen, damit die Frau, sofern sie es wünscht, zuerst das Wort ergreifen kann. Wenn die Frau solcherart den Anfang macht, kann der Mann sich darüber freuen, gibt sie ihm damit doch die Möglichkeit, die Unterhaltung nach mancher Richtung fortzusetzen. Denn tatsächlich: »Es gibt ja Männer, die beim Anblick ihrer Erwählten kein Wort mehr herausbringen können und alles, was sie sich ausgedacht und zurechtgelegt hatten, vergessen«.
Wenn die Frau zu lange zögert, die Unterhaltung anzufangen, muss der Mann das Gespräch in Fluss bringen. Er soll zunächst über Dinge reden, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, indem er etwa ihre Heimat, ihre Familie oder ihr Aussehen lobt, denn den Frauen gefällt es in der Regel, Komplimente zu hören.
Nach diesem Vorgeplänkel kann der Mann dann die Frau davon zu überzeugen versuchen, wie glücklich es ihn machen würde, wenn ein so vollkommenes Wesen wie sie ihm ihre Liebe schenkte. Woraufhin sie bescheiden bestreitet – oder vorgibt zu bestreiten –, all die Eigenschaften zu besitzen, die er ihr zuschreibt.
Andreas Capellanus spielt auch besondere Konstellationen durch, etwa fortgeschrittenes Alter des männlichen Parts: »Ja, ich kann wohl sogar sagen, dass du, wenn du es recht überlegst, mein Alter geradezu als Vorteil für die Gewährung deiner Liebe anerkennen musst. Denn ich habe doch all die Jahre hindurch viel Lobenswertes getan.« Aber auch ein unerfahrener jugendlicher Bewerber, der noch gar keine Gelegenheit hatte, sich durch Taten auszuzeichnen, kann berechtigterweise zum Zuge kommen, wenn die Frau diesen »durch ihre Belehrungen dem Hof der Liebe zuführt und durch ihre Rechtschaffenheit zu einem lobenswerten Mann macht«.
Angesichts eines derartigen Abkommens ist die Konversation nur ein subtiles Spiel. In den Werken der Literatur erscheint die Liebeserklärung allerdings bisweilen als ein schwieriger Augenblick. Die Schüchternheit ist schließlich das Los beider Geschlechter. In Cligès von Chrétien de Troyes hat Soredamor Angst davor, sich dem Geliebten zu erklären. »Amor hat ihr ein Bad bereitet, das sie sehr erhitzt und sie verbrennt. Bald ist ihr wohl, bald ist ihr schlecht […].« Das ist gerade noch akzeptabel; es handelt sich um ein junges Mädchen, das die Zurückhaltung zeigt, die sich für ihr Geschlecht geziemt. Aber Alexander! Auch »er wagt es nicht, die, an die er am meisten denkt, anzusprechen«.
Die Verliebten schaffen es jedoch, ihr Schweigen zu überwinden. Ganz so, wie Ovid es den Verehrern empfiehlt, ihren Schönen verliebte Blicke zuzuwerfen, beginnen einige, mithilfe von Zeichen zu kommunizieren. Um die Schüchternheit zu überwinden, werden bisweilen Verklausulierungen gefunden. Im Roman Cligès versucht Fenice, den Geliebten dazu zu bringen, sich ihr zu erklären, indem sie ihn zunächst fragt, ob er eine Freundin in England hat. Der Held wagt nicht, ihr seine Liebe zu gestehen, und erklärt auf zweideutige Weise: »Madame«, sagt er, »ich habe dort geliebt, aber ich habe niemanden geliebt, der von dort gewesen wäre. So wie Rinde ohne Holz war mein Leib ohne Herz in Britannien.«
In dem Bild des vom Körper getrennten Herzens kann Cligès seine Schüchternheit einigermaßen überwinden. Er fragt Fenice: »Und Ihr, wie ist es Euch ergangen, seit Ihr in dieses Land gekommen seid?« Diese entwickelt die Metapher weiter. »An mir ist nichts als Rinde, ich lebe und existiere ohne Herz. Niemals bin ich in Britannien gewesen, und doch hat mein Herz ohne mich in Britannien ich weiß nicht welchen Handel getrieben.«
Und die beiden Helden überzeugen sich von ihrer gegenseitigen Liebe.
– Madame! Dann sind also unsere beiden Herzen hier bei uns, wie Ihr sagt, denn das meine gehört ohne Vorbehalt ganz Euch.
– Freund, und Ihr habt auch das meine, und so passen wir bestens zueinander. […]
Sie bleibt froh zurück, und froh geht er davon […].
Welche Freude, sich die gegenseitige Liebe zu gestehen. Aber dabei bleibt es nicht.