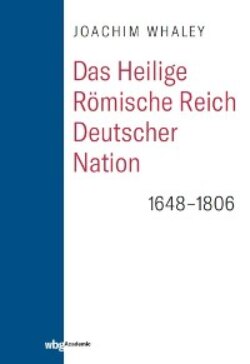Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 13
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
ОглавлениеNoch wichtiger waren die Fortschritte in Sachen Thronfolge und Durchführung des ersten Nachkriegsreichstags. Dabei kam dem Kaiser der wieder aufflammende Konflikt zwischen Kur- und anderen Fürsten zugute. Erstere waren bestrebt, ihre herausragende Stellung zu sichern, viele der übrigen drängten auf »Parifikation«, die Abschaffung der kurfürstlichen Vorrechte, um den Weg für ein wirklich föderales System zu ebnen.1 Den harten Kern der Opposition bildete eine Gruppe protestantischer Fürsten (Hessen-Kassel, die diversen Welfen- und Braunschweiger Herzöge sowie Württemberg) mit katholischer Unterstützung (etwa durch Pfalz-Neuburg). Ihnen missfielen die Vorrangstellung der (mehrheitlich katholischen) Kurfürsten, die Rolle des Mainzer Erzbischofs als Leiter des Reichstags und die Tatsache, dass der Vorstand des Fürstenkollegiums beim Reichstag abwechselnd von Österreich und Salzburg gestellt wurde, was in ihren Augen die katholische Übermacht im Reich untermauerte – eine Verzerrung der Machtverhältnisse, die sie nicht zu Unrecht mit dem in den Friedensverträgen festgeschriebenen Prinzip konfessioneller Gleichstellung unvereinbar fanden. Freilich ging es ihnen nicht nur um eine Stärkung des Paritätsprinzips, sondern auch um Verbesserung ihrer eigenen Position und Macht in einem reformierten Reich als echter Föderation von Gleichen. Diese grundlegende Spannung ließ Uneinigkeit in den wichtigsten konstitutionellen Belangen erwarten, deren Klärung die Friedensverträge an einen folgenden Reichstag verwiesen hatten.2
Zwei dieser Themen waren besonders wichtig und heikel: die Beratung über die Prozedur der Wahl eines designierten Thronfolgers (des Römischen Königs) und die Formulierung einer immerwährenden kaiserlichen Wahlkapitulation (capitulatio perpetua) als Grundgesetz, auf das alle zukünftigen Kaiser vor ihrer Krönung schwören mussten. Die radikalsten Oppositionsfürsten fassten mit französischer Unterstützung ein Verbot von Wahlen zu Lebzeiten des regierenden Kaisers (vivente imperatore) ins Auge, um dessen Einflussnahme zu verhindern. Darüber hinaus argumentierten sie, da die Wahlkapitulation eigentlich ein Reichsgesetz sei, müsse sie vom gesamten Reichstag formuliert und ratifiziert werden. Das lief letztlich auf eine Teilnahme sämtlicher Fürsten an Kaiserwahlen hinaus.
Den Friedensverträgen zufolge sollte der Reichstag spätestens bis 18. August 1649 eröffnet werden, aber Ferdinand III. und der Kurfürst von Mainz waren wegen der oppositionellen Fürsten auf der Hut. Die Interessen des Kaisers teilten nun auch Schönborn und die anderen Kurfürsten. Aber der Reichstag ließ sich nicht auf unbestimmte Zeit hinauszögern. Schließlich hing die Stabilität des Reichs davon ab, dass die Friedensverträge formell ratifiziert und ihre Bestimmungen per Reichsabschied in Reichsrecht übersetzt, das heißt in das endgültige Dekret eingebettet wurden, das sämtliche von »Kaiser und Reich« beim Reichstag in Übereinstimmung getroffenen Entscheidungen verkündete. Ende April 1652 sah sich Ferdinand unter laufend neuen Nachrichten von der Agitation der opponierenden Fürsten verpflichtet, den Reichstag für den 31. Oktober 1652 nach Regensburg einzuberufen.
Aus Sorge um die Opposition war Ferdinand indes entschlossen, das Kernproblem der Thronfolge zu lösen, bevor der Reichstag zusammengetreten war. Im Herbst 1652 lud er die Kurfürsten zu einer Konferenz nach Prag.3 Um nicht den Verdacht einer Verschwörung zur Übernahme der Herrschaft wie 1636 aufkommen zu lassen, reisten die Kurfürsten »zu Besuchen« nach Prag, wo sie Geheimgespräche untereinander und mit dem Kaiser führten. Es gab keine offiziellen Treffen und keine formellen Beschlüsse, dennoch verständigte man sich darauf, Ferdinands Sohn zum Römischen König zu wählen.
Am 12. Dezember zog der Kaiser mit einem Gefolge von dreitausend Mann, darunter fünfzig Fürsten und Grafen, sechzig Musiker, drei Hofnarren und drei Zwerge, triumphal in Regensburg ein.4 Neben anderen prachtvollen Veranstaltungen führte sein Hoforchester eine Oper auf und Schönborn veranlasste den Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke zur ersten öffentlichen Vorführung seiner Technik zur Erzeugung eines Vakuums mittels einer Luftpumpe zwischen zwei Kupferhalbkugeln, die zwei Gespanne von je acht Pferden nicht auseinanderreißen konnten.5
Der Kaiser hatte es nicht eilig, die Beratungen zu eröffnen, ehe nicht eine weitere Prozedur vollzogen war: die Wahl und Krönung seines Sohnes.6 Die Zeit drängte, da die Opposition bei informellen Treffen im März und April begonnen hatte, wichtige Reformen zu debattieren. Daher wurden die Kurfürsten nach Augsburg geladen, wo sie am 31. Mai 1653 ordnungsgemäß Ferdinand IV. wählten. Zurück in Regensburg wurde der junge Ferdinand am 18. Juni zum Römischen König und designierten Thronfolger im Reich gekrönt. Es kam zu weiteren Verzögerungen, weil die Stimme des Großen Kurfürsten mit der Zusage erkauft worden war, Ferdinand werde Königin Christina eine Belehnung mit deutschen Gebieten so lange verweigern, bis Schwedens Disput mit Brandenburg über Ostpommern und die baltischen Zölle beigelegt war.7 Erst am 28. Juni traf die Nachricht vom schwedischen Einlenken angesichts des angedrohten Ausschlusses vom Reichstag in Regensburg ein. Drei Tage darauf wurde der Reichstag offiziell eröffnet.
Die Opposition war düpiert, aber nicht unterworfen. Die Frage der Kaiserwahl anzusprechen, wurde ihr vorenthalten, weitere Beratungen zu diesem Thema auf einen zukünftigen Reichstag verschoben. Dennoch blieben dem Reichstag, der bis zum 17. Mai 1654 tagte, fundamentale Probleme zu diskutieren: die Zusammensetzung der Ordentlichen Reichsdeputation und die Frage, ob Reichssteuern per Abstimmung mehrheitlich beschlossen werden sollten. Diese prozeduralen Fragen betrafen konstitutionelle Prinzipien und die Opposition zeigte Geschlossenheit, die noch untermauert wurde, als der Große Kurfürst das kaiserlich-kurfürstliche Lager im Stich ließ. Dies ging teilweise auf den Einfluss des fanatisch antihabsburgischen Organisators des Wetterauer Grafenvereins und brandenburgischen Hofrats Georg Friedrich von Waldeck zurück, aber auch auf die Enttäuschung der Brandenburger über Ferdinands Weigerung, ihnen das schlesische Herzogtum Jägerndorf abzutreten, das 1621 dem Markgrafen von Brandenburg-Ansbach entzogen worden war.8
Die Zusammensetzung der Deputation war von Bedeutung, weil sie als eine Art ständiges Komitee alle zwischen den Reichstagssitzungen anfallenden geschäftlichen Angelegenheiten erledigen sollte. Laut Absprache war die Deputation in zwei Kollegien geteilt, eines der Kurfürsten und eines der Fürsten, Herzöge und Reichsstädte. Die oppositionellen Fürsten wussten das Recht auf ihrer Seite, wenn sie konfessionelle Parität in beiden Kollegien forderten: Schließlich war diese in den Friedensverträgen von 1648 festgeschriebenes Verfassungsprinzip.
Im zweiten Kollegium fiel der konfessionelle Ausgleich relativ leicht.9 Dafür sorgten schon die beiden beteiligten Reichsstädte (das katholische Köln und das lutherische Nürnberg). Nach langen Diskussionen kamen in Anerkennung der Bildung eines Städtekollegiums im Reichstag vier weitere Städte dazu. Die katholische 9:4-Mehrheit unter den Fürsten behob man durch die Hinzuziehung von vier Protestanten (aus Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und Württemberg) und einem Vertreter der Wetterauer Grafen, der deren kollektive Kuriatstimme im Reichstag hielt. Das wirkliche Problem war die Herbeiführung der Parität unter den Kurfürsten, bei denen eine katholische 4:3-Mehrheit herrschte (den Kurfürsten von Böhmen ausgenommen, der nur an der Wahl des Römischen Königs teilnahm).10 Die radikaleren Fürsten forderten die Zusammenlegung der beiden Kollegien, scheiterten damit und schlugen nun vor, ein weiteres Kurfürstentum zu errichten. Wenige Tage vor Ende der Sitzungen akzeptierten Ferdinand und die Kurfürsten widerstrebend einen Kompromiss: Bis zu einer endgültigen Entscheidung auf dem nächsten Reichstag sollte eine vierte protestantische Stimme zwischen den drei existierenden protestantischen Kurfürsten (Brandenburg, Sachsen und Pfalz) wechseln.
Was die Mehrheitsentscheidung über Reichssteuern betraf, stand Brandenburg hingegen fest auf Seiten der Fürsten. Der Kaiser konnte sich in der langen Debatte ebenso wenig durchsetzen wie seine Vorgänger im 16. Jahrhundert. Entscheidungen über Steuern waren weiterhin nur bei Einstimmigkeit gültig. Die Fürsten gingen prompt daran, ihre Rechte in diesem Bereich zu demonstrieren, als sie das Ersuchen des Kaisers um 60 Römermonate zur Finanzierung des Reichstags ablehnten und vereinbarten, die bereits zuvor zugesagten 100 Römermonate für die Kosten der Konferenzen in Münster und Osnabrück müsse nur entrichten, wer der Zahlung zugestimmt habe.11 Hingegen gewährten sie Karl II. einen Zuschuss von vier Römermonaten für seinen Kampf um die englische Krone. Solidarität fiel bei einem fernen Monarchen leichter.
Die Kontroverse um die Kaiserwahlen köchelte während der Diskussion über die Bedingungen der Wahlkapitulation für den neuen Römischen Kaiser weiter. Die Einigung orientierte sich letztlich an früheren Kapitulationen, mit kleinen Konzessionen an die Fürsten, etwa dem Zusatz, sie sei »im Namen aller Kurfürsten und aller Fürsten und Stände« zustandegekommen.12 Andere grundlegende Streitpunkte blieben ungeklärt. Die Debatte zur Verteidigung scheiterte an der Weigerung der Stände, die Bildung einer Reichsarmee mitzutragen: Stattdessen sollte es jedem Reichsstand gestattet sein, Steuern für seine eigene Verteidigung zu erheben, wodurch die Fürsten das Recht erhielten, ohne Zustimmung ihrer Territorialstände Steuergelder einzutreiben.13 Streitigkeiten über Zölle (die die Fürsten ohne die traditionell nötige Erlaubnis des Kaisers und der Kurfürsten festsetzen wollten) und die Stapelrechte der Reichsstädte (die die Fürsten auf ihre eigenen Städte ausweiten wollten) blieben ebenfalls ungelöst.
Ganz allgemein erwiesen sich Unstimmigkeiten über Rechte und Privilegien, die von konstitutioneller Tragweite waren beziehungsweise widerstreitende materielle Interessen betrafen, als unlösbar. Hingegen einigte man sich in einigen Punkten, die allen zugutekamen, etwa auf neue Regeln für das Reichskammergericht, an denen eine Deputation ab 1641 gearbeitet hatte, eine Erneuerung der Exekutionsordnung von 1555 mit allen späteren Revisionen und Erweiterungen sowie auf die Wiedereinführung der alten Kreise.
Ebenso wichtig war die Frage der während des Krieges aufgelaufenen Schulden. 1648 waren so gut wie sämtliche Reichsstädte und viele andere Reichsstände bankrott.14 Einige Fürsten hatten bereits in den 1620er Jahren regionale Schuldzinszahlungen ausgesetzt, aber die meisten (auch Brandenburg) zögerten, lokale Maßnahmen zu ergreifen, die gegen Reichsgesetze verstießen. In anderen Ländern Europas wäre die Lösung gewesen, den Bankrott zu erklären und alle Schulden zu streichen. In der Debatte über die Schulden im Reich nach 1648 herrschte der Konsens, dass zumindest das Kapital der Kreditgeber garantiert sein musste. Das Ergebnis war ein dreijähriges Moratorium auf Kapitalrückzahlungen und eine 75-prozentige Kürzung aller bis 17. Mai 1654 anfallenden Zinsen, ab diesem Zeitpunkt waren alle alten und neuen Anleihzinsen auf höchstens fünf Prozent begrenzt.15 Der Fall der Pfalz, deren Schulden katastrophal waren, wurde an den Reichshofrat und damit den Kaiser verwiesen, der ein zehnjähriges Moratorium und eine 50-prozentige Kürzung der Zinszahlungen für weitere zehn Jahre zugestand.
Wie wichtig diese Vereinbarungen für die Territorien waren und auf welche Weise sie manipuliert und missbraucht wurden, werden wir noch sehen.16 In zweierlei Hinsicht indes waren sie als Reichsgesetze von Bedeutung. Alle Reichsstände erkannten die Notwendigkeit klarer Regeln für »öffentliche« Schulden und erklärten sich bereit, Kapital als unantastbar zu betrachten. Zweitens wiesen sie dem Reichsgerichtshof eine Schlüsselrolle in Disputen über die aktuelle Schuldenkrise und zukünftige Probleme zu. Damit waren derartige Angelegenheiten künftig Sache des Kaisers, dessen Vorrechte somit implizit um die Gewährung der Aussetzung von Zinszahlungen und die Einsetzung von Schuldenkommissionen (effektiven Konkursverwaltungen) zur Rettung bankrotter Reichsstände erweitert wurden.17 Zusammen mit dem existierenden (1648 formulierten) Recht, kaiserliche Kommissionen zur Klärung von Streitigkeiten innerhalb und zwischen Reichsständen zu entsenden, bedeutete die neue Rolle des Kaisers als eine Art »finanzieller Wachhund« mit vielen Befugnissen eines Treuhänders eine klare Stärkung seiner Autorität.
Die Reichsstände trugen solcherart zur »Modernisierung« der traditionellen feudalhierarchischen Funktionen des Kaisers und zu ihrer Einbettung in den gesetzlichen Rahmen des Reichs bei. Der Kaiser wiederum zögerte nicht, seine Vorrechte auf dem Reichstag auszuüben. Ohne die Reichsstände auch nur zu konsultieren, verkündete er am 16. März 1654 eine neue Verfassung für den Reichshofrat und sorgte für die Ernennung protestantischer Räte18, wobei er sich ausdrücklich nicht an das Prinzip der strikten Parität hielt. Proteste der Oppositionsfürsten fegte er einfach beiseite: Der Hof sollte des Kaisers persönlicher Hof bleiben, ohne jeden Einfluss der Stände.
Zweitens berief Ferdinand acht ehemalige Grafen und einen früheren Reichsritter, den er in den Fürstenstand erhoben hatte, in den Reichstag. Sie waren treue Diener der Krone und mit einer Ausnahme sämtlich katholisch.19 Dieser Schritt löste solche Empörung aus, dass er versprechen musste, zukünftige Berufungen nur mit Zustimmung der Fürsten vorzunehmen. Aber er zeitigte den gewünschten Erfolg: Der Kaiser hatte seine feudale Oberherrschaft wiederhergestellt.
Drittens setzte Ferdinand seine dynastischen Interessen durch und wehrte Versuche von Brandenburg und anderen ab, die Misere der Protestanten in seinen eigenen Erblanden aufs Tapet zu bringen. Dadurch bestätigte er ihren Ausschluss von der Gesetzgebung des Reichs und beschleunigte dessen Rekatholisierung.20 Zudem behielt er alle Besitz- und Feudalherrschaftsrechte in Bezug auf die Landvogtei Ober- und Niederschwaben als wichtiges Machtinstrument der Habsburger im schwäbischen Kreis.21
Die pompöse Krönung von Kaiserin Eleonora am 4. August 1653 schließlich war zwar verfassungsrechtlich bedeutungsloses Theater, stärkte aber die Aura kaiserlicher Majestät und rückte die Fürstäbte von Kempten, Fulda und Corvey ins Rampenlicht, die traditionell bei solchen Anlässen anstelle der Kurfürsten amtierten.22
Der am 17. Mai 1654 verlesene Jüngste Reichsabschied (so benannt, weil er der letzte vor dem Zusammentreten des Immerwährenden Reichstags 1664 blieb) dokumentierte das Scheitern an der von den Friedensverträgen für den Reichstag vorgegebenen Agenda. Viele Kernfragen blieben offen, was indes für alle Beteiligten besser war als ein Beschluss zu ihren Ungunsten. Zum Verdruss vieler Fürsten ging der Kaiser gestärkt aus den Verhandlungen hervor. Schwedens Einfluss war infolge der Aggressionen gegen Bremen und Pommern geschwächt, Frankreich immer noch hauptsächlich mit heftigen inneren Unruhen (der Fronde) beschäftigt. Die meisten deutschen Fürsten wollten Frieden. Selbst die formelle Einführung konfessioneller Corpora beim Reichstag wirkte zugunsten von Ferdinand.23 Das von Kurmainz geleitete und von einer Mehrheit katholischer Bischöfe und Prälaten dominierte Corpus Catholicorum war grundsätzlich kaisertreu. Das Corpus Evangelicorum wiederum wählte nach langer Debatte den Kurfürsten von Sachsen zu seinem Führer und vermied damit eine direkte Opposition zur Krone. Die feindseligen Absichten Brandenburgs und der oppositionellen Fürsten wurden in Regensburg 1653/54 und in den Jahrzehnten danach durch den traditionellen Loyalismus der sächsischen Kurfürsten im Zaum gehalten. Letztlich gereichte es Ferdinand zum Triumph, dass er persönlich präsidiert, eine Reihe bedeutender Gesetzesreformen eingeleitet und vor allem die Thronfolge gesichert hatte.24
Die Wende kam bald. Sechs Wochen nach Ende des Reichstags, am 9. Juli 1654, starb König Ferdinand im Alter von zwanzig Jahren. Diesmal war eine schnelle Kaiserwahl unmöglich, da der nächste Habsburger, Erzherzog Leopold, noch minderjährig war. Der Tod seines Bruders machte Leopold zum österreichischen Thronfolger, 1655 wurde er König von Ungarn, 1656 König von Böhmen. Das Reichsgesetz schrieb jedoch vor, dass ein Römischer König und ein Kaiser wie ein Kurfürst achtzehn Jahre alt sein musste, um ins Amt gewählt werden zu können.25 Leopold war am 9. Juni 1640 geboren und hatte somit vorläufig keine Aussichten auf die Kaiserkrone.
Während die Reichsregierung vorübergehend lahmgelegt war, organisierte sich die Opposition weiter. Die »alten Fürsten« trugen ihren Groll in die Deputation, die in Frankfurt zusammentrat, um die Verhandlungen über die beim Reichstag offen gebliebenen Punkte fortzusetzen.26 Katholische und protestantische Fürsten führten hektische Gespräche über Ligen zur gegenseitigen Absicherung und Verteidigung. Dass der Kaiser Truppen nach Italien entsandt hatte, verunsicherte viele. Vordergründig diente der Einsatz der Verteidigung des kaiserlichen Lehens Modena, aber sowohl französische als auch deutsche Fürsten glaubten, Ferdinand unterstütze damit heimlich Spanien, was gegen den Vertrag von 1648 verstieß. Zugleich war mit der erfolgreichen Niederschlagung der Fronde 1656 die französische Politik wieder erstarkt. Kriegsdrohungen gegen Österreich für den Fall einer Fortsetzung der kaiserlichen Militäroperationen in Norditalien verstärkten die Spannungen dramatisch, während erneute diplomatische Avancen Frankreichs an diverse deutsche Fürstenhöfe die latente Opposition gegen Habsburg und das Misstrauen gegenüber Ferdinands Absichten befeuerten.27
Dem Tod Ferdinands III. am 2. April 1657 folgte ein fünfzehnmonatiges Interregnum. Die Frankfurter Deputation, ohnehin gelähmt durch die Spannungen zwischen Kurfürsten und Fürsten sowie Katholiken und Protestanten, verwickelte sich in eine Debatte darüber, ob sie überhaupt weitertagen konnte.28 Jegliche Hoffnung auf wirksame Führung durch die in der Goldenen Bulle als provisorische Herrscher vorgesehenen Reichsvikare (der Kurfürst von Sachsen für den Norden, der pfälzische Kurfürst für das »Rheinland«, das heißt den Süden) zerschlug der bittere Zwist zwischen der Pfalz und Bayern über die Frage, ob Bayern das Vikariat 1623 zusammen mit der pfälzischen Kurwürde ererbt hatte.29 In dieser verwirrten Lage bemühte sich der Kurfürst von Mainz, das Problem der Thronfolge zu lösen und ein dauerhaftes System zu etablieren, das die Habsburger einband und zugleich ihre Vorherrschaft im Reich verhinderte.
Trotz einer Reihe anderer Kandidaten und obwohl Mazarin, Karl X. von Schweden und Cromwell einen weiteren habsburgischen Kaiser ablehnten, war Leopold der einzige ernsthafte Anwärter.30 Mazarin setzte zunächst auf den jungen Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern, der jedoch sofort absagte, dann auf den Bruder des verstorbenen Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm, bis 1656 Statthalter in den Spanischen Niederlanden, und auf Erzherzog Ferdinand von Tirol, der schon älter war und zumindest eine weitere Wahl in nicht allzu ferner Zukunft ermöglicht hätte, bei der vielleicht sogar Ludwig XIV. selbst als Kaiser infrage gekommen wäre. Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1653–1690) war ebenfalls im Gespräch. Die Habsburger Erzherzöge lehnten es aber ab, dem designierten Thronfolger ihrer Dynastie im Weg zu stehen, und die nichthabsburgischen Kandidaten waren schlichtweg ungeeignet.
Der Kurfürst von Bayern sah ein, dass es ihm an Ressourcen und Macht fehlte, um Kaiser zu werden. Pfalz-Neuburg war in dieser Hinsicht noch weniger qualifiziert und aufgrund des Disputs über das Jülich-Kleve-Erbe für den Kurfürsten von Brandenburg sowieso inakzeptabel. Schönborn war mehr oder weniger von Beginn an überzeugt, dass nur Leopold infrage kam. Er sicherte sich bald auch die bayerische Stimme und die des Kurfürsten von Brandenburg, der auf Beistand aus Wien im Nordischen Krieg hoffte. Die neue türkische Bedrohung 1657 ließ die alten Hoffnungen auf einen habsburgischen Kaiser als Garanten der Sicherheit an der Südostgrenze des Reichs wieder aufleben. Ebenso zufällig vertrieb die Geburt eines männlichen Erben für den spanischen Thron im selben Jahr alle Befürchtungen, Leopold könne nach seiner beabsichtigten Heirat mit der Infantin Maria Theresia, der ältesten Tochter Philipps IV., den spanischen Thron besteigen und das Imperium Karls V. wiedererrichten.
Dem Kurfürsten von Mainz ging es darum, die Wahl zu verzögern, bis Leopold alt genug war, und diesen Aufschub zu nutzen, um sicherzustellen, dass Leopolds Möglichkeiten als Herrscher strikt beschränkt sein würden. Ersteres war ein Leichtes, das Zweite führte zu heftigem Geschacher um die Wahlkapitulation. Am Ende musste Leopold zusichern, auf jedes Hilfsangebot an Spanien in Burgund und Italien zu verzichten, seine Truppen aus Italien abzuziehen und die Maßnahmen seines Vaters gegen italienische Lehen wie Savoyen, dessen Herzog ein französischer Verbündeter war, außer Kraft zu setzen.31
Den Unwillen der Wiener Repräsentanten dämpfte nur eine Klausel, die umgekehrt Frankreich und seinen Verbündeten untersagte, Feinden des Kaisers und seiner deutschen Dynastie, des Reichs und irgendeines Reichsstandes Hilfe zu leisten. Diese Geste war im Grunde bedeutungslos, weil der König von Frankreich sich schwerlich auf die Wahlkapitulation des deutschen Kaisers verpflichten ließ. Andere Klauseln verdeutlichten die Entschlossenheit der Kurfürsten: Der Reichshofrat wurde des Rechts enthoben, Beschwerden von Untertanen wegen Steuern für militärische Zwecke anzuhören, die Mitgliedschaft im Reichshofrat und im Geheimen Rat wurde auf Einwohner des Reichs beschränkt und der Kaiser durfte ohne Zustimmung der Kurfürsten weder Allianzen bilden noch über irgendjemanden die Reichsacht verhängen. Erst als Leopold allen Bedingungen zugestimmt hatte, wurde er am 18. Juli 1658 gewählt und am 1. August gekrönt, nur knapp zwei Monate nach seinem achtzehnten Geburtstag.
Für notwendig erachtet wurden zwei weitere Versicherungen gegen erneuerte Ansprüche der Habsburger. Die Chance auf eine österreichische Thronfolge in Spanien wurde weiter geschmälert. Leopold musste auf die Heirat mit Maria Theresia verzichten; nach dem Pyrenäenfrieden und dem Frieden von Oliva ehelichte sie 1660 Ludwig XIV.32 Zwar verpflichtete Philipp IV. beide Partner, zukünftigen Ansprüchen auf die spanische Thronfolge abzuschwören, versäumte es jedoch, die Kompensation von 500.000 Kronen zu entrichten, was die Vereinbarung etwas glaubwürdiger, wenn auch noch lange nicht rechtlich durchsetzbar gemacht hätte. Dass Philipp Leopold seine zweite Tochter Margarita Theresa versprach, war eine gewisse Entschädigung; sie war jedoch bei der offiziellen Verkündung der Verlobung 1663 erst zwölf Jahre alt. Ihren Ehemann, den sie durch bevollmächtigte Vertretung 1666 in Spanien heiratete, nannte sie bis zu ihrem Tod 1673 »Onkel« (Maria Theresia überlebte sie bis 1683). Als Leopold die Herrschaft antrat, konnte Frankreich deshalb eher Ansprüche auf den spanischen Thron erheben als die Österreicher – eine Gefahr, die konkret zu werden schien, als Philipps Thronerbe Philipp Prosper 1661 dreijährig starb. Die Geburt eines weiteren Thronfolgers fünf Tage später brachte wenig: Karl II. (»der Verhexte«) war schwach und kränklich und litt mehr unter den genetischen Folgen der seit Generationen herrschenden Inzucht der Habsburger als die meisten anderen Mitglieder der Großfamilie.
Dass Karl bis 1700 am Leben blieb, war ein kleines Wunder, vor allem, da die Teufelsaustreibungen und andere »Kuren«, denen er sich zur Heilung seiner Impotenz unterzog, sein Ableben empfindlich beschleunigten. Bis dahin überschattete das Erbfolgeproblem die europäische Politik. Mit dem Tod Philipps IV. 1665 schien tatsächlich auch das Aussterben der Habsburger zu drohen, da der fünfundzwanzigjährige Junggeselle Leopold und der kränkliche Infant Karl die einzigen männlichen Überlebenden waren. Leopold zeugte 1678 (Joseph) und 1685 (Karl) zwei männliche Erben, die allgemein habsburgfeindliche Stimmung in Europa begünstigte aber die französischen Ansprüche und stärkte die politische Macht Frankreichs. Obendrein verkomplizierte sich die Lage in Deutschland, da Kaiserin Margarita 1673 ihren eigenen Anspruch auf den spanischen Thron an das einzige überlebende ihrer vier Kinder vererbte: Maria Antonia, die 1684 den Kurfürsten Max II. Emanuel von Bayern heiratete.33
Erbfolgeansprüche auf die spanische Krone zu erheben, war ein auf lange Dauer angelegtes Spiel auf der europäischen Bühne. Schönborn und Mazarin suchten nach einem zweiten, kurzfristigeren Mittel zum Schutz gegen kaiserliche Ambitionen. In diesem Sinn bildete der Rheinische Bund den Höhepunkt der regionalen Allianzen der 1650er Jahre und eine einheimische Lösung für die Probleme, zu denen die Thronfolge eines weiteren Habsburgers führte.
Aber der Bund verlor seinen wesentlichen Zweck schon kurz nach der Gründung. Zwar wurde er 1661 und 1663 erneuert, 1665 schloss sich Brandenburg an. Der Enthusiasmus verflog jedoch, als klar wurde, dass er kaum mehr als ein Instrument französischer Politik im Reich war.34 Nach dem Pyrenäenfrieden 1659 und dem Frieden von Oliva 1660 ließ die Furcht, in einen europäischen Krieg zwischen den Habsburgern und ihren Gegnern hineingezogen zu werden, nach. Die Spannungen zwischen Kurfürsten und Fürsten, eines der Kernthemen der deutschen Politik jener Zeit, prägte auch die Verhandlungen des Rheinischen Bundes, und erneute konfessionelle Konflikte nagten an der Solidarität der Union. Der Kurfürst von Mainz trug 1663 dazu bei, indem er die Truppen des Bundes heranzog, um das Freiheitsstreben der Stadt Erfurt niederzuschlagen, einer protestantischen Enklave von Mainz, deren gewaltsame »Reduktion« viele protestantische Fürsten empörte. Bei anderen wesentlichen Themen, etwa dem Streit über die Braunschweiger Thronfolge 1665, gelang es dem Bund schlichtweg nicht, zu einer einheitlichen Politik zu finden. 1665 griff Mainz gar gegen die Pfalz zu den Waffen, als diese die Lehnsherrschaft über bestimmte Einwohner des Territoriums ihrer Nachbarn beanspruchte; das Vorgehen der geistlichen Kurfürsten führte schnell zur Bildung einer breiten Koalition protestantischer Fürsten.35 In beiden Fällen blieben kaiserliche Vermittlungsversuche vergeblich; entschärft wurde die Krise erst, als Frankreich einschritt.
So weit erfüllte Frankreich seine Rolle als Garant des Friedens von 1648. Der Angriff Ludwigs XIV. auf die Spanischen Niederlande 1667 signalisierte jedoch eine aggressivere Haltung, die mit der friedenserhaltenden Zielsetzung des Rheinischen Bundes und den Interessen seiner Mitglieder nicht zu vereinbaren war. Viele fürchteten, der neue französische Feldzug gegen Spanien auf einem Gebiet, das rechtlich zum Reich gehörte, werde die Deutschen in den Konflikt hineinziehen. Eine Distanzierung von Frankreich schien daher ratsam. Im August 1668 wurde der Bund aufgelöst. Inzwischen stand ohnehin der Reichstag, der seit 1663 permanent tagte, im Blickpunkt der deutschen Politik und viele Fürsten betrachteten wieder eher den Kaiser als den französischen König als Schlichter und Lenker des Reichs.
Jene, die Leopold I. gewählt hatten, weil sie sich einen schwachen Kaiser wünschten, wurden enttäuscht. Am Ende der siebenundvierzig Jahre seiner Herrschaft übertraf seine Macht im Reich womöglich die seiner sämtlichen Vorgänger und Nachfolger, was zu einem Großteil auf sein geschicktes Vorgehen in der Reichspolitik und die clevere Ausnutzung kaiserlicher Vorrechte zurückzuführen war. Er verdankte seine Autorität im Wesentlichen dem Triumph über zwei Gegner, die seine Herrschaft von außen infrage stellten: die Ottomanen im Osten und Frankreich im Westen. Diese Herausforderungen und seine Reaktionen darauf werden indes oft eher in österreichischem Kontext als dem des Reichs gesehen.36 Ohne Zweifel hatte Österreich um 1705 als Verbund von Territorien innerhalb und außerhalb des Reichs den Status einer europäischen Großmacht erreicht. Es war der größte Nutznießer der Kämpfe mit den Türken und des Krieges gegen Frankreich, an das das Reich hingegen Gebiete abtreten musste. Aber das Reich war mehr als nur das Opfer eines Kollateralschadens in einem weitläufigeren Machtkampf. Die von seinen traditionellen Feinden geführten Angriffe während Leopolds Herrschaft hatten auch tiefgreifende Folgen für das Reich selbst.