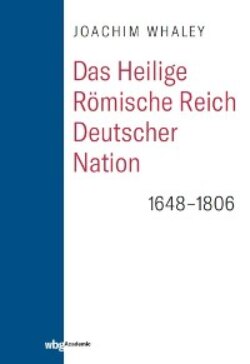Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 23
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
ОглавлениеFür Teile des deutschen Adels wurde der Hof in Wien während der Herrschaft Leopolds I. auf neue Weise attraktiv. Ihn Kaiserhof zu nennen, ist etwas problematisch, da er drei Rollen in sich vereinte.1 Erstens war er das Zentrum des Erzherzogtums Österreich, zweitens nahm Wien als österreichische Gesamthauptstadt eine besondere Stellung unter den diversen Zentren der Habsburger ein. Residenzen unterhielten sie in Graz, Innsbruck, Prag, Brünn und Pressburg (später auch die Höfe der Statthalter in Brüssel und Mailand), wobei Graz, Prag und Innsbruck wichtige Administrationszentralen blieben; offizielle Höfe gab es dort um 1700 jedoch nicht.
Drittens war Wien als Sitz des Reichshofrats und der Reichskanzlei in gewissem Sinn auch die »Hauptstadt« des Reichs, obwohl es nicht im Sinn von Regensburg, Augsburg und Frankfurt Reichsstadt war. Als administrativer Knotenpunkt mit diesen drei Funktionen erlebte Wien einen gewaltigen Anstieg der Anzahl der Funktionäre und Beamten. Aber die Zunahme von etwa 225 auf gut 400 in den diversen Zentralbehörden und Kanzleien um 1700 war moderat in Relation zu der Vielzahl der Bereiche, für die sie theoretisch zuständig waren.2 Zwar spielten sich die meisten administrativen und regierungsamtlichen Geschäfte auf territorialer Ebene ab sowie, was das Reich betraf, im Reichstag und in den Kreisen. Dennoch ist der Unterschied zur Anzahl der Hofbeamten eklatant, von denen es um 1700 über tausend gab – eine immer noch bescheidene Anzahl im Vergleich zum Hof Ludwigs XIV. in Versailles, der ungefähr zehnmal größer war.
Ab den 1620er Jahren dominierte am Hof der österreichisch-böhmische Adel. Den Kern bildeten Familien, die in der großen Krise von 1618 Loyalität gezeigt hatten und mit von protestantischen Rebellen konfiszierten Ländereien reich belohnt worden waren. Ihre Hauptzentren lagen außerhalb des Reichs, aber die Erhebung in den Reichsfürstenstand stärkte die Stellung von Dynastien wie Liechtenstein, Auersperg, Dietrichstein, Eggenberg, Portia und Schwarzenberg.3 Dagegen wie gegen die Ernennung einer Reihe von Reichsgrafen erhob sich beträchtlicher Widerstand von älteren Fürstenfamilien, die durchsetzen konnten, dass neu Nobilitierte durch angemessenen Besitz im Reich qualifiziert sein mussten, um zum Reichstag zugelassen zu werden. Das dauerte manchmal Jahrzehnte und erforderte bisweilen den rechtlichen Kniff, im Reich gekaufte Ländereien mit quasifürstlichem Status auszustatten. Die Liechtensteins erwarben ihren Fürstentitel im frühen 17. Jahrhundert, kauften Vaduz aber erst 1699 und Schellenberg 1712.4 Entscheidend blieb die ursprüngliche Verleihung des Titels, den die Begünstigten von Anfang an führten, durch den Kaiser.
Weniger Probleme gab es mit Grafen und Freiherren, da sie überhaupt kein Land im Reich besitzen mussten und als sogenannte Personalisten erhoben werden konnten. Manche brauchten aber auch gar kein zusätzliches Motiv, um in Ländereien im Reich zu investieren, galten diese doch lange Zeit als sicherer als Land in Ungarn oder selbst Böhmen. In manchen Fällen war Grundbesitz im Reich auch die einzige Möglichkeit, Kolonisten für von den Türken übernommenes neues Territorium zu finden, vor allem in Zeiten, da deutsche Fürsten sich alle Mühe gaben, ihre eigene Bevölkerung zu vergrößern und Auswanderung zu verhindern.5
Zwar dominierten österreichisch-böhmische Magnaten den Wiener Hof, er bot jedoch auch eine Fülle von Möglichkeiten für Adlige aus dem Reich.6 Besonders wichtig waren in dieser Hinsicht der Dienst in der Reichsarmee sowie hohe Positionen im Reichshofrat und den verschiedenen Kanzleien. Sowohl die Reichsarmee als auch der Reichshofrat beschäftigte Protestanten, wenn auch in letzterem Fall nicht getreu dem Prinzip konfessioneller Parität.
Wie manche Österreicher Land im Reich erwarben, so akquirierten nach 1650 einige schwäbische, fränkische und rheinische Familien, begünstigt durch die Eroberungen im Südosten, Besitztümer auf habsburgischem Gebiet. Deutsche Familien wie Salm-Neuburg, Salm-Reifferscheidt, Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Oettingen, Fugger und Fürstenberg etablierten sich in Österreich und Böhmen.7 Deutsche Adlige mit Ländereien in Kroatien und anderswo waren ab dem späten 17. Jahrhundert ein gängiges Merkmal des Systems der Habsburger.
Reichsdeutsche waren auch unter der wachsenden Anzahl von überwiegend ehrenamtlichen Geheimräten und adligen Kammerherren gut vertreten. Die Anzahl der Geheimräte stieg von zehn im 16. Jahrhundert auf 110 um 1700; nur wenige davon dienten tatsächlich im inneren Rat, der Konferenz. Ebenso entscheidend für die wachsende Größe des Hofs war nach 1600 die zunehmende Unterscheidung zwischen bezahlten und unbezahlten Amtsträgern. Eine kleinere Gruppe entlohnter Beamter leistete die notwendigen Dienste (etwa in den Gemächern, in der Kirche, bei Tisch – sogenannte Kammerherren ohne Schlüssel), während der Titel Kammerherr und der Schlüssel, der den Zugang zum Monarchen symbolisierte, wesentlich mehr Adligen verliehen wurde: Allein von 1654 bis 1685 ernannte Leopold I. mehr als 600.8 Ehrentitel wie der eines Erzmarschalls der Kaiserin, der 1683 dem schwäbischen Fürstabt von Kempten, Rupert von Bodman, verliehen wurde, stärkten zudem bestehende Loyalitäten. Das galt auch für das Prädikat »adlig« und für das 1697 bestätigte Recht, neue Familien ins Patriziat von Nürnberg zu kooptieren.9
Ob der Hof unter Leopold I. auf Kosten der protestantischen Adligen katholischer wurde, ist schwer zu sagen. Die Bedeutung der katholischen Frömmigkeit für den Kaiser persönlich wie für seine Herrschaft in den eigenen Ländern ist kaum zu bezweifeln.10 1684 gab das päpstliche Sekretariat eine kommentierte Liste der Reichsfürsten in Auftrag, in der Hoffnung, einzelne davon für eine Konversion vom Luthertum zum Katholizismus zu gewinnen.11 Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass dieses Dénombrement je ernsthaft durchgeführt wurde. Die wenigen, manchmal politisch heftig umstrittenen Übertritte von Fürsten fanden eher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts statt, nicht unter Leopolds Herrschaft.12 Die Bikonfessionalität zog in der Reichspolitik einige Zwänge nach sich. Leopold scheint die daraus folgenden Regeln respektiert zu haben, ebenso der Erzbischof von Mainz als Erzkanzler und andere führende Amtsträger. Der Kaiser und der Kurmainzer Bischof setzten auf die Fürsten der Reichskirche und die säkularen Reichsfürsten, aber sie brauchten stets auch protestantische Verbündete.
Deutsche Adlige am Wiener Hof und österreichisch-böhmische im Reich verflochten die Habsburger und ihre Länder mit dem Reich. Es war charakteristisch für Leopolds aktive Herrschaft im Reich, dass er bestrebt war, die Übertragung von Titeln zum Vorteil der Krone zu nutzen und seine Vorrechte als oberster Lehnsherr auszuüben. Nicht immer mit Erfolg: Die Erhebung der Heiligenberg-Linie der Grafen Fürstenberg zu Fürsten 1664 brachte die Brüder Franz Egon und Wilhelm Egon nicht von ihrem lebenslangen Eintreten für die französische Sache ab.13
Der Fall Ostfriesland hingegen ist ein Beispiel für den meisterhaften Einsatz kaiserlicher Privilegien. 1662 wurden die lutherischen Grafen der Cirksena-Dynastie im Zuge der gleichzeitigen Erhebung der katholischen Fürstenbergs nobilitiert und ins Fürstenkollegium aufgenommen. 1678 verlieh Leopold dann den gemischt lutherischen und reformierten ostfriesischen Ständen ein Wappen, was ihren Rang erhöhte und ihnen kaiserliche Protektion verschaffte. 1681 wurde der Kurfürst von Brandenburg beauftragt, im reformierten Emden eine kaiserliche Garnison zu errichten. Zehn Jahre später verweigerte Leopold einem Erbvertrag der Cirksenas und Welfen die Anerkennung und 1694 übertrug er die ostfriesische Thronfolge an den brandenburgischen Kurfürsten. Das Ergebnis dieser Vorgänge war ein fein austariertes Gleichgewicht innerer Kräfte und auswärtiger Interessen mit endlosen Möglichkeiten für zukünftige Eingriffe des Kaisers als Richter und oberster Lehnsherr in einem bis dahin randständigen Territorium. Dass Karl VI. nicht fähig war, dieses Potenzial in der Krise der 1720er Jahre zu nutzen, zeigt seine eher eingeschränkte Kompetenz auf bestimmten Feldern der Reichspolitik im Gegensatz zu Leopolds Selbstsicherheit.14
Wie die meisten Adligen benutzte Leopold schließlich auch seine eigene Familie als Herrschaftsinstrument und schmiedete per Verheiratung Allianzen mit dem Hochadel.15 Das letzte Ehebündnis der Habsburger mit einer Fürstendynastie war das des späteren Ferdinands II. mit der Tochter des bayerischen Herzogs im Jahr 1600 gewesen. Damals war Ferdinand Erzherzog von Innerösterreich; niemand ahnte, dass er jemals Kaiser werden könnte. Die Habsburger hatten lange generell jede Verbindung vermieden, aus der dem deutschen Adel ein Anspruch auf den Kaiserthron erwachsen konnte. Leopold selbst tat es seinem Vater nach, indem er erst eine spanische Prinzessin und dann eine Habsburgerin aus Innsbruck heiratete. Seine dritte Ehe, mit Eleonore von Pfalz-Neuburg, Ausgangspunkt einer Allianz mit einer bedeutenden katholischen Dynastie, bezeichnete eine signifikante Wende. Die Pfalz-Neuburg-Höfe in Neuburg an der Donau, Düsseldorf am Niederrhein und nach ihrer pfälzischen Erbfolge 1685 in Heidelberg wurden zu tragenden Säulen der kaiserlichen Politik.16
Ebenso wichtig waren die Verknüpfungen mit den bayerischen Wittelsbachern: Kurfürst Max Emanuel wirkte als treuer kaiserlicher Befehlshaber in Ungarn und war ab 1686 durch die Ehe mit Leopolds ältestem Kind, der Erzherzogin Maria Antonia, sein Schwiegersohn. Dies war nicht nur in Sachen Reichspolitik sinnvoll, sondern für Habsburg die Grundlage für eine eventuelle spätere Übernahme von Bayern.17 Aus geopolitischer Sicht genauso bedeutend war die Heirat von Leopolds Erben Joseph mit Ernst Augusts Nichte Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg. Ihr folgte die Ehe von Leopolds zweitem Sohn Karl mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, jener Linie also, die wegen der Verleihung der Kurwürde an das verwandte Haus Hannover gekränkt war. Die Hochzeit fand 1708 statt, zur gleichen Zeit wie die Aufnahme des Kurfürsten von Hannover ins Kurfürstenkolleg. Egal, was tatsächlich dabei herauskam (Maria Antonia starb 1692 und Max Emanuel schloss sich im Spanischen Erbfolgekrieg Frankreich an) – Heiraten mit fürstlichen Dynastien dienten jedenfalls dem Zweck, die kaiserliche Stellung im Reich zu stärken.
Die Verbindung mit Braunschweig-Lüneburg ist als Beispiel für die Disparität zwischen Motiv und Ergebnis besonders signifikant. Josephs Braut war Katholikin, Karls Braut konvertierte vor der Eheschließung. Beide gehörten jedoch der überwiegend protestantischen Dynastie an, die Leopold als mögliches Gegengewicht zu Schweden und Brandenburg in Norddeutschland ins Auge gefasst hatte.18 Das verhieß einiges an Problemen, weil die Familie historisch gespalten war und die Linien, die seit dem 13. Jahrhundert in diversen Kombinationen die Fürstentümer Wolfenbüttel, Calenberg, Grubenhagen und Lüneburg besessen hatten, in heftigem Widerstreit standen.19 Durch die letzte Umverteilung von Territorium nach dem Aussterben der Linie Wolfenbüttel 1634/35 war Lüneburg in den Besitz aller vier Fürstentümer gelangt; man einigte sich indes bald auf eine weitere Gebietsneuverteilung zwischen dem verminderten Fürstentum Wolfenbüttel auf der einen und Calenberg (Hannover) sowie Lüneburg (Celle) auf der anderen Seite.20
In Calenberg und Lüneburg regierten ab 1641 die vier Söhne von Herzog Georg (1636–1641), sie blieben aber dessen letztem Willen gemäß separat. Zur dominanten Figur entwickelte sich der jüngste Sohn Ernst August, ab 1661 Fürstbischof von Osnabrück und ab 1679 Herzog von Calenberg. Zu Beginn seines Aufstiegs hatte er sich die Hand der eigentlich zur Braut seines älteren Bruders Georg Wilhelm von Celle erwählten Sophie von der Pfalz gesichert, der Enkelin von James I., wodurch die Linie Hannover schließlich Anspruch auf die englische Thronfolge erwarb. Bis in die späten 1690er Jahre war dies kein ernsthaftes Thema; bis dahin bemühte sich Ernst August, seiner Linie Calenberg (Hannover) die drei älteren Braunschweiger Fürstentümer und die Primogenitur zu sichern sowie den Status seiner Länder in einer Region zu stärken, die dominiert war von Brandenburg und seinen Beziehungen zur Niederländischen Republik.21 Ein Kernelement dieser Strategie war strikte Loyalität zur Krone; 1688 führte er persönlich eine beträchtliche Streitmacht zur Verteidigung des Reichs gegen die Franzosen.
Aus seinem Streben nach der Kurwürde machte Ernst August zu dieser Zeit kein Hehl mehr.22 Die in der Goldenen Bulle festgeschriebene Anzahl von sieben Kurfürsten war 1648 ohnehin durchbrochen worden. Die Erbfolge einer katholischen Linie in der Pfalz lieferte dann 1685 gute Argumente für die Schaffung einer weiteren protestantischen Kurwürde zur Wiederherstellung des konfessionellen Gleichgewichts. Brandenburg brachte das Thema 1690 bei der Wahl von Joseph I. zum Römischen König auf die Tagesordnung, zeigte sich aber ebenso wie Sachsen skeptisch. Leopold selbst reagierte anfangs zurückhaltend. Der gewaltsame Griff Georg Wilhelms von Celle nach den Ländereien des 1689 erloschenen Hauses Sachsen-Lauenburg stellte einen schwerwiegenden Bruch des kaiserlichen Rechts dar, das vakante Lehen an die Krone heimfallen oder den Reichshofrat einen Bewerber dafür auswählen zu lassen.23 Ernst August liebäugelte offen mit einem Bündnis mit Frankreich und unternahm Schritte zur Gründung einer dritten Partei gegen den Kaiser. Gleichzeitig versprach er 6.000 Soldaten für die ungarische Front, deutete an, den Katholiken in Hannover Glaubensfreiheit zu gewähren, und wollte für seine Erhebung auf das Amt des Fürstbischofs von Osnabrück verzichten. 1692 einigte man sich und Leopold gab seine Einwilligung.
Die Lösung war in gewisser Weise genial. Leopold gewann einen Partner in Norddeutschland und einen »ewigen« Verbündeten im Reich, der den österreichischen Anspruch auf die spanische Thronfolge zu unterstützen und den Katholiken in seinen eigenen Ländereien Glaubensfreiheit zu gewähren versprach. Andererseits erregte die Erhebung von Ernst August heftige Gegenwehr unter dessen Wolfenbütteler Verwandten und im Reich allgemein. 1700 wollte Anton Ulrich von Wolfenbüttel gar Frankreich und Schweden als Garantiemächte des Westfälischen Friedens anrufen, um die Verleihung der Kurwürde an Hannover zu verhindern. Der Herzog von Württemberg protestierte wütend, die Übertragung des Ehrenamts eines Erzbannerträgers an Hannover beraube seine eigene Dynastie eines Titels, den sie seit unvordenklichen Zeiten trage.24 Es gelang erst 1708, Hannovers Zulassung zum Kurfürstenkolleg zu erreichen (zugleich mit der »Wiederaufnahme« von Böhmen, die die kaiserliche Stellung weiter stärkte), und Wolfenbüttel und andere Fürsten akzeptierten die Würde erst viel später. Dann dauerte es nicht mehr lang, bis die Beziehungen zwischen Wien und Hannover problematisch wurden: Als Kurfürst Georg Ludwig 1714 als George I. den englischen Thron bestieg, entstand eine neue Situation, in der tiefe Interessensgegensätze zutage traten, obwohl beide Seiten bemüht waren, gemeinsame Ziele im Auge zu behalten.
Kern des Problems war, dass der Kurfürst von Hannover zum souveränen Monarchen wurde. Was Leopolds Nachfolger gut zwanzig Jahre nach der Schaffung der neunten Kurwürde mit George I. erleben mussten, erfuhr Leopold mit einigen von Ernst Augusts Zeitgenossen am eigenen Leib. Einerseits war die Enttäuschung der Hoffnungen der Kurfürsten auf monarchischen Status nie ganz verflogen. Andererseits wurde die wachsende Macht der armierten Fürsten immer deutlicher. Wie entscheidend ihr militärischer Beitrag für das Reich und auswärtige Mächte war, von denen sie enorme Subsidien bezogen, wussten sie nur zu gut. Die meisten von ihnen zürnten, weil sie von europäischen Friedensverhandlungen ausgeschlossen blieben oder zumindest nicht auf einer Ebene mit den gekrönten Häuptern verhandeln durften. In Zeiten, da die Republiken Venedig und Niederlande entschiedene Forderungen nach Gleichwertigkeit mit Europas Monarchien erhoben, war es für die mächtigeren deutschen Fürsten nur logisch, ebenso zu handeln. Ende des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Reihe von Versuchen, königlichen Status zu erlangen, befeuert auch durch Leopolds inflationären Umgang mit Titeln, vor allem die Schaffung der hannoverschen Kurwürde und die Ernennung des Großherzogs der Toskana (1691) und des Herzogs von Savoyen (1693) zu »Königlichen Hoheiten«.25
Eheschließungen deutscher Fürstendynastien und ausländischer Königshäuser waren bestenfalls eine unsichere Langzeitstrategie. Aufgrund ihrer niedrigeren Stellung heirateten deutsche Fürsten kaum je in die direkte Erbfolgelinie. Dennoch war ein Pfalzgraf von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg als Karl X. schwedischer König geworden, ebenso wie 1720 ein Landgraf von Hessen-Kassel, und den Ehen der Kinder von Peter dem Großen von Russland mit verschiedenen norddeutschen Dynastien entsprangen Peter III. (von Holstein-Gottorp) und Katharina die Große (von Anhalt-Zerbst und Holstein-Gottorp).26
Für die dringenderen Bestrebungen der 1690er Jahre mussten andere Wege gefunden werden. 1696 zeigten mehrere deutsche Fürsten Interesse an einer Wahl auf den polnischen Thron, so etwa Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (der Brandenburger Kandidat) und der Kurfürst von Bayern, neben den ursprünglichen Kandidaten aus den Häusern Pfalz-Neuburg und Lothringen.27 In Wien einigte man sich schließlich auf Friedrich August von Sachsen, dessen Wahl mit hohen Schmiergeldsummen und dem Übertritt des Kurfürsten zum Katholizismus erkauft wurde. Das Problem der gleichzeitigen Wahl des französischen Kandidaten Fürst Conti löste man, indem der Sachse eilends die Residenz besetzte, ehe Conti auch nur Frankreich verlassen hatte.
Für sein sächsisches Kurfürstentum hatte Friedrich Augusts Konversion keine Konsequenzen; vielmehr würdigte die Kongregation in Dresden die Erhöhung ihres Herrschers durch lautstarkes Absingen von Luthers Hymne Ein’ feste Burg ist unser Gott. Sachsen blieb lutherisch und der Kurfürst behielt sogar den Vorsitz des Corpus Evangelicorum im Reichstag.28
Entgegen katholischen und lutherischen Befürchtungen veränderte sich durch seine Herrschaft als katholischer König August II. von Polen im Reich zunächst kaum etwas – ein weiteres Anzeichen für die Stabilität des gesetzlichen Rahmens von 1648, der es Herrschern ausdrücklich untersagte, die konfessionelle Identität ihrer Territorien zu ändern. Auf lange Sicht jedoch schwächte der Übertritt unweigerlich die traditionelle sächsische Führungsmacht unter den Protestanten und begünstigte die Kurfürsten von Brandenburg, die bis zur Herrschaft des Großen Kurfürsten (1640–1688) für gewöhnlich der sächsischen Linie gefolgt waren.
Um die gleiche Zeit strebten drei weitere Fürsten nach der Königswürde. Die Träume des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz von einem Königreich in den Spanischen Niederlanden, in Armenien (1698–1704) oder am Mittelmeer (Sizilien, Sardinien und die Balearen) waren eher Hirngespinste.29 Brandenburg und Bayern hatten ernster zu nehmende Pläne; im September 1696 schlossen die beiden Kurfürsten ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung ihres Strebens nach einem Königsthron.30 Max Emanuel von Bayern scheiterte in Polen. Karl II. setzte 1698 seinen Sohn Joseph Ferdinand als Thronfolger ein, aber dessen Tod im Jahr darauf durchkreuzte seinen Plan. Die Statthalterschaft der Spanischen Niederlande, die er 1691 erhielt und die ihm in Brüssel wie ein Monarch zu leben gestattete, war kein echter Trost. Dass sich Leopold 1701 weigerte, Max Emanuels Forderung nach einem Anteil am spanischen Erbe (etwa Neapel und Sizilien oder die Spanischen Niederlande), verbunden mit einem Königstitel, zu erfüllen, trieb ihn schließlich in die Arme der Franzosen. Das Versprechen Ludwigs XIV., den neuen Territorien im Reich die Königswürde zu übertragen, führte Bayern im Spanischen Erbfolgekrieg jedoch in die Katastrophe.31
Mehr Erfolg hatte Brandenburg.32 Der Kurfürst regierte bereits seit 1660 souverän im Herzogtum Preußen und seit 1683 in der kleinen brandenburgischen Kolonie Groß Friedrichsburg an der afrikanischen Goldküste.33 Von Beginn seiner Herrschaft 1688 an machte Friedrich III. aus seinem Streben nach einem Königstitel kein Geheimnis. Er war der erste deutsche Fürst, der ein ausgeklügeltes Programm »königlicher« Bauvorhaben in Angriff nahm. Bei seinem Regierungsantritt bremste er unverzüglich die Erweiterungspläne seines Vaters für die Berliner Residenz zugunsten eines völlig neuen Palasts und begann mit den Planungen für die Akademien der Künste (1696) und der Wissenschaften.34
Der Königstitel selbst war schwerer zu erlangen. 1694 hatte Leopold Friedrichs Antrag abgeschmettert. Beim zweiten Anlauf 1700 betonte er, die Erhebung von Monarchen werde Leopolds eigene Stellung verbessern. Schließlich beschloss Friedrich seine Krönung im Alleingang voranzutreiben, achtete jedoch strikt auf legale Korrektheit, was das Reich betraf, indem er sich nicht »König von Preußen«, sondern »König in Preußen« nannte, weil das Herzogtum Preußen ein ehemaliges polnisches Lehen außerhalb der Reichsgrenzen war.35 Als Kurfürst von Brandenburg – den Titel behielten er und seine Nachfolger bis 1806 bei – ersuchte er dennoch um Leopolds rückwirkende Anerkennung, die er als Lohn für seinen Bund mit dem Kaiser 1686 sowie für seine Zustimmung zur neunten Kurwürde (Hannover) und der Wiederaufnahme Böhmens ins Kurfürstenkolleg auch erhielt.
Friedrich der Große schrieb später, sein Großvater habe die Krone lediglich aus persönlicher Eitelkeit und seinem Hang zur protzigen Selbstdarstellung gewollt.Vor dem Hintergrund der Brandenburger Politik ab 1648 und ähnlicher Bestrebungen anderer deutscher Fürsten jener Zeit war die Entwicklung indes nur logisch, ebenso wie die von vielen anderen, auch den Habsburgern, übernommenen Investitionen in neue »programmatische« Bauvorhaben, die Status und Aspirationen des Herrschers so wirkungsvoll zeigten wie irgendein Brief, Kommuniqué oder Pamphlet.
Nicht, dass Friedrich III. von Brandenburg (König Friedrich I. in Preußen) sich vom Reich oder aus der Lehnherrschaft des Kaisers lösen wollte. Im Reich blieb er ein treuer Vasall des Kaisers, ersuchte sogar um dessen Anerkennung für seine Unternehmungen außerhalb. Die kaiserliche Legitimation des Königstitels war für Brandenburg absolut entscheidend. Ebenso wichtig war für Wien, dass der Kaiser weiterhin als oberster Lehnsherr anerkannt wurde. Zugleich veränderten der erhöhte Status des Kurfürsten und die neu erworbenen Königstitel anderer Fürsten auf subtile Weise das Verhältnis zwischen dem Kaiser und seinen Vasallen. Der größte Störenfried im Reich um 1700 war nicht der Kurfürst von Brandenburg, sondern der von Bayern. Dessen auf der Zusage eines im Reich zu schaffenden Königreichs beruhendes Abkommen mit Frankreich führte zu einem Verfahren wegen Hochverrats; mehrere Jahrzehnte später erhob sein Nachfolger erfolgreich, wenn auch nur kurzfristig, Anspruch auf den Kaiserthron.36 Brandenburg hingegen blieb zumindest vorläufig loyal.
Alles in allem stärkte die Titelinflation während der Herrschaft Leopolds I. dessen Macht über das Reich und war sicherlich ein wesentliches Element seiner Politik als oberster Lehnsherr. Der Aufstieg einiger Fürsten zu Königen machte es seinen Nachfolgern indes schwer, die Dinge auf ähnliche Weise zu regeln. Selbst die Solidarität der Kurfürsten untereinander litt unter den Versuchen der königlich Gekrönten, ihren neuen Status im Reich geltend zu machen.37 Leopolds Nachfolger fanden das Reich weniger lenkbar als er auf dem Zenit seiner Macht, und keiner von ihnen erreichte je die Autorität, die er einer siebenundvierzigjährigen, von bedeutenden militärischen Erfolgen im Osten und der Verteidigung des Reichs im Westen geprägten Herrschaft verdankte. Ihre Ansprüche waren nicht geringer, aber der Hintergrund, vor dem sie sie durchzusetzen versuchten, weniger günstig.