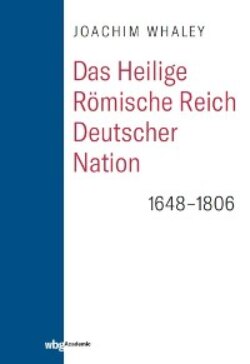Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 41
18. Zurück zur Religionspolitik?
ОглавлениеDie Bemühungen Karls VI., seiner Funktion als oberster juristischer Instanz gerecht zu werden, fanden den Beifall der mittleren und weniger mächtigen Reichsstände, die mehr oder weniger sicher sein konnten, dass der Kaiser ihre Unabhängigkeit garantierte. Die mächtigeren Fürsten indes empfanden ihn als lästig und bedrohlich.
Schon 1716 glaubte Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg-Preußen zu wissen, worauf der Kaiser aus war: »Er will uns alle unterdrücken und sich souverän machen, das will er, und Schweden muss wieder gerufen werden, dem Kaiser das Gebiss ins Maul zu legen.«1 Friedrich Wilhelms Geringschätzung des kaiserlichen Rechts brachte ihn in dauernden Konflikt mit den kaiserlichen Autoritäten. Am Reichshofrat waren bis zu vierzig Verfahren gleichzeitig gegen ihn anhängig und seine Einstellung zu dessen Urteilen machte die Sache nicht besser: »… ich mache es wie Wallenstein,« schreibt er einmal, »wenn der eine ordre von Kaiser kriege, so küßte er sie und steckte versiegelt aus dem Fenster.«2
Hannovers Haltung war kaum positiver; der englische Botschafter in Wien berichtete spöttisch, Karl wolle »Caesarum Augustum und die grandeur der ersten römischen kaiser imitieren«.3 Es fiel Karl leicht, Friedrich Wilhelm I. 1720 vorzuwerfen, »im Reich statum in statu zu formieren, Ihren [des Kaisers] Mitständen Gesetze vorzuschreiben, endlich auch dem Kaiser selbst zu wiederstehen und dessen Amt außer Acht und Gehorsam setzen zu können«.4 Indes war es zur Zeit von Karls Regierungsantritt offenkundig undenkbar, mit dem Kurfürsten von Brandenburg oder Hannover ebenso umzugehen wie mit dem Abt von Ellwangen oder dem Grafen von Nassau-Siegen. Die deutschen Fürsten, die außerhalb des Reichs Königswürden bekleideten, ließen sich schlichtweg nicht länger wie pflichtvergessene Vasallen des Kaisers behandeln und ihr Vorbild ließ auch bei anderen Widerstand keimen. In den 1720er Jahren forderten Württemberg und Hessen-Kassel für ihre weitere Unterstützung der Krone die Verleihung der Kurwürde.5
Nirgendwo traten die so entstehenden Spannungen deutlicher zutage als in den religiösen Kontroversen, die das Reich in den frühen 1720er Jahren an den Rand eines Krieges brachten. Den Anlass der Krise lieferte der katholische Kurfürst der Pfalz, Karl Philipp (1716–1742). Im April 1719 belegte er den calvinistischen Heidelberger Katechismus von 1563 mit dem Kirchenbann, weil dieser die katholische Messe als »vermaledeyte Abgötterey« verunglimpfte. Im September ordnete er den Abriss der Mauer an, die seit 1706 die Heiliggeistkirche in Heidelberg zur gemeinsamen Benutzung durch Calvinisten (im Kirchenschiff) und Katholiken (im Chor) teilte, und verwies die Calvinisten aus dem Gebäude.
Viele europäische Protestanten empfanden im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert ein neues Aufleben der konfessionellen Spannungen und sahen den Protestantismus in Gefahr.6 Die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich 1685, die brutale Niederschlagung des Kamisardenaufstands 1702 bis 1705, katholische Pogrome in den habsburgischen Ländern und die ständige Bedrohung durch die Jakobiten in Großbritannien schürten Unsicherheit und Furcht vor einem katholischjesuitischen Umsturz des Status quo. Im Reich selbst erlangte eine Reihe anhaltender Streitereien über die Auslegung der Bedingungen des Westfälischen Friedens im Hinblick auf bestimmte Städte und Bezirke nach 1697 breitere Bedeutung. Das hatte vier miteinander verknüpfte Gründe.
Erstens konvertierte der sächsische Kurfürst 1697 zum Katholizismus. Das hatte zunächst kaum Folgen; laut geltendem Reichsrecht blieb sein Territorium lutherisch, sein Amt als Leiter des Corpus Evangelicorum ging einfach auf die protestantische jüngere Weißenfels-Linie über und die Geschäfte führte der sächsische Staatsrat.7 Die Konversion des Kurfürsten und seine Übernahme des polnischen Throns bedrohte jedoch seine regionalen Nachbarn Braunschweig und Brandenburg und ließ sie ebenfalls nach einer Statuserhöhung streben. Vor allem Brandenburg focht die sächsische Führung des Corpus Evangelicorum an und übernahm das Vizedirektorium. Dabei ging es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Art der Führung. Sachsen hatte die politischen Möglichkeiten seiner Position nie ausgeschöpft, sich aber stets loyalistisch verhalten, während die Kurfürsten ihren Einfluss nutzten, um religiöse Spannungen zu entschärfen und Agitation im Keim zu ersticken.
Brandenburg war nach 1648 eine der treibenden Kräfte, nach 1700 schloss sich Hannover an. Damit ging die Politik Leopolds I., Hannover als regionale Macht gegen Brandenburg aufzubauen, nach hinten los. Georg I. blieb zwar mit Wien verbündet, bildete jedoch gleichzeitig mit Brandenburg eine gemeinsame Speerspitze der deutschen Protestanten. Aus Sorge, durch einen neuen Aufstand der Jakobiten des britischen Throns enthoben zu werden, wandte er sich noch entschiedener als sein Berliner Kollege gegen die jesuitische Verschwörung, die angeblich plante, erst das Reich und dann das ganze protestantische Europa zu unterwandern. Französische Diplomaten sprachen von zwei Parteien: den von Hannover und Brandenburg angeführten zélés (Zeloten) und den politiques, die loyal zum sächsischen Direktorium standen.8
Die Bedingungen des Friedens von Rijswijk gossen neues Öl ins Feuer der Streitigkeiten in der Pfalz und gaben ihnen weiterreichende politisch-konstitutionelle Bedeutung. Über den konfessionellen Status quo in der Pfalz diskutierte man bereits seit der Wiedereinsetzung eines calvinistischen Kurfürsten in einem Gebiet, das durch die bayerische Besetzung nach 1623 umfassend rekatholisiert worden war. Als die katholische Neuburg-Linie die Kurwürde 1685 erbte, gab es bald Klagen von Protestanten über Benachteiligungen. Der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. sah darin die Chance, einen Herrscher zu schwächen, mit dem er immer noch wegen der Folgen der gemeinsamen Ererbung und widerwilligen Teilung des Herzogtums Jülich-Kleve 1614 im Streit lag.9 Unter französischer Besatzung gewannen die pfälzischen Katholiken 1688 bis 1697 weiter an Boden und in Artikel IV des Vertrags von Rijswijk setzte Frankreich die formelle Anerkennung aller neuen Rechte der Katholiken in rechtsrheinischen Territorien durch, die nun zurück ans Reich gingen. Die protestantischen Fürsten protestierten energisch gegen diesen vermeintlich klaren Bruch des Westfälischen Friedens.
Die »Rijswijker Klausel« wurde zur Kampfparole der Protestanten. Sie gingen davon aus, dass sie ebenso wie der gesamte Vertrag mit dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekriegs nichtig war, und behaupteten später, sie hätten den Kaiser im Krieg nur aufgrund dieser Annahme unterstützt. Erzürnt mussten sie feststellen, dass der Kaiser ihre Aufhebung im Frieden von Baden 1714 nicht durchsetzen konnte. Dass der Heilige Stuhl, der den Westfälischen Frieden nach wie vor nicht anerkannte, bekanntermaßen für die Beibehaltung der Klausel gestritten hatte und Clemens XI. alle Bemühungen, den Katholizismus zu fördern, entschlossen unterstützte, verschlimmerte die Sache.10 Was eine Annullierung der Klausel bewirkt hätte, ist nicht gänzlich klar. 1714 aber stand sie symbolisch für eine ganze Reihe regionaler und nationaler Streitpunkte.
Der dritte Faktor entsprang regionalen Entwicklungen. Wieder an der Macht, hielt sich Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz (1690–1716) nicht nur an die Rijswijker Klausel, sondern ging noch darüber hinaus und setzte katholische Glaubensrechte durch, wo immer es ging. Im Oktober 1698 dekretierte er, alle Kirchen auf seinem Gebiet sollten von den drei Konfessionen gemeinsam genutzt werden, sofern sie nicht laut dem Abkommen von Rijswijk Katholiken vorbehalten waren. Der Kurfürst von Brandenburg, der bereits 1694 den pfälzischen Calvinisten seinen Schutz offeriert hatte, versuchte wiederum zu vermitteln und drohte nach der erneuten Abfuhr mit Vergeltung an den Katholiken seiner eigenen Territorien Magdeburg, Minden und Halberstadt.11 Diese wiederum appellierten an den pfälzischen Kurfürsten, sich mit Brandenburg zu einigen, und so wurde im November 1705 der Vertrag von Düsseldorf geschlossen, der das Simultaneum abschaffte, Religionsfreiheit für alle garantierte und die Verteilung der Kirchensteuer zwischen Calvinisten (fünf Siebtel) und Katholiken (zwei Siebtel) festlegte; die Lutheraner gingen leer aus. In den folgenden Jahren kam es zu erbitterten Kontroversen zwischen Lutheranern und Calvinisten, während der Kurfürst sein Versprechen von 1705, die calvinistische Universität Heidelberg unangetastet zu lassen, brach und systematisch jesuitische Professoren ernannte.12
Sein Beispiel ermutigte andere katholische Herrscher der Region. So erbte etwa der Erzbischof von Mainz, nachdem die örtliche Ritterdynastie 1704 ausgestorben war, die Stadt Kronberg, die Philipp von Hessen 1526 nach der Vertreibung von Hartmut XII. von Cronberg im Ritterkrieg reformiert hatte. 1541 ging die Stadt zurück an die (katholische) Familie, unter der Bedingung, dass sie protestantisch blieb. 1626 wurde der Katholizismus wiedereingeführt, da dies jedoch nach dem Normaljahr 1624 geschah, ordnete die Reichsdeputation die Rückkehr zum Protestantismus und die Beschränkung katholischer Gottesdienste auf die Burgkapelle an. Als der Erzbischof von Mainz sein Erbe antrat, begann er sofort, den Katholizismus zu fördern.13
Nach dem Frieden von Baden verstärkte er seine Bemühungen und war insbesondere bestrebt, die Rijswijker Klausel in seinen Ländern und in den Fürstbistümern Worms und Speyer umzusetzen.14 Die katholischen Herrscher behaupteten nun, Artikel 3 des Friedens von Baden sehe vor, sämtliche Kirchen an Orten, wo während der französischen Besatzung katholische Gottesdienste abgehalten wurden, allen drei Konfessionen zu öffnen. Praktisch bedeutete das die Einführung eines Simultaneums, das Katholiken an vielen Orten zugutekam, die dem Westfälischen Frieden gemäß bislang exklusiv calvinistisch oder lutherisch gewesen waren.15
In der Häufung solcher Fälle, oft mit langwierigem juristischem Nachspiel, sahen viele Protestanten ein wachsendes und ernstes politisches und konstitutionelles Problem, was sich zum vierten Faktor für die Krise nach 1700 entwickelte. Die gesamte Ausrichtung der deutschen Politik erschien zunehmend ominös. Das imperiale Wiederaufleben im Allgemeinen, der wachsende Einfluss des Reichshofrats im Besonderen und die offenbar steigende Anzahl von Fürsten, die zum Katholizismus konvertierten, lieferten Indizien für eine massive, tiefgreifende katholische Gegenoffensive.16 Der Protestantismus, so schien es, war im ganzen Reich bedroht und protestantische Herrscher setzten alle verfügbaren Mittel ein, um sich zu wehren. Immer häufiger legten sie beim Reichstag Beschwerde gegen Entscheidungen des Reichshofrats ein.17 In praktisch jeder Art von Reichsinstitution, von den Kreisen aufwärts, bestanden sie zunehmend vehement auf konfessioneller Parität. Diskussionen auf regionaler Ebene, die mit Religion nichts zu tun hatten, erlangten plötzlich konfessionelle Bedeutung.18 Das Corpus Evangelicorum im Reichstag verstärkte seine Aktivitäten und seine stellvertretenden Leiter Hannover und Brandenburg setzten sich über das moderate sächsische Direktorium hinweg. Eine Liste der religiös begründeten Klagen (Gravamina), die an die Reformationszeit erinnerte, wurde zusammengestellt und veröffentlicht. Die erste gedruckte Sammlung mit 432 Fällen erschien 1719 in Regensburg.19
Wir schlecht das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken war, zeigte sich daran, dass sie sich nicht einmal auf die Vorgaben für eine gemischte Kommission einigen konnten, die 1699 zur Untersuchung der Klagen wegen der Rijswijker Klausel vorgeschlagen wurde. Nach sechs Jahren Gezerre zogen sich die Protestanten 1705 aus den Verhandlungen zurück. Immer deutlicher zeigte sich, dass beide Seiten sehr unterschiedliche Ansichten hatten, was ein religiöses Problem war. Die Protestanten meinten, so gut wie jedes Thema könne als konfessionell betrachtet werden, wenn es Individuen betraf, die protestantisch oder katholisch waren. Das wiederum hieß, dass sie zu jeder diskutierten Frage die Anwendung des konstitutionellen Prinzips der itio in partes fordern konnten, jener Klausel im Westfälischen Frieden (IPO Art V, § 52), die Mehrheitsentscheidungen über religiöse Belange untersagte und jeder Partei zusicherte, getrennt beraten zu können, bevor eine einvernehmliche Lösung gesucht wurde (amicabilis compositio).
Die itio in partes bedeutete natürlich auch, dass eine Entscheidung ausbleiben konnte, was im Großen und Ganzen die protestantische Einstellung um 1700 war. Angedroht wurde die Itionsbefugnis oft, zur Anwendung kam sie erstmals 1712 beim Ersuchen des Abts von St. Gallen um Reichshilfe bei der Wiederbeschaffung von Land, das bei einem Aufstand in Toggenburg verloren gegangen war, den die Kantone Bern und Zürich unterstützt hatten. Dass geholfen werden sollte, stellte niemand infrage, aber die Protestanten bestanden darauf, dass jeder entsandten Kommission ein katholischer und ein protestantischer Fürst angehören mussten. Fünf Jahre später beantragte die Reichsstadt Köln, ihre Abgaben an das Reich zu reduzieren, weil sie sie nicht mehr bezahlen konnte. Die Katholiken stimmten zu, aber die Protestanten lehnten mit der Begründung ab, der katholische Stadtrat diskriminiere die calvinistischen Kölner Kaufleute.20
In der Ausweitung der Problembereiche, bei denen konfessionelle Solidarität gefragt war, verhielten sich die Protestanten eher wie eine politische Partei als wie die lockere religiöse Verbindung, die das Corpus-System vorsah. Die treibenden Kräfte hinter der Radikalisierung der protestantischen Taktik waren in der Tat genau die alten Fürstenhäuser, die in den 1660er und 1670er Jahren den Kern der Opposition im Reich gebildet hatten. Insofern war die neue konfessionelle Opposition, die sich nach 1700 herausbildete, nur eine Neuauflage der antikaiserlichen Strömungen, die über einen Großteil des vergangenen Jahrhunderts die deutsche Freiheit verteidigt hatten. Nur waren sie nun unversöhnlicher als je zuvor seit dem Dreißigjährigen Krieg. Zudem brannten sie auf einen Kampf gegen die wiedererstarkte Habsburger-Monarchie.
1717 spitzte sich die Lage zu. Der Disput über die Kölner Abgaben geriet in die Sackgasse, als Karl VI. das Verhalten des protestantischen Corpus für verfassungswidrig erklärte. Nachdem die Restitution des bayerischen Kurfürsten wirksam wurde, verstrickten sich die Kurfürsten in eine Kontroverse über ihre Ehrenämter.21 Besonders bitter war, dass sich dabei die Pfalz und Hannover wegen des Titels des Erzschatzmeisters in die Haare gerieten. Die Blamage des Verlusts steigerte den Hass Georgs I. auf den pfälzischen Kurfürsten; der Disput legte den Reichstag für zwei Jahre lahm. Der Reichshofrat verstärkte die Krise, indem er den protestantischen Landgrafen von Hessen-Kassel anwies, die Festung Rheinfels an den katholischen Landgrafen von Hessen-Rheinfels abzutreten, was das Corpus Evangelicorum als neuen Beweis seiner Parteilichkeit deutete. Als 1712 bekannt wurde, dass der Kronprinz von Sachsen heimlich zum Katholizismus konvertiert war und Maria Josefa, die ältere Tochter des verstorbenen Joseph I., heiraten wollte, war das Corpus noch irritierter, da viele seiner Mitglieder über die wahren Absichten des sächsischen Direktoriums zu spekulieren begannen. Im Oktober 1717 begingen Deutschlands Protestanten den zweihundertsten Jahrestag der Reformation mit trotzigen Erklärungen militanter Solidarität gegen die dunklen Mächte des Katholizismus.22
Das Vorgehen des pfälzischen Kurfürsten gegen den Heidelberger Katechismus und die calvinistische Gemeinde der Heiliggeistkirche im April 1719 brachte das Fass zum Überlaufen.23 Nur Wochen später versetzte die Zerstörung der katholischen kaiserlichen Residenzkapelle in Hamburg alle Regierungen in höchste Alarmbereitschaft.24
Hannover und Brandenburg forderten eine sofortige Reaktion des Corpus Evangelicorum, sandten eine Liste mit Klagen nach Wien und stimmten überein, dass es höchste Zeit war, das sächsische Direktorium abzusetzen und selbst abwechselnd die Leitung zu übernehmen. Derweil setzten sie gemeinsam mit Hessen-Kassel ihre Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen in die Tat um und verstießen damit klar gegen den Westfälischen Frieden, der den Griff zur Gewalt nur zuließ, wenn alle friedlichen Möglichkeiten erschöpft waren. Georg I. ließ die katholische Kirche in Celle schließen, Hessen-Kassel sämtliche katholischen Kirchen in der Grafschaft Katzenelnbogen.25 Friedrich Wilhelm von Preußen verweigerte hierfür eine Abstellung von Truppen, ging dann jedoch selbst noch weiter: Er ließ die Mönche des Klosters Hamersleben im Fürstbistum Halberstadt und dreier weiterer Klöster von Grenadieren vertreiben und schloss die katholische Kathedrale in Minden. Eine schriftliche Maßregelung durch den Kaiser beantwortete Friedrich Wilhelm derart unverblümt, dass Prinz Eugen anmerkte: »Wenn ich Kaiser wäre, und der König von Preußen hätte nun einen solchen Brief geschrieben, würde ich ihm sicher den Krieg erklären, wenn er mir keine Genugtuung gäbe.«26 Am 23. April 1723 informierte Eugen die Geheimkonferenz in Wien, man müsse entweder den Protestanten gestatten, die Gesetze nach Gutdünken zu diktieren, oder ihnen mit Waffengewalt entgegentreten.27
Die Suppe wurde nicht so heiß gegessen wie gekocht. Der pfälzische Kurfürst gab die Kirche den Calvinisten zurück und verlegte seine Hauptstadt nach Mannheim. Hannover und Brandenburg-Preußen widerriefen ihre antikatholischen Maßnahmen. Dennoch blieb das Verhältnis der Konfessionen noch einige Jahre lang gespannt.
1724 sorgte die Hinrichtung von zehn Lutheranern nach antijesuitischen Unruhen in der polnischen Stadt Thorn für hitzige Diskussionen in den deutschen protestantischen Ständen.28 Die Allianz zwischen Wien und Madrid 1725 weckte neue Befürchtungen einer katholischen Verschwörung.29 1727 bestand das Corpus Evangelicorum im Streit um die Eigentumsrechte an Zwingenberg zwischen dem pfälzischen Kurfürsten und den Angehörigen des letzten Besitzers auf einer weiteren Itionsentscheidung.30 Der Disput hatte mit Religion wirklich nichts zu tun: Der Besitz war 1634 annektiert worden, wogegen die mutmaßlichen Erben bereits seit 1651 prozessierten. 1725 entschied der Reichshofrat zu ihren Gunsten, der Kurfürst legte jedoch beim Reichstag Berufung ein. Die Katholiken wollten mit der Sache nichts zu tun haben, die Protestanten verfolgten sie wegen ihres Hasses auf den pfälzischen Herrscher. Nach einem Jahr Stillstand löste sich die Krise in Luft auf; 1728 ging Zwingenberg zurück an seine rechtmäßigen Eigentümer, die es 1746 an die Pfalz verkauften.
Zum befürchteten Krieg kam es nicht, die Kluft war zu keiner Zeit unüberbrückbar. Im August 1716 stimmte der Reichstag geschlossen für die Finanzierung des Krieges gegen die Türken. Die Verhandlungen über den Unterhalt des Reichskammergerichts und der kaiserlichen Festungen am Rhein verliefen während der gesamten Phase von 1717 bis 1724 recht einvernehmlich.31 Der Versuch der Gründung einer konfessionellen Partei blieb erfolglos. Hannover und Brandenburg sorgten mit ihrem Extremismus für Zwietracht und Unbehagen im Corpus Evangelicorum. Ende 1721 drängten viele kleinere protestantische Herrscher auf Frieden mit dem Kaiser, einen bewaffneten Konflikt wollten sie keinesfalls riskieren.
Das wollten auch die Hauptbeteiligten nicht. Frankreich, das für die verhasste Klausel von Rijswijk verantwortlich war, bestand nicht mehr auf deren Anwendung, wenn es dadurch zu Konfessionsstreitigkeiten käme. 1723 wurde der französische Botschafter in Regensburg angewiesen, den Westfälischen Frieden zu unterstützen, um den habsburgischen Einfluss zu begrenzen.32
Mit Walpoles Amtsantritt in London 1721 änderte sich Hannovers Politik.33 Georg I. blieb militant, ebenso wie sein Vertreter in Regensburg bis 1726, Rudolf Johann von Wrisberg, der in den frühen 1720er Jahren zur Hassfigur in Wien wurde.34 Von 1726 an setzte sich in London ein versöhnlicherer Tonfall durch.
Dass Hannover und Brandenburg 1723 den Charlottenburger Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung schlossen und 1725 der Allianz von Herrenhausen beitraten, war ein Beleg ihrer Solidarität aufgrund gemeinsamer politischer und konfessioneller Interessen. Allerdings versuchte Walpole zunehmend Abstand zwischen London und Hannover zu schaffen, was dessen Position im Reich neutralisierte oder vielmehr der traditionellen prokaiserlichen Politik, die ihm überhaupt erst die Kurwürde verschafft hatte, den Rücken zukehren ließ. Brandenburg war ab 1726 wieder mit Wien verbündet, wenn auch bis 1728 geheim. Und bei allen Unzulänglichkeiten der kaiserlichen Politik war Karl VI. doch sehr bewusst, dass konfessioneller Friede eine entscheidende Grundlage seiner Autorität im Reich war. Seine Funktion als oberster Richter und Vermittler bei Konflikten setzte voraus, dass Protestanten und Katholiken grundsätzlich gewillt waren, eine übergeordnete Macht zu akzeptieren. Außerdem brauchte er die Zustimmung des Reichs zur Pragmatischen Sanktion.