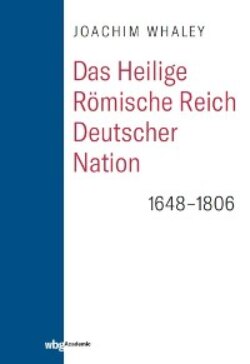Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 33
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
ОглавлениеJosephs Regierungszeit war so beherrscht vom Spanischen Erbfolgekrieg, dass seine Verwaltung des Reichs oft lediglich als eine weitere Facette des Kriegs gesehen wird. Sicherlich war der langwierige Kampf gegen die »teuflischen Franzosen«, wie er sie gern nannte, seine Hauptbeschäftigung.1 Aber wie Joseph in Italien eine sehr eigene Politik entwickelte, so auch im Deutschen Reich. Seine Ansätze waren in Deutschland vielleicht weniger deutlich als in Italien. Die »österreichischen« Interessen mögen die »imperialen« Belange in Italien überwogen haben, aber der politische Rahmen in Deutschland verlangte ein nuanciertes Herangehen. Hier waren die Hindernisse für eine uneingeschränkte kaiserliche Machtausübung viel stärker, weil im Recht und den Bräuchen des Staates selbst verankert.
Die Spannung zwischen »österreichischen« und »kaiserlichen« Interessen und Rollen im Reich war indes nicht neu; sie bildete seit der Herrschaft von Maximilian den Kern vieler politischer Probleme. Mit dem Wachsen der habsburgischen Ländereien und der zunehmenden Festigkeit ihrer Herrschaft wurde sie jedoch prekärer. Viele im Reich wurden sich langsam des krassen Ungleichgewichts zwischen Größe und Macht der Habsburger Territorien und der Mehrheit der Länder im Reich bewusst. Verstärkt wurden diese Ängste durch die Erneuerung und Erweiterung der kaiserlichen Macht unter Ferdinand III. und Leopold I.
Es ist bezeichnend, dass viele Zeitgenossen glaubten, die kaiserliche Macht habe unter Joseph I. eine neue Qualität entwickelt. Rupert von Bodman, der Fürstabt von Kempten, der Leopold dreißig Jahre lang treu gefolgt war und dann in Josephs Dienste trat, hielt dessen Herrschaft für einen Höhepunkt der Reichsgeschichte.2 Andere äußerten sich kritischer und argwöhnischer bezüglich der kraftvollen Ausübung royaler Vorrechte. Aber auch ihre Reaktion bezeugt den neuen Elan, mit dem Joseph das Amt des Kaisers versah.
Joseph, Reichvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn und Reichserzkanzler Lothar Franz von Schönborn hatten bei aller Unterschiedlichkeit viel gemeinsam. Der Reichsvizekanzler beklagte seinen Ausschluss von allen Entscheidungen, bei denen es nicht allein um Deutschland ging, aber er stand dem Kaiser bei dessen Bemühungen bei, das Reich mit neuem Leben zu erfüllen. Die Probleme zwischen Joseph und Lothar Franz entsprangen dessen Einsatz für die Länder, insbesondere jene, die der Nördlinger Assoziation angehörten. Aber beide waren sich einig, dass das Reich funktionieren und fähig sein sollte, sich gegen Angriffe zu verteidigen.
Joseph profitierte von den Erfolgen Ferdinands III. und Leopolds I., wollte seine Macht jedoch weniger zurückhaltend und diskret ausüben als diese. Darin schlug sich auch die Einstellung einer neuen Generation nieder. Anders als Ferdinand und Leopold litt Joseph nicht unter dem Trauma des Dreißigjährigen Krieges. Ihn prägte die Erinnerung an die Flucht der Dynastie aus Wien 1683 und die französische Bedrohung.3 Leopold hatte in den 1690er Jahren die Türken besiegt. Für Joseph und viele Mitglieder des »jungen Hofs« bot der spanische Krieg die Gelegenheit, mit den Franzosen ebenso endgültig fertig zu werden. Das, glaubten sie, sei für den Kaiser entscheidend, um echte Macht ausüben zu können. Wie Josephs Lehrer Hanns Jacob Wagner von Wagenfels 1691 in seinem Ehren-Ruff Teutschlands, der Teutschen und ihres Reichs gepredigt hatte, beruhte die kaiserliche Erhabenheit auf Macht und Territorium; sie war nichts, wenn ihr Träger sie nicht durchsetzen konnte.4 Wagenfels’ Appell richtete sich an Deutschland und die Deutschen und verdeutlichte Joseph seine Vorrechte im Deutschen Reich wie in anderen Teilen seines weitläufigen Erbes.
Die Macht im Reich auszuüben war nie einfach. Die Anerkennung des Rechts der Fürsten von 1648, Verträge mit fremden Mächten zu schließen, der Auftritt »armierter« Fürsten, die dieses Recht für komplizierte Subsidienabkommen nutzten, und das Streben einiger von ihnen nach Königstiteln und Teilhabe an internationalen Friedensverhandlungen in eigenem Recht (und zum eigenen Vorteil) machten die alten Probleme noch komplexer. Dennoch gelangen Joseph einige entscheidende Schritte, die sowohl die Bewunderung als auch das Misstrauen, das er erregte, rechtfertigten.
Auch ohne den Krieg waren die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Politik nicht günstig.Während des ersten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts spaltete ein bitterer Streit zwischen Protestanten und Katholiken über die religiösen Implikationen des Vertrags von Rijkswijk den Reichstag.5 Als der Vertrag ratifiziert wurde, hatten der Kaiser und die katholischen Fürsten ihr Wort gegeben, keine religiösen Bedingungen zu applizieren; dennoch gewährte der pfälzische Kurfürst katholischen Gemeinden Glaubensfreiheit – ein klarer Bruch des Westfälischen Friedens.
Johann Wilhelms Vorgehen stellte einen eklatanten Versuch der Rekatholisierung der Pfalz dar und besaß nach 1701 keine gesetzliche Basis mehr, weil der Spanische Erbfolgekrieg den Vertrag von Rijswijk praktisch annulliert hatte. Lautstarke Beschwerden der protestantischen Länder bewirkten die Einsetzung einer wenig wirkungsvollen Enquetekommission, bis der Streit schließlich durch Vermittlung des brandenburgischen Kurfürsten im November 1705 beigelegt wurde. Die Rechte der konfessionellen Gemeinden in der Pfalz und ihre Ansprüche auf Kirchenbesitz waren damit zumindest vorübergehend geklärt. Das Thema war jedoch nicht vom Tisch. Die protestantischen Länder stritten noch während der Verhandlungen um die Beendigung des spanischen Kriegs für die Rücknahme des Vertrags von Rijswijk, als diese längst nicht mehr zu erwarten war.
Das Problem war von einiger Wichtigkeit, zumindest für die Gemeinden, deren Glaubensrechte und Kirchenbesitz auf dem Spiel standen. Vor dem Hintergrund der Reichstagspolitik hatte es auch symbolische Bedeutung. Weder Leopold I. noch Joseph I. wagten es, Kurfürst Johann Wilhelm (ihren Schwager beziehungsweise Onkel) in die Schranken zu weisen. Nach der Einigung von 1705 verweigerte Joseph auf Anfrage eine Garantie der Rechte der pfälzischen reformierten Gemeinden und verpasste damit eine Gelegenheit, seine Neutralität in der Reichspolitik zu beweisen.6 Joseph war bekanntermaßen weniger fromm und dogmatisch als sein Vater; seine Lehrer waren allesamt Gegner der Jesuiten gewesen, ein weiteres Merkmal des »jungen Hofs«. Hier indes schien er ebenso dem Katholizismus zugeneigt wie Leopold.
Gleichzeitig ging es mehr als nur um Religion. Die erfolgreiche Vermittlung des brandenburgischen Kurfürsten war ein kleiner Geniestreich. Er übernahm die traditionelle Rolle des sächsischen Kurfürsten als Beschützer der deutschen Protestanten und die des Kaisers als Mittler zwischen den offiziell anerkannten Konfessionen des Reichs – ein frühes Beispiel für die brandenburgisch-preußische Mimikry der kaiserlichen Rolle, auf die sich Friedrich der Große später spezialisierte. Josephs Haltung beruhte zudem auf handfesten machtpolitischen Berechnungen. Der pfälzische Kurfürst war ein naher Verwandter sowie katholisch und zudem einer seiner verlässlichsten deutschen Verbündeten, ein entscheidendes Mitglied der kaiserlichen Klientel im Reich.
Von katholischer Solidarität ließ Joseph im Umgang mit den Wittelsbachern nichts erkennen. Durch ihre Parteinahme für Frankreich nach der Kriegserklärung des Reichstags hatten Joseph Clemens von Köln und Max Emanuel von Bayern Reichsrecht gebrochen. Im November 1702 beriet deswegen der Reichshofrat und empfahl, die Kurfürsten zu ersuchen, ihrer Ächtung zuzustimmen, womit man allerdings warten wollte, bis Max Emanuel besiegt war; dann gab es einen weiteren Aufschub, weil Brandenburg sich zu handeln weigerte, ehe der Religionsstreit in der Pfalz beigelegt war. Im November 1705 stimmten die Kurfürsten (ohne Köln und Bayern) zu und der Reichstag wurde unterrichtet, dass der Kaiser die Rebellen geächtet hatte. Der Kontrast zwischen dem, was in Deutschland folgte, und dem Ergebnis ähnlicher Vorgehensweisen gegen den Herzog von Mantua und andere in Italien ist aufschlussreich.
Der Fall Köln wurde dadurch verkompliziert, dass der Kaiser lediglich Joseph Clemens’ Ländereien konfiszieren konnte. Den Bischofstitel konnte nur der Papst aberkennen, wozu es nie kam. Die Territorien des Geächteten waren verschiedentlich von diversen Streitkräften besetzt, ihre Verwaltung blieb jedoch in den Händen des Domkapitels. Bayern war für die Habsburger von wesentlich direkterer Bedeutung.Während Leopold relativ milde Kapitulationsbedingungen gestellt hatte, griff Joseph unverzüglich hart durch, was bald zu einem großen Bauernaufstand führte. Während der Phase österreichischer Verwaltung wurden dem Kurfürstentum etwa 22 Millionen Gulden abgepresst.7 Eine dauernde österreichische Besetzung Bayerns stand als Drohung im Raum.8
Diskutiert wurden aber auch andere Lösungen des bayerischen Problems. Man fasste ins Auge, es den österreichischen Erblanden einzuverleiben; derartige Überlegungen bildeten die Grundlage späterer Pläne Josephs II.9 Aber die Ratgeber Josephs I. befürchteten offenbar, ein solches Vorgehen werde auf starken Widerstand stoßen. Es war klar, dass der bayerische Kurfürst irgendwann wiedereingesetzt werden musste. Wenn Österreich Bayern übernommen hätte, hätte man den Kaiser für den Verlust entschädigen müssen.
Die Idee eines wittelsbachischen Königreichs in Neapel und Sizilien war zweifellos abstrus. Ludwig XIV. half unwissentlich, ihr den Boden zu bereiten, indem er Max Emanuel im Januar 1712 zum Souverän der südlichen Niederlande machte, aber dieses »Königreich« war lediglich eine Mogelpackung aus Luxemburg und Namur, von Max Emanuel gemütlich von einer Residenz bei Versailles aus regiert.10 Jedenfalls hatten Ludwig und Max Emanuel auf mehr als die Restitution Bayerns gehofft, aber das war alles, was sie erreichten.
Parallel zu den Spekulationen über die Zukunft des bayerischen Kernlands wurden andere Teile von Max Emanuels Territorium einer »Dismembration« unterworfen.11 Die 1623 von der Pfalz abgetretene Oberpfalz ging zurück an den Kurfürsten Johann Wilhelm, einen der entschiedensten Befürworter einer Auflösung des bayerischen Kurfürstentums. Andere zuvor unabhängige Graf- und Grundherrschaften wurden ebenfalls Favoriten der Habsburger und hohen Hofbeamten zugesprochen. Die kleine Grafschaft Leuchtenberg, die die Wittelsbacher 1646 geerbt hatten, erhielt Graf Leopold Matthias Lamberg, ein notorischer Liebling des Kaisers.12 1705 ging Mindelheim an Marlborough, der dadurch Reichsfürst wurde.13 Donauwörth wurde wieder Reichsstadt.
Es ging darum, Bayern zu erniedrigen und die territoriale Konsolidierung umzukehren, in deren Zuge seine Herrscher sich ehemals unabhängige Enklaven und kleinere Nachbargebiete einverleibt hatten. Einige dieser Territorien (etwa Mindelheim und Donauwörth) gehörten zum schwäbischen Kreis, aber größtenteils lagen sie im bayerischen Kreis, wo neue unabhängige Ländereien mehr Stimmen in den Kreisversammlungen bedeuteten, was Bayerns Dominanz unterminiert hätte. Kein Wunder, dass die Fürsten, speziell die »alten«, die traditionell den Kern der Opposition gegen die Krone bildeten, fürchteten, Joseph wolle ihre Stellung untergraben, indem er aus seiner Klientel neue Fürsten erhob.14
Der Friedensvertrag von Utrecht warf all diese Veränderungen ohne Kompensation über den Haufen. Marlboroughs Tage als deutscher Fürst endeten 1713. In Deutschland konnte der Kaiser anders als in Italien nicht einfach Territorien konfiszieren. In Mantua wurde die Herrscherfamilie einfach weggefegt, der Anspruch der jüngeren Linie ignoriert und der Kaiser übernahm das Herzogtum selbst.15 Das jagte den deutschen Fürsten einen Schrecken in die Glieder. Aber in Deutschland mit seinem wesentlich robusteren Rechtssystem war so etwas undenkbar. In Italien fanden die Erlasse des Reichhofrats ihre Grenzen dort, wo sie nicht militärisch durchsetzbar waren. In Deutschland waren die Vorrechte des Kaisers nicht klar definiert, aber zumindest in wichtigen Punkten durch Recht und Brauch beschränkt. Zudem waren die armierten Fürsten, die selbst so gern kleinere Territorien unterjochten, jederzeit bereit, diese zu verteidigen, wenn es gegen den Kaiser ging.
Dennoch wurde die kaiserliche Macht unter Joseph energischer ausgeübt als je zuvor. Angesichts der Widerspenstigkeit und Zersplitterung des Reichstags zögerte er nicht, diesem mit der Auflösung nach Kriegsende zu drohen.16 Im Februar 1708 kündigte er Strafen für Reichsstände an, die nicht vollständig für ihre Kontingente im Krieg gegen Frankreich gezahlt hatten, beginnend mit deren Erscheinen vor einer Kommission, um für die Nichterfüllung ihrer Pflichten gegenüber dem Kaiser geradezustehen. Josephs Umgangston gegenüber den deutschen Fürsten war im Allgemeinen außergewöhnlich schroff: Selbst der Preußenkönig war nicht gegen Rügen gefeit, wenn er seinen Beitrag nicht leistete.17
Damit einher gingen zahlreiche Initiativen, verfallene kaiserliche Vorrechte neu zu beleben. Viele davon waren geringfügig, die meisten betrafen kleinere – vor allem kirchliche – Territorien in Süd- und Mitteldeutschland.18 In Betracht gezogen wurde eine weitere Ausnutzung des kaiserlichen Rechts, Laienbenefiziate zu vergeben, die Klöster zu lebenslangen Stipendien für vom Kaiser (per Panisbrief oder panis littera) nominierte Laien verpflichteten.19 Das ebenso obskure Traditionsrecht des Kaisers, in jedem Bistum und jeder Stiftung das erste nach seiner Krönung frei werdende Benefizium neu zu vergeben (preces primariae), wurde reaktiviert.
Im Oktober 1705 erhielt Christian Julius Schier von Schierendorf den Auftrag, weitere fiskale Vorrechte zu ermitteln, die man neu beleben konnte.20 Er stellte fest, die Reichseinnahmen seien zweihundert Jahre lang vernachlässigt worden, und zwar in solchem Ausmaß, dass an den Brandenburger Universitäten Rechtsgelehrte die These vertraten, »Regalien und Rechte des Kaisers« seien »nur mehr ein Hirngespinst«. Allein die Juden hätten mehrere Millionen Gulden Schulden; diesem Bereich angemessene Aufmerksamkeit zu widmen, befand Schierendorf, könne bis zu einer Million Gulden pro Jahr einbringen. Tatsächlich wurden sogar die zuletzt geschätzten 20.000 Gulden nicht eingezogen.
Das Lahmliegen des Reichskammergerichts zwischen 1703 und 1711 verstärkte die Bedeutung des Wiener Reichshofrats als Instrument von Recht und kaiserlicher Herrschaft.21 Obwohl während des Krieges das Ausmaß der Italien betreffenden Geschäfte massiv anstieg, befasste sich der Reichshofrat weiterhin auch mit deutschen Belangen. 1707 setzte er Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen ab; das Domkapitel von Köln wurde beauftragt, den katholischen Fürsten seines Territoriums zu verweisen, da sich reformierte Untertanen über Unterdrückung, Intoleranz und außerordentlich harte Besteuerung beklagt hatten.22 Im Jahr darauf griff der Hofrat ein, um Recht und Ordnung in Hamburg wiederherzustellen, wo der Senat im Dauerstreit mit der Bürgerschaft lag. Truppen des niedersächsischen Kreises besetzten die Stadt, dann machte sich eine kaiserliche Kommission unter Damian Hugo von Schönborn an eine umfassende Reform der städtischen Verwaltung; 1712 trat eine neue Verfassung in Kraft.23
Ein starker Reichshofrat war sehr im Interesse des Kaisers, problematisch war aber das Fehlen einer Alternative.24 Der Wiener Hof galt vielen zu sehr als Werkzeug des Kaisers und prokatholisch. Große und kleinere Territorien gingen unterschiedlich mit dieser Situation um. Viele größere nutzten die Abneigung gegen den Wiener Hof und die Lähmung des Reichskammergerichts in Wetzlar, um Druck auf ihre Untertanen auszuüben, ihre Klagen lieber an den eigenen territorialen Gerichten einzureichen.25 Etliche solche waren um 1700 gegründet worden und profitierten von den Problemen in Wetzlar, auf das viele kleinere Territorien dennoch setzten.
Die Krise begann damit, dass Leopold I. 1703 den Gerichtspräsidenten Franz Adolf Dietrich von Ingelheim wegen dessen Streitigkeiten mit seinem protestantischen Kollegen Graf Friedrich Ernst von Solms-Laubach suspendierte. Ingelheim war der Neffe des Mainzer Kurfürsten, der das Recht des Kaisers auf Eingriffe am höchsten Gericht der Reichsstände infrage stellte. Der Konflikt war auch symptomatisch für die jahrzehntelange Dauermisere des Gerichts, die daher rührte, dass viele Territorien ihre Beiträge zu seiner Unterstützung nicht leisteten; hinzu kam die Unterbrechung seiner Arbeit durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg sowie Klagen über Inkompetenz und Korruption. Die in der Ordonnanz von 1654 festgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen des Gerichts fanden nie statt. Verständlicherweise war dem Kaiser daran gelegen, das Gericht wieder zum Arbeiten zu bringen, um die Stärke und Neutralität seiner Herrschaft zu demonstrieren. 1707 begann eine kaiserliche Kommission unter Rupert von Bodman, dem Fürstabt von Kempten, mit der Inspektion des Gerichtshofs, der dann im Januar 1711 wiedereröffnet werden konnte. Die von Bodman empfohlenen Reformen kamen nicht zustande, aber schon die Instandsetzung des Gerichts während des Kriegs war ein wichtiger Erfolg. Infolge der Krise verlor es jedoch einen Teil seiner Unabhängigkeit und wurde fortan als dem Kaiser unterstellt wahrgenommen.
In Josephs Regierungszeit fielen zwei weitere wichtige Entwicklungen. 1708 gelang die Beilegung des sechzehn Jahre dauernden Disputs über die Aufnahme von Hannover ins Kurkollegium, die zur Bildung einer opponierenden Fürstenpartei geführt hatte, angeführt von Herzog Ernst Augusts eigenen Verwandten in Braunschweig-Wolfenbüttel. Verkompliziert wurde die Sache dadurch, dass sie seit 1693 mit der »Wiederaufnahme« Böhmens verknüpft war.26 Der König von Böhmen (das heißt der Kaiser selbst oder sein Erbe) hatte traditionell nur an Wahlen zum Kaiser und Römischen König als Thronfolger zu Lebzeiten des Kaisers teilgenommen, nicht aber an den normalen Geschäften des Kollegs. Der Vorschlag, ihn »wiederzuzulassen«, war eine Reaktion auf das Argument, die Erhebung Hannovers schaffe ein protestantisches Übergewicht. Statt die Einführung einer weiteren katholischen Kurwürde ins Auge zu fassen, ergriff Leopold die Gelegenheit, seine eigene Macht zu stärken, indem er sich selbst einen Platz im Kurkolleg sicherte.
Das missfiel den anderen Kurfürsten, weil ihre Beratungen mit einem kaiserlichen »Spion« in der Kammer nicht länger geheim gewesen wären. Köln und Bayern wehrten sich viele Jahre lang, aber mit ihrer Ächtung war dieses Hindernis beseitigt. Das verbliebene Unbehagen wegen der konfessionellen Parität revidierte die Zusage, falls die Pfalz zum Katholizismus zurückkehre, werde Mainz eine zusätzliche zweite Stimme erhalten. Am 7. September 1708 wurden beide Kurfürsten offiziell ins Kollegium in Regensburg aufgenommen. Wie üblich spielten Symbolik und Zeremonie eine große Rolle: Joseph selbst leitete das vierzehnstündige Ritual, das mit dem Eintritt von Graf Franz Ferdinand Kinsky als Botschafter des Königs von Böhmen (das heißt Josephs) begann, der als erste offizielle Handlung seine Zustimmung zur Aufnahme des neuen Kurfürsten von Hannover erteilte.27 Selbst mitten in einem großen Krieg war es wichtig, auf die genaue Einhaltung von Rangfolge und Hierarchie zu achten.
Der zweite Punkt betraf die Fortsetzung der Arbeit an der Ständigen Wahlkapitulation (capitulatio perpetua), eine der im Westfälischen Frieden an den Reichstag überwiesenen unerledigten Aufgaben. Die Ächtung der Wittelsbacher Kurfürsten und die Kurwürden für Hannover und Böhmen waren von grundsätzlicher konstitutioneller Bedeutung. Die Fürsten missbilligten die Ächtung, nicht aus Sympathie für die Betroffenen, sondern weil sie nicht konsultiert worden waren. Viele Kritiker der Erhebung Hannovers wechselten von offener Ablehnung des spezifischen Antrags zu einer Protesthaltung, weil man sie nicht anhörte.
Mehr als ein Jahrzehnt nach der offiziellen Verleihung des Titels war die Aufnahme des Kurfürsten von Hannover nur folgerichtig. Aber man wollte zumindest eine Wiederholung der Vorgänge vermeiden und sicherstellen, dass daraus kein Präzedenzfall für die Einführung eines neuen kaiserlichen Privilegs wurde. 1707 kam Joseph der Opposition in dieser Hinsicht zuvor, indem er eine Wiederaufnahme der Gespräche über die Ständige Wahlkapitulation vorschlug und versprach, in Zukunft Fürsten und Kurfürsten vor einer Ächtung und vor der Schaffung neuer Kurwürden zu konsultieren. 1711 lag ein endgültiger Entwurf vor, der diese Zugeständnisse enthielt. Josephs Tod kam dazwischen, ehe alle Parteien zugestimmt hatten, und so wurde die Kapitulation nie formelles Gesetz. Dennoch diente sie als Vorlage für alle folgenden Wahlkapitulationen.28
Trotz seiner energischen Herangehensweise konnte Joseph jedoch die natürlichen Grenzen der kaiserlichen Autorität nicht überwinden. Den größten Einfluss hatte er in den kleineren Territorien in Schwaben und Franken. Zwar wurden auch im Norden Abgaben für den Krieg erhoben, aber oft unter beträchtlichen Schwierigkeiten, und seine politische Macht war dort weit geringer. In vollem Umfang kamen diese Hindernisse erst unter Karl VI. zum Tragen. Während Josephs Herrschaft zeigte sich das Problem daran, dass es ihm nicht gelang, eine der letzten niederländischen Einmischungen in die Reichspolitik zu unterbinden. Sein Versuch, 1706 die Wahl eines neuen Bischofs von Münster zu beeinflussen, war ein spektakulärer Fehlschlag.29 Nach erbittertem Ringen setzte sich der niederländische Kandidat Franz Arnold von Wolff-Metternich, Bischof von Paderborn, gegen den von Habsburg nominierten Karl Joseph von Lothringen, den Bischof von Osnabrück und Olmütz, durch, wozu auch die Parteinahme Brandenburgs beitrug.30 Ein verzweifelter Appell an den Papst konnte Clemens XI. nicht zum Eingreifen bewegen und zwei Jahre nach der Wahl blieb Joseph nichts übrig, als Franz Arnold in sein Amt einzusetzen.
Die Empfindlichkeit des Kaisers in diesem Fall spiegelte eine tief sitzende Angst vor niederländischen Einflüssen. Das führte zu Spannungen, als die Nördlinger Assoziation in ihrem Streben nach einer Reichsbarriere ein Bündnis mit der Niederländischen Republik eingehen wollte und als die Niederländer Anstalten machten, die Nördlinger Assoziation zu einem Abkommen zu bewegen, das über den Friedensschluss hinaus gelten sollte. Graf Sinzendorfs Behauptung, die Niederländer zielten auf eine Umwandlung der zehn Kreise in Kantone und ihre Abspaltung vom Reich ab, war absurd und sicherlich eine Fehldeutung der grundsätzlich loyalistischen Haltung von Lothar Franz von Schönborn.31 Lothar war ebenso wenig Republikaner wie Joseph. Aber der Verdacht belegt die Wiener Sorge zu einer Zeit, da der Kaiser, was viele Mitglieder der Nördlinger Assoziation betraf, seine Rolle als Beschützer des Reichs offenkundig nicht erfüllt hatte.32 Die Niederländer zeigten indes nicht viel Interesse an der Sache und nach Utrecht verzichteten sie auf jede Einmischung, was Karl VI., da er nun auch die Spanischen Niederlande besaß, im Nordwesten eine viel stärkere Stellung verschaffte.33
Josephs früher Tod macht eine endgültige Einschätzung seiner Herrschaft unmöglich. Vieles, was er tat, war vom Krieg erzwungen oder geprägt. Zu Friedenszeiten hat er nie regiert und viele seiner Initiativen hatten keine Zeit, Früchte zu tragen. Sein großes Monument in Wien ist Schloss Schönbrunn, allerdings eine verkleinerte Version des grandiosen Plans von Johann Bernhard Fischer von Erlach um 1692, der von Leopold I. in Auftrag gegeben worden war, dessen Umsetzung nach 1696 jedoch klar mit den in den jungen Thronerben gesetzten Hoffnungen verbunden war. Aber selbst die reduzierte Form verkörperte den Anspruch, Versailles zu übertreffen, nicht als Kopie des französischen Vorbilds, sondern mit ausgeprägt italienischen Anspielungen.34
Der »Imperialstil« erreichte seine Blüte unter Karl VI., verdankte seine Anfänge jedoch ganz allein Joseph. Einer der ersten »imperialen« Entwürfe Fischers von Erlach war eine Reihe von Triumphbögen nach römischem Vorbild für den Einzug des jungen Joseph in Wien nach seiner Wahl zum Römischen König 1690. Neben Wagner von Wagenfels war er Josephs Architekturlehrer, 1705 ernannte ihn Joseph zum Oberinspektor sämtlicher Hof- und Lustgebäude. In seinem Auftrag erweiterte er die Palette habsburgischer Symbole um Herkules und die Sonne, eine direkte Reaktion auf die französische Bildsprache mit ihren Anspielungen auf die Sonne und eine Herkunft vom »gallischen Herkules«.
Seine größten Werke schuf Fischer von Erlach erst unter Josephs Nachfolger. Selbst Schönbrunn war nicht ganz fertiggestellt, als Joseph starb. Doch stehen diese Projekte für Josephs Herrschaft insgesamt. Die Hoffnungen von Wagner von Wagenfels, Fischer von Erlach und dem »jungen Hof« auf einen österreichischen »Sonnenkönig« wurden enttäuscht.