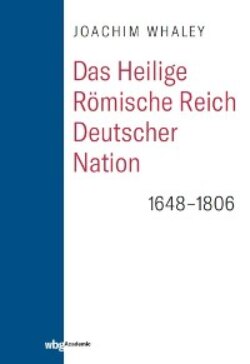Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 35
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
ОглавлениеKarl VI. war zu Beginn ein zögerlicher Kaiser. Obwohl er nie wirklich die Kontrolle über sein spanisches Königreich erlangt hatte und nach 1711 nicht dorthin zurückkehrte, beschäftigte ihn die Vorstellung, was daraus hätte werden können. Noch 1736 hielt er den dreißigsten Jahrestag der Aufhebung der Belagerung von Barcelona in seinem Tagebuch fest, und »Barcelona« war auch sein letztes Wort.1 In Wien erbte er mannigfaltige strategische Dringlichkeiten, aber auch eine schlimme Finanzlage und eine chaotische Verwaltung, die in keiner Weise den Herausforderungen gewachsen war, denen er sich stellen musste. An seinem Scheitern ist letztlich nicht zu zweifeln. Als er 1740 starb, war die Monarchie praktisch bankrott, die Armee demoralisiert, die Territorien in Italien und Ungarn wesentlich verkleinert, die kaiserliche Autorität im Reich geschwächt und das System der Bündnisse in Deutschland und Europa ein einziges Durcheinander.
Aber war das sein Fehler? Manche haben Karls Scheitern seinem schwierigen Charakter zugeschrieben, seiner Unentschlossenheit, die er durch Mut, Enthusiasmus und Pflichtgefühl nicht wettmachen konnte. Andere meinen, er sei schlichtweg überfordert gewesen. Zu den Herausforderungen in Italien und Ungarn kam der Erwerb der Spanischen Niederlande, der zwar den Zugang zur Nordsee öffnete, aber auch potenzielle Konflikte mit den Seemächten Großbritannien und Niederlande nach sich zog. Neben einer neuen Front zu Frankreich boten sich den Habsburgern damit indes auch neue Möglichkeiten im Nordwesten des Reichs.
Karls frühe Thronfolge in Spanien führte dazu, dass er viel von dem Symbolismus Karls V. übernahm.2 Es gab jedoch entscheidende Unterschiede. Er genoss nie auch nur annähernd dessen Macht und Autorität, und obwohl er auf einer vergleichbaren Bandbreite von Schauplätzen agierte, waren seine Ressourcen beschränkt und die Begleitumstände wesentlich ungünstiger. Der Spanische Erbfolgekrieg mag das Ziel verfolgt haben, Frankreich in die Schranken zu weisen, die Idee eines europäischen Machtgleichgewichts ließ sich aber ebenso leicht gegen Österreich richten. Im Reich verkomplizierte der neue, mit der polnischen beziehungsweise britischen Krone verbundene Status von Sachsen und Hannover sowie Brandenburg die Dinge. Die größeren Territorien waren immer weniger bereit, Anweisungen des Kaisers zu folgen; die deutsche Politik war mittlerweile untrennbar mit der europäischen verbunden.
Kehrte Karl deshalb dem Reich den Rücken? Hatte die österreichische Großmachtpolitik nun Vorrang vor dem zunehmend unergiebigen Engagement im Reich?
Zweifellos waren Entscheidungen gefragt. Karl war umgeben von verschiedensten Ratgebern, die unterschiedliche Prioritäten setzten. Sein Favorit aus der Zeit in Barcelona, Graf Johann Michael Althann, und die auf Italien und den Mittelmeerraum fokussierten spanischen Berater, die er mit nach Wien brachte, strebten nach Versöhnung mit Philipp V. in Madrid. Prinz Eugen und die von seinem Bruder übernommenen österreichischen Ratgeber stellten generell rein österreichische Interessen in den Vordergrund und warben für einvernehmliche Beziehungen zu Großbritannien. Eugen hatte daran als Generalgouverneur der Niederlande von 1716 bis 1724 auch ein persönliches Interesse.
Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn plädierte weiterhin für eine aktive Politik im Reich und den Einsatz kaiserlicher Privilegien, wenn nötig auch gegen Hannover und Berlin. 1719 wurde Schönborns Ausschluss von allen Geschäften, die nicht das Reich betrafen, formell bestätigt. Die österreichische Hofkanzlei wurde neu organisiert, zwei Kanzler für diplomatische und interne Angelegenheiten ernannt und der Reichsvizekanzler von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Damit kulminierte die seit einem Jahrhundert in Gang befindliche Trennung zwischen der kaiserlichen Kanzlei und dem, was um 1620 als interne österreichische Abteilung seinen Anfang genommen hatte. Die Entwicklung einer eigenen österreichischen Kanzlei ging nicht auf ein Bestreben nach Ablösung vom Reich zurück, sondern sollte die Möglichkeiten des Mainzer Kurfürsten einschränken, sich als Reichserzkanzler und offiziellen Vorgesetzten des Reichsvizekanzler in interne Belange der habsburgischen Länder einzumischen.3
Die persönlichen Ambitionen des Reichsvizekanzlers kollidierten ab den 1720er Jahren bisweilen mit seinen Verpflichtungen in Wien.4 1729 wurde er zum Fürstbischof von Würzburg gewählt und erbte mit dem Tod seines Onkels Lothar Franz, des Mainzer Erzbischofs, das Bistum Bamberg, wo er seit 1709 Koadjutor mit Nachfolgerecht war. Der Plan, seine neuen Ämter für einen weiteren Anlauf zur Wiederbelebung des Reichs einzusetzen, stieß jedoch nicht auf Gegenliebe. 1730 lehnte Karl Schönborns Vorschlag eines neuen Bündnisses zur Errichtung einer Kette von Festungen von Wien bis in die österreichischen Niederlande als Grundlage für eine Restauration der kaiserlichen Macht im Reich ab.5
Die häufige und lange Abwesenheit des Reichsvizekanzlers nutzten seine Wiener Widersacher, die auch seinen Versuch unterliefen, sich 1732 nach der dreijährigen Amtszeit von Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg zum Erzbischof von Mainz wählen zu lassen. 1734 schließlich zwang ihn der Kaiser zum Rücktritt. Sein Nachfolger in Wien, der zweiundsechzigjährige Johann Adolf Graf von Metsch, vormals Vizepräsident des Reichshofrats, war träge und erfolglos. Obwohl er von 1737 an in Rudolf Joseph von Colloredo einen Stellvertreter hatte, spielte die Reichskanzlei bis zu Metschs Tod 1740 keine bedeutende Rolle mehr.6
Dass die »österreichische« Politik des Kaisers manchmal in Widerstreit zur »Reichspolitik« geriet, war unvermeidbar. Jede Gruppe von Funktionären pflegte eigene Kontakte im ganzen Reich, hatte eine unterschiedliche Ausrichtung und wetteiferte um die Gunst des Kaisers. Karls notorische Unentschlossenheit verschärfte das Problem. Es ist indes unwahrscheinlich, dass er oder irgendeiner seiner Berater »österreichische Politik« und »Reichspolitik« als Alternativen betrachtete. Das Reich blieb wichtig, sein Verlust hätte Österreich empfindlich getroffen.
Das Reich bildete aber auch den Kern des vielleicht größten Problems: Karl hatte keinen männlichen Erben. Das war in zweierlei Hinsicht gefährlich. Um das Schreckgespenst eines Erbfolgekriegs zu bannen, bekräftigte die Pragmatische Sanktion zugunsten von Karls Tochter Maria Theresia die weibliche Thronfolge. Die Bestrebungen der sächsischen und bayerischen Ehemänner der Töchter Josephs I. waren damit jedoch nicht gänzlich beerdigt, ebenso wie die seit langer Zeit bestehenden, wenn auch dubiosen Ansprüche Bayerns, die auf der falschen Auslegung eines habsburgisch-wittelbacherischen Ehevertrags von 1546 und einem Nachtrag zum Testament Ferdinands I. von 1547 basierten.7 Zudem betraf die Pragmatische Sanktion nicht den Kaiserthron. Manche gingen selbstverständlich davon aus, die Krone werde an Maria Theresias Gatten gehen, und lehnten die Pragmatische Sanktion allein deshalb ab, aber das war alles andere als sicher.8 Um 1724/25 stand die allgemeine Durchsetzung der Pragmatischen Sanktion im Reich im Mittelpunkt der Wiener Politik. Nichts beschädigte die Autorität des Kaisers mehr.
Gleichzeitig profitierte Karl VI. nicht wie seine beiden Vorgänger vom »Solidaritätseffekt« einer elementaren Bedrohung des Reichs, die die Länder zur Verteidigung der deutschen Freiheit um die Krone sammelte und die habsburgischen Kaiser an entscheidenden Punkten der zurückliegenden zwei Jahrhunderte vor wachsendem Widerstand bewahrt hatte. Letztlich war das Reich eine Verteidigungsgemeinschaft. Das Fehlen eines ernst zu nehmenden Feindes Mitte des 18. Jahrhunderts war einer der Faktoren, die das System destabilisierten.9 Wenn Verteidigung nicht mehr vonnöten war, traten politische Ambitionen in den Vordergrund.
Karl VI. wurde mehr als Joseph I. im Licht späterer Entwicklungen beurteilt. Sein Tod 1740 stürzte Monarchie und Reich in eine Krise und die Kampfansage Friedrichs des Großen an die Habsburger gilt seit jeher als entscheidender Moment der deutschen Geschichte, an dem Brandenburg-Preußen seinen Anspruch auf die Herrschaft in Deutschland anmeldete und das Reich angeblich keine Zukunft mehr hatte. Aber die negative Bewertung von Karls Regierungszeit durch Historiker ist schwer mit zeitgenössischen Einschätzungen in Einklang zu bringen. So berichtete etwa der venezianische Botschafter in Wien 1733, kein Fürst des Hauses Österreich habe je eine solche Macht genossen wie der gegenwärtige Kaiser.10
Karl VI. lebte mit Sicherheit fürstlicher als sämtliche Vorgänger. Der Hofstaat wuchs unter ihm auf gut zweitausend Bedienstete, die Anzahl der jährlich mit Ehrentiteln wie dem eine Hofkämmerers versehenen Adligen erreichte nie dagewesene Höhen.11 Das Hofritual mit saisonalen Aufenthalten in der Wiener Hofburg (Oktober bis April), Laxenburg (Mai/Juni) und Favorita (Juli bis Oktober) kam an Pracht jedem anderen in Europa gleich.12
Herausragend war indes Karls Bautätigkeit. Seit Leopold I. um 1660 die Hofburg um den sogenannten Leopoldinischen Trakt erweitern hatte lassen, hatten die Habsburger auffallend wenig gebaut.13 Auch nach 1683 entstanden die meisten prächtigen neuen Gebäude in Wien im Auftrag adliger Dynastien, die um eine repräsentative Präsenz in Wien wetteiferten, die den prunkvollen Palästen auf ihren Ländereien in Böhmen und anderswo angemessen war. Bis 1730 wurden etwa 240 solcher Paläste errichtet; der vielleicht beeindruckendste ist Prinz Eugens Belvedere (1716–1723) mit seinem Oberen und Unteren Schloss und der verbindenden Gartenanlage.14 Abgesehen vom ersten Bauabschnitt von Schloss Schönbrunn planten die Habsburger in dieser Zeit viel, wovon jedoch kaum etwas umgesetzt wurde.
Karl übernahm die Pläne und gab ihnen neues Gewicht.15 Wie seine Vorgänger ließ er den Kern der Hofburg unangetastet. Mit einem Palastneubau im Zentrum von Wien hätten sich die Habsburger auf einen Wettstreit mit den anderen Höfen im Reich und Westeuropa herabgelassen. Der mittelalterliche Kern der Hofburg symbolisierte besser als jedes neue Schloss ihren Anspruch auf Vorrang vor allen anderen Herrschern. Karl ließ ihn mit einer neuen Bibliothek (teils nach dem Vorbild der Escorial-Bibliothek), einer Winterreitschule und einem Flügel für neue Büros der Reichshofkanzlei ausbauen. Zudem entstand eine Reihe von Zweckbauten wie Krankenhäuser (etwa das spanische Spital für die zahlreichen Spanier an Karls Hof), Heime für Kriegsinvaliden, Kirchen und klösterliche Institute.
Sein imperiales Empfinden machen zwei andere Projekte deutlich. Karls größtes Wohnbauvorhaben war die Umwandlung des Stifts Klosterneuburg in Niederösterreich in einen »österreichischen Escorial«.16 Der Plan wurde nur zum Teil verwirklicht, ein Triumph war hingegen die Errichtung der Wiener Karlskirche von 1716 bis 1739.17
Die Kirche entstand als Weihgabe zum Dank für die Verschonung Wiens und des Kaisers vor der Pestepidemie von 1712/13. Ihr Name erinnert an Karl Borromäus, den Mailänder Gegenreformator des 16. Jahrhunderts und Schutzheiligen gegen die Pest, der der Legende zufolge zahlreiche Erkrankte heilte, verknüpft aber auch Karls Namen mit dem Heiligen und der traditionellen Frömmigkeit der Habsburger. Außergewöhnlichstes und programmatisches Merkmal ist das zwischen 1724 und 1730 errichtete Säulenpaar. Ursprünglich sollte es mit Szenen aus dem Leben Karls des Großen und Karls des Kühnen ausgeschmückt werden, wie auch der Zentralbau der Kirche an die Pfalzkapelle Karls des Großen angelehnt ist.18 Die tatsächliche Ausführung vereint mehrere Anspielungen: auf die Säulen des Salomonischen Tempels und des Herkules, die römischen Säulen des Trajan und Marcus Aurelius, selbst die Minarette von Konstantinopel. Die Vermischung von Symbolen alttestamentarischer Könige, der griechischen Mythologie und des Römischen Reichs erinnert an die Wappen Karls V. und macht klar, dass Karl VI. an die universelle Reichsidee des einzigen anderen Kaisers, der sowohl die spanische als auch die heilig-römische Krone getragen hatte, anknüpfen wollte.19
Dies ist unterschiedlich interpretiert worden. Manche deuten die kaiserlichen Bauten als Manifestationen eines »Friedensstils«.20 Dafür spricht, dass die überragenden Bauherren der Jahre 1680–1720 eher Adlige als Habsburger waren. Wahr ist auch, dass der erste Bauboom der Befreiung von Wien 1683 folgte und der Friede der 1720er Jahre nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs und der neuen Kämpfe gegen die Türken von 1716 bis 1719 für eine neue Hochkonjunktur sorgte. Aber eine Deutung der kaiserlichen Vorhaben als Teil eines vom Adel dominierten Trends oder gar als verspäteten Versuch der Krone, dem Adel nachzueifern, übersieht die mit den Plänen Fischers von Erlach aus den 1690er Jahren und Karls Aufträgen an diesen, seinen Sohn und ihren Konkurrenten Lucas von Hildebrandt verbundenen politischen Absichten.
Weitaus passender wären die Begriffe Reichsstil oder Kaiserstil. Ersterer wurde 1938 von Hans Sedlmayr geprägt und oft kritisiert, weil darin die »Anschlussideologie« jener Zeit mitschwingt und Sedlmayr ihn in der Zeit nach 1683 ansetzt, als so gut wie keine kaiserlichen Bauten entstanden.21 Der Begriff Kaiserstil vermeidet Naziassoziationen, ist jedoch wegen der Betonung des Kaisers und nicht des Reichs von irreführender Zweideutigkeit. Franz Matsche, der Hauptvertreter des Kaiserstilkonzepts, argumentierte, der Stil sei eine Reaktion Karls VI. auf die veränderte Stellung der Habsburger: Er spiegele ihre eingeschränkte Autorität im Reich und die Minderung ihres Ansehens in Europa infolge des Gleichgewichts der Mächte.22 Die Habsburger hätten auf die Herausforderungen durch Frankreich, Sachsen und Brandenburg-Preußen mit einer aggressiven territorialen oder österreichischen Großmachtpolitik geantwortet, wenn auch flankiert von der Anmaßung einer Vorrangstellung, die real nicht mehr existierte.
Diskussionen über den Kaiserstil übersehen indes gern das Ausmaß, in dem er nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Reich übernommen und nachgeahmt wurde. In Österreich dienten die Pläne für Klosterneuburg als Vorbild für die Neugestaltung zahlreicher Klosterbauten, etwa Göttweig, Kremsmünster, Melk und St. Florian.23 So gut wie alle umfassen Abwandlungen des Kaisersaals und der Kaiserstiege sowie eine Zimmerflucht für eventuelle Besuche des Kaisers und eine an die neue Bibliothek in der Hofburg angelehnte Büchersammlung. Den prachtvollen Kaisersaal zierten meist eine Ahnengalerie der Habsburger und dekorative Darstellungen des Kaisers als Apollo, Sonnengott und Bewahrer der Künste und Wissenschaften, als Jupiter der Türkenbezwinger und als neuer Konstantin.
Dieses bauliche und dekorative Muster verbreitete sich im Reich. Brandenburg-Preußen und Sachsen-Polen freilich entwickelten wie schon im späten 16. Jahrhundert ihre eigenen Stile, Bayern und die Wittelsbacher zeigten ihre Zwietracht mit den Habsburgern und die anhaltenden Flirts mit Frankreich durch die Aufnahme französischer Einflüsse.24 In süddeutschen Kirchenbauten in den großen Fürstbistümern, insbesondere denen, die in den 1720er und 1730er Jahren Angehörige der Familie Schönborn hielten, aber auch in säkularen Territorien wie Baden-Baden (Rastatt) und der Pfalz (Mannheim) setzten sich wichtige Elemente des Stils durch, den man treffend als Reichsstil bezeichnen sollte.25 Die Schwerpunkte unterschieden sich: Im Reich betonte die Ahnengalerie die Abfolge der heilig-römischen Kaiser und ihrer Vorläufer in Rom und nicht einfach die Dynastie der Habsburger.26 Aber der Stil war bewusst ähnlich gehalten und die Botschaft ebenso klar: Identifikation mit den habsburgischen Kaisern und Identifikation mit dem Reich. Allen Problemen und Meinungsverschiedenheiten zum Trotz war die Verpflichtung auf das Reich nach wie vor unverbrüchlich.
Die Herrschaft Karls VI. markiert in vielerlei Weise den Gipfelpunkt des kaiserlichen Wiederaufstiegs, der unter Ferdinand III. und Leopold I. begonnen hatte. Die Loyalität der traditionellen Klientel im Süden spiegelte die konfessionelle Solidarität wider, aber die Autorität des Kaisers respektierten auch viele protestantische Höfe im Norden, die ihre Paläste teilweise ebenfalls mit einem Kaisersaal ausstatteten. Protestantische Fürsten standen dem Kaiser militärisch bei, nutzten die Dienste des Reichshofrats und betrachteten den Kaiser als oberste juristische Instanz. Als Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar den Ritterorden de la Vigilance (der Wachsamkeit) stiftete, schrieben die Statuten vor, dass niemand den Orden tragen durfte, der »nicht recht patriotisch gesinnet und für allerhöchst-besagte Ihro Röm. Kayserl. Majestät Carl VI. aufzuopfern gesonnen« war.27
Fertigwerden musste Karl natürlich auch mit den zunehmend problematischen Folgen der Unterstützung königlicher Ambitionen Sachsens, Brandenburg-Preußens und Hannovers durch Leopold I. Als das Fehlen eines habsburgischen Thronerben zum zentralen politischen Thema wurde, kam noch die durch den Wettstreit um die Findung eines nichthabsburgischen Kaisers erzeugte Unsicherheit hinzu. Darin kam jedoch lediglich Feindseligkeit gegen das Haus Habsburg zum Ausdruck, nicht gegen das kaiserliche Amt als solches. Über die Zukunft der Habsburger als heilig-römische Kaiser mag es 1740 ernsthafte Zweifel gegeben haben, über die Zukunft des Reichs selbst aber sicher nicht.