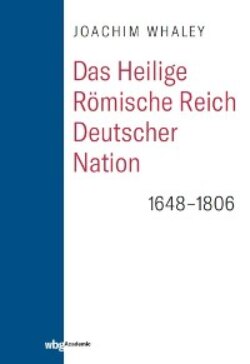Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 37
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
ОглавлениеDie visuelle Propaganda Karls VI. suggerierte ein allumfassendes Imperium. In Wirklichkeit musste er mit seinen ohnehin überlasteten Mitteln und Kräften ständig zwischen diversen Fronten und Zwängen jonglieren. Oft waren das scheinbar rein österreichische Angelegenheiten, in die das Reich jedoch in unterschiedlichem Maß verwickelt war.1 Zudem wirkten sich Erfolg und Scheitern des Kaisers unweigerlich auf seine Stellung im Reich aus.
Die erste Herausforderung war ein neuer Konflikt mit den Türken, die im Dezember 1714 Venedig den Krieg erklärten.2 Bis September 1715 war das venezianische Imperium in Griechenland zerstört. Die Türken bemühten sich, die Österreicher aus dem Konflikt herauszuhalten, aber die Aussicht, Belgrad und das Banat, die in türkischer Hand verblieben waren, erobern zu können, war zu verlockend. 1716 war ein Bündnis mit Venedig geschlossen, woraufhin die Türken von Belgrad aus angriffen. Prinz Eugen stoppte ihren Vormarsch bei Peterwardein (5. August 1716) und belagerte dann Temesvár, das im Oktober fiel. Binnen eines Jahres baten die Türken um einen Waffenstillstand und so wurde unter Vermittlung der Seemächte im Juli 1718 der Friede von Passarowitz geschlossen. Österreich kontrollierte nun erstmals ganz Ungarn und verschob seine Grenze südöstlich über die Donau nach Serbien.
Der Konflikt betraf das Reich nicht direkt, weil es sich um einen Angriffskrieg handelte, aber die Hoffnung, die Türken ein für alle Mal aus Europa zu vertreiben, sorgte für einiges Wohlwollen für das Anliegen des Kaisers in Deutschland. Offiziell kam es nicht zur Mobilisierung von Kreiskontingenten, der Reichstag beschloss jedoch einen Zuschuss von 6 Millionen Gulden. Acht Fürsten entsandten zudem Truppen, auch der Kurfürst von Bayern, der sein Verhältnis zum Kaiser verbessern wollte. Zwar war die Wiedereinsetzung des Kurfürsten im Frieden von Rastatt (6. März 1714) beschlossen worden, aber Karl lehnte es wegen des erneuerten bayerisch-französischen Bündnisses von 1714 ab, ihm seine Länder wiederzugeben. Gleichzeitig plante Max Emanuel bereits die Verheiratung seines ältesten Sohnes mit einer Tochter Josephs I. Zu diesem Zweck begleiteten Max Emanuels Erbe Karl Albrecht und dessen jüngerer Bruder Ferdinand Maria das bayerische Kontingent von 5.000 Mann nach Ungarn, um unterwegs Karl in Wien ihren Respekt zu erweisen.3 Der Sieg über die Türken stärkte Karls Stellung im Reich beträchtlich und machte Prinz Eugen zum Volkshelden, den das beliebte Lied vom Prinzen Eugen als »edlen Ritter« der Schlacht um Belgrad pries.4 Karl selbst fand neben seinem Vater Leopold I. Aufnahme in den Pantheon der Türkenbezwinger.
Zum Zeitpunkt des Friedensschlusses im Osten hatte sich die kompliziertere Lage im Mittelmeerraum zugespitzt. Die spanischen Bourbonen weigerten sich, ihre Ansprüche auf die ehemals spanisch-italienischen Territorien aufzugeben, Karl wiederum wollte nicht formell auf die spanische Krone verzichten. Die Entschlossenheit der zweiten Frau Philipps V., Elisabetta Farneses, ihren Söhnen Don Carlos (* 1716) und Don Felipe (* 1720) italienischen Besitz zu verschaffen, brachte das Fass zum Überlaufen. Zunächst versuchte die britisch-französisch-niederländische Tripelallianz zwischen Wien und Madrid zu vermitteln, aber Karls fester Wille, Spanien aus Italien herauszuhalten, machte alle Hoffnungen auf Einigung zunichte.
1717 griff Spanien Sardinien und dann Sizilien an und versuchte Frankreich und die Briten abzulenken, indem es hier unzufriedene Adlige und dort eine neue Initiative des Thronprätendenten Jakob III. unterstützte. Die Folge war lediglich eine Aufstockung der Tripel- zur Quadrupelallianz mit Österreich und die Ausarbeitung eines Friedensplans, der Madrid nach der Vernichtung der spanischen Flotte durch Großbritannien und der Rückeroberung von Sizilien und Sardinien durch den Kaiser aufgezwungen wurde. Karl verzichtete auf den spanischen Thron und erhielt Sizilien im Austausch gegen Sardinien, das mit einem Königstitel an Savoyen fiel. Parma-Piacenza und die Toskana wurden als Reichslehen bestätigt und Karl stimmte der Nominierung von Karl III. als Erben im Fall des (baldigst erwarteten) Aussterbens der zwei herrschenden Herzogshäuser zu.
Da es sich um Reichslehen handelte, wäre eine Konsultation des Reichstags über die Nachfolgeregelung logisch gewesen.5 Obwohl Karl III. eilends als Thronfolger bestätigt wurde, unternahm Karl VI. weiterhin alles in seiner Macht Stehende, um eine spanische Rückkehr nach Italien zu verhindern. Seine Renitenz trieb Frankreich und Großbritannien auf die Seite von Madrid. Zugleich verstärkte der britische Widerstand gegen die Gründung der Kaiserlichen Ostender Kompanie in den Spanischen Niederlanden im Dezember 1722 die Isolation Wiens.6
Eine Konferenz in Cambrai 1724 konnte das Thronfolgeproblem in Parma und der Toskana nicht lösen, aber eine unerwartete Wende der spanischen Politik lockerte die Isolation kurzfristig. Der spanische Plan einer Heirat von Karl III. und Maria Theresia (sowie ihrer jüngeren Schwester und Karls Bruder Philipp), um Spanien mit der kaiserlichen Krone und den österreichischen Erblanden zu verbinden, versprach eine viel größere Ausbeute als das italienische Erbe. Geheimverhandlungen führten 1725 zu einer Reihe österreichisch-spanischer Abkommen, etwa über die spanische Unterstützung der Ostender Kompanie und Subventionen von 3 Millionen Gulden in spanischem Silber; der Heiratsplan selbst wurde jedoch mit keinem Wort erwähnt.
Die Abkommen des Jahres 1725 zwischen Wien und Madrid waren unrealistisch. Spanien konnte das Geld nicht bezahlen. Es war unvorstellbar, dass je ein Bourbone in Wien gekrönt würde, schon gar nicht in Frankfurt. Karl VI. blieb entschlossen, eine spanische Rückkehr nach Italien zu verhindern, wenn dies irgend möglich war. Aber die wenigen veröffentlichten Details – das meiste blieb geheim – waren Provokation genug für eine sofortige Reaktion der Briten (mit Hannover) und Franzosen in Form der Allianz von Herrenhausen mit Brandenburg-Preußen im September 1725.
Damit wurde der Konflikt am Mittelmeer zum politischen Problem des Reichs. Eine Weile stand Europa am Rand eines weiteren großen Krieges und das Reich vor einer Aufspaltung in protestantische Territorien und die Klientel des Kaisers. Dass Graf Sinzendorf offen von einer großen katholischen Allianz mit Frankreich und den katholischen Kurfürsten sprach, um den Protestantismus niederzuringen, goss neues Öl ins Feuer und machte die Behauptung Georgs I. glaubhaft, Wien und Madrid hätten sich verschworen, die Stuarts in Großbritannien wieder auf den Thron zu bringen.7 Frankreich stand derweil fest an Großbritanniens Seite. Das alarmierte Karl so sehr, dass er 1727 den Reichsvizekanzler drängte, die Truppen der Frankfurter Allianz der Kreise zu mobilisieren, um das Reich gegen einen französischen Überfall am Rhein zu verteidigen.8
Es gelang Karl, einen Bund mit Russland zu schließen und Brandenburg-Preußen zum Austritt aus der Allianz von Herrenhausen zu bewegen, aber die Lage blieb prekär. Sie entspannte sich erst durch den Tod von Katharina I., der Russlands Blick für eine Weile von Europa abwandte, und von Georg I., was eine Wiederannäherung an Großbritannien möglich machte.9 Spaniens Interesse an der Allianz mit Österreich schwand, als klar wurde, dass Wien nicht die Absicht hatte, den Heiratsplan zu realisieren. Zudem wurde immer deutlicher, dass Karl nicht auf die Loyalität Bayerns, der Pfalz und Sachsens rechnen konnte.
Da ihm nun nichts dringlicher am Herzen lag als Friede und Stabilität, um die Pragmatische Sanktion durchsetzen zu können, war Karl gewillt, die Ostender Kompanie aufzulösen, um seine Isolation zu beenden. Das ebnete den Weg für eine neue Gesprächsrunde unter französischer Vermittlung in Soissons 1728. 1731 stimmte er der endgültigen Schließung der Ostender Kompanie zu, im Gegenzug sollte Großbritannien die weibliche Thronfolge in Österreich garantieren. Zudem gestattete er spanische Garnisonen in der Toskana, Parma sowie Piancenza und übergab Parma-Piacenza, dessen herzogliche Linie mit dem Tod von Graf Antonio im selben Jahr erloschen war, an Karl III.
1732 war Wien mehr oder weniger zum »alten System« der Großen Allianz gegen Frankreich zurückgekehrt und hatte die österreichische Führungsstellung in Italien behauptet. Der Verlust von Parma, das Versprechen der Toskana und die Aufhebung der Ostender Kompanie waren große Zugeständnisse, beeinträchtigten die generelle Stellung der Habsburger in Europa aber nicht.
Im Norden stellte sich die Lage anders dar. Dort waren Einfluss und Autorität des Kaisers immer schon schwach, aber während des Großen Nordischen Kriegs von 1700 bis 1721 entstand eine neue Situation. Österreich hatte an diesem Konflikt keine territorialen Interessen, aber der Weiterbestand des Reichs und die Autorität des Kaisers standen und fielen mit seiner Fähigkeit, es gegen Aggression von außen zu verteidigen und die ehrgeizigen Nordländer im Zaum zu halten. Im Großen und Ganzen gelang ihm das, der Konflikt befeuerte aber auch die politischen Ambitionen von Hannover und Brandenburg-Preußen.
Anfangs betraf der Konflikt das Reich gar nicht direkt.10 Er entzündete sich am gemeinsamen Angriff von Dänemark, Sachsen-Polen und Russland auf Schweden. Die Dänen wollten die Verluste wettmachen, die sie in den 1660er Jahren erlitten hatten, der sächsische König von Polen sein Reich vor einer möglichen schwedischen Aggression schützen und durch den Erwerb von Livland als Erbherzogtum seine Dynastie in Polen etablieren. Peter der Große strebte nach einem Zugang zum Baltikum, der durch die schwedischen Besitzungen Karelien, Ingermanland und Estland versperrt war. Brandenburg-Preußen hatte ein natürliches Interesse an der Koalition, weil es ebenfalls auf einen Zugang zum Baltikum aus war und seit Langem Anspruch auf Westpommern erhob.
Der Berliner Kurfürst war jedoch verpflichtet, die Habsburger zu unterstützen, weil sie 1701 seiner Annahme des Titels König in Preußen zugestimmt hatten, und beteiligte sich daher nicht an dem Konflikt vor seiner eigenen Tür. Kurzfristig konnte Brandenburg dadurch die Politik verfolgen, wegen der der Kurfürst überhaupt auf den Königstitel erpicht gewesen war: Sachsen, das vom Kurfürstentum zum Königsthron in Polen aufgestiegen war, dabei zuzusehen, wie es bis zur Erschöpfung Ressourcen nach Polen pumpte, war eine bequeme Art, Brandenburgs regionale Sicherheit zu gewährleisten. Auch Hannover schaute gern zu, wie sich Sachsen übernahm, und war wegen seiner (1692 zugesagten, aber erst 1708 bestätigten) Kurwürde ebenfalls dem Kaiser verpflichtet.
Die antischwedische Koalition ruhte auf der Annahme, dass Schweden seinen Zenit überschritten hatte und besonders verwundbar war, seit der fünfzehnjährige Karl XII. 1697 den Thron bestiegen hatte. Die dreigleisige Offensive auf Holstein-Gottorp, Livland, Riga und Ingermanland war zunächst erfolgreich, dann aber startete Karl XII. einen auf Polen konzentrierten Gegenangriff. 1707 schloss er Frieden mit Joseph I. und zog seine Truppen aus dem Reich ab.11
Der Frieden im Westen gab dem schwedischen König freie Hand im Osten. Peter der Große hatte den sächsisch-polnischen Krieg genutzt und war in Ingermanland einmarschiert, wo er 1703 mit der Errichtung seiner neuen Hauptstadt St. Petersburg begann. Die Atempause für Deutschland hielt einige Jahre an, weil Karl im Juli 1709 bei Poltava eine vernichtende Niederlage erlitt und bis 1714 ins türkische Exil entfliehen musste. Während dieser Zeit veränderte sich die politische Landschaft in Norddeutschland gründlich.
Hannover und Brandenburg schickten sich an, das Machtvakuum zu füllen, das Sachsens Wegfall als führende Regionalmacht hinterlassen hatte. Dann nahmen 1711 dänische, sächsische und russische Streitkräfte den Kampf gegen die Schweden wieder auf und griffen Mecklenburg und Westpommern an. Die Bemühungen kaiserlicher Autoritäten – allen voran Prinz Eugen –, die Neutralität Norddeutschlands zu wahren, hatten zunächst Erfolg. Der Versuch einer internationalen Einigung auf der langwierigen Friedenskonferenz in Braunschweig 1712 unter Vorsitz von Graf Damian Hugo von Schönborn, dem Bruder des Reichsvizekanzlers, der kurz zuvor den internen Konflikt in Hamburg geschlichtet hatte, scheiterte jedoch.12
Das Wiedererscheinen Karls XII. in Stralsund im November 1714 führte nicht zu seiner Zulassung am Verhandlungstisch. Seine Weigerung, die Niederlage einzugestehen oder wenigstens einen Kompromiss zu akzeptieren, machte einen Frieden unmöglich, solange er lebte. Sein Angriff auf preußische Truppen auf der Insel Usedom zog Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) in den Konflikt hinein. Das dänische Vorgehen gegen schwedische Besitzungen in Bremen und Verden im Nordwesten provozierte Hannover, das seit Langem auf diese Gebiete schielte. Gleichzeitig erhöhte die Nachfolge des Kurfürsten auf dem britischen Thron 1714 Hannovers politische Bedeutung und gab ihm als König einer großen europäischen Nation und Kommandeur der britischen Flotte zusätzliches politisches Gewicht. Peter der Große schmiedete derweil ein Bündnis mit Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg (1692–1713) und seinem Nachfolger Karl Leopold (1713–1747).
Ihr Drang, ihr Territorium zum Schutz vor räuberischen Nachbarn zu bewaffnen, hatte zu schweren Konflikten mit Adligen wegen ungesetzlicher Besteuerung geführt; jetzt fürchteten sie ungünstige Urteile vom Reichshofrat in Wien und Eingriffe von Hannover und Brandenburg, die seit Langem Anspruch auf ihr Herzogtum erhoben. Auf französische Vermittlung hin verließen die russischen Truppen 1717 Mecklenburg und Georg I. suchte jenseits der Koalition nach Wegen, Russlands Vordringen im Baltikum zu bremsen.
Die erweiterte antischwedische Koalition war jedoch stabil genug, um die Position von Karl XII. unwiderruflich zu untergraben.13 Zwei letzte Angriffsversuche auf Norwegen konnten das Blatt nicht mehr wenden und der Tod des Schwedenkönigs während der Belagerung der Festung Fredriksten im Herbst 1718 ebnete den Weg zu Friedensverhandlungen. Fast gleichzeitig wurde Russland an Schwedens Stelle zum Hauptproblem: Da russische Truppen im ganzen Südbaltikum von Jütland bis St. Petersburg standen, erschien der vormalige Verbündete nun allen Koalitionspartnern als Bedrohung. Im Vertrag von Wien im Januar 1719 beschlossen Großbritannien, Österreich und Sachsen, Russland in seine alten Grenzen zurückzudrängen und Preußen zum Frieden zu zwingen.14
Der neue Status quo im Norden des Reichs verdankte sich der Kooperation von Hannover und Brandenburg und nicht kaiserlicher Vermittlung. Entscheidend war auch, dass nun Friedrich I. von Hessen-Kassel die schwedische Politik bestimmte, der deutsche Gemahl von Ulrika Eleonora, der Nachfolgerin Karls XII., die im Februar 1720 zu seinen Gunsten auf den Thron verzichtete. Als deutscher Fürst war Friedrich wohl geneigt, den schwedischen Einfluss im Reich zu dämpfen. Die entscheidenden Gespräche initiierte Georg I. nach den Wiener Verträgen. Im November 1719 schloss der britische König in seiner Funktion als Kurfürst von Hannover gegen die Herausgabe von Bremen und Verden Frieden mit Schweden; ein paar Wochen später folgte Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Westpommern bis zur Peene und Stettin übernahm. Schweden behielt Wismar, Riga und Stralsund (bis 1806), aber seine Stellung in Deutschland war so gut wie zunichte.
Kurz darauf musste Dänemark einen Frieden akzeptieren, der die Annexion von Holstein-Gottorp und den Verzicht auf alle Ansprüche auf Territorien jenseits des Sunds umfasste. August der Starke, der 1709/10 von russischen Streitkräften wiedereingesetzt worden war, wiederholten russischen und schwedischen Übergriffen auf sein Königreich aber machtlos gegenüberstand, einigte sich nun ebenfalls mit Schweden.15 Damit war es Georg I. gelungen, Russland zu isolieren, er unterschätzte jedoch die militärische Stärke Peters des Großen, die es ihm im August 1721 ermöglichte, mit Schweden den Frieden von Nystad zu schließen. Für den Rückzug aus Finnland erhielt er Estland, Livland, Ingermanland, Kexholm und einen Großteil von Karelien.16 Aus Deutschland war der Zar somit verdrängt worden, sein Reich hatte sich indes als europäische Macht etabliert, mit Zugang zur Ostsee und effektiver Hegemonie über Polen, dessen König sein Überleben der russischen Streitmacht verdankte.
1707 hatte das kaiserliche Eingreifen den Konflikt vom Reich abgewendet. Danach verdankte sich die Erhaltung von Frieden und Stabilität im Norden nach zwei Phasen schwerer Kämpfe 1712/13 und 1715 mehr dem Bemühen von Hannover und Brandenburg-Preußen um ihre eigenen Interessen als einem Einsatz des Kaisers. Ihre gestärkte regionale Macht war beiden sehr bewusst. Sie konnten den Kaiser unter Druck setzen und ihre gemeinsame Opposition gegen die kaiserliche Religionspolitik in den frühen 1720er Jahren bedrohte empfindlich dessen Autorität im Norden.17
Andererseits wollte keines der beiden Länder riskieren, sich den Anweisungen des Kaisers offen zu widersetzen. Binnen weniger Jahre bot die Mecklenburg-Frage Wien erneut die Möglichkeit, die alte Politik des gegenseitigen Ausspielens von Hannover und Berlin zu revidieren, und Ende der 1720er Jahre standen beide wieder treu zum Kaiser. Trotz ihrer wachsenden Macht und internationalen Verflechtungen hielten sich Hannover und Brandenburg weiter an die Regeln eines Systems, das ihren eigenen Interessen am besten diente. Im Nordischen Krieg hatte Georg I. versucht, britische Macht und britisches Prestige zugunsten seines deutschen Kurfürstentums einzusetzen. Danach kam es jedoch zu einer zunehmenden Trennung; der einheimische Adel hielt an seiner Loyalität zu Habsburg und dem Reich fest.18 In Brandenburg-Preußen blieb die Politik Friedrich Wilhelms I. in Einklang mit seinen Pflichten als Reichsfürst und bis Ende der 1730er Jahre stand Brandenburg wie eh und je seit 1686 grundsätzlich treu zu den Habsburgern.19