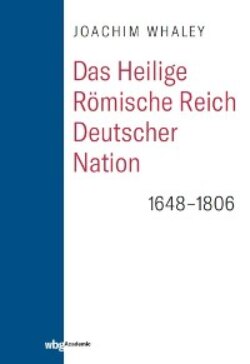Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 39
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
ОглавлениеViele der von Leopold I. und Joseph I. eingeleiteten Initiativen setzte Karl VI. energisch fort. Der Reichshofrat blieb äußerst aktiv. Es gab neue Versuche, die Einkünfte aus dem Reich zu erhöhen. Der Kaiser unterstrich mit einer ganzen Reihe von Erlassen seine Entschlossenheit, seine Rechte auszuüben und die Ordnung im Reich zu erhalten.1 So berichtete etwa der preußische Generalbevollmächtigte Cocceji im Januar 1715 nach Berlin, der Kaiser wolle seine Autorität und alle ihm durch Reichsgesetze übertragenen Rechte in vollem Umfang ausüben. Insbesondere habe er offenbar beschlossen, in der Rechtsprechung des Reichs keine Rücksicht auf Einzelne zu nehmen, die Länder, die in den letzten Jahren einseitig vorgegangen seien, zur Gesetzestreue zu zwingen und die Opfer solcher Exzesse zu unterstützen.2
Ein erstes Signal für das energische Wiederaufleben der kaiserlichen Politik nach dem Frieden von Rastatt war ein Dekret zu Büchern und Zeitschriften im Juli 1715. Es bestätigte nicht nur die geltenden Einschränkungen gegen Publikationen, die den Religionsfrieden störten oder in irgendeiner Weise verleumderisch waren. Nun verbot der Kaiser sämtliche Schriften, die »gegen die Staatsregierung und Grundgesetze des heiligen röm. Reichs« gerichtet waren, und untersagte darüber hinaus, »auf Universitäten über das jus. civile u. publicum sehr schädliche des heil. röm. Reichs Gesetze und Ordnungen anzapfende verkehrte neuerliche Lehren, Bücher, Theses und Disputationes« zu verbreiten, die geltende Gesetze und Statuten des Reichs untergraben und so Unordnung herbeiführen könnten.3
In »kaiserlicher Machtvollkommenheit« Dekrete zu erlassen, war ja schön und gut. Wie wirkungsvoll seine Bemühungen waren und wie lange er sie weiterverfolgte, ist jedoch umstritten. Manche glauben, sein Interesse am Reich sei von Anfang an begrenzt gewesen, andere meinen, er habe bis etwa 1730 die kaiserliche Macht erfolgreich ausgeübt und dann Einfluss und Interesse verloren.4 Das hängt größtenteils davon ab, wie man den langsamen Rückzug von Friedrich Karl von Schönborn aus Wien nach 1729 interpretiert.5 Sicherlich wurde er gedrängt, sein Amt als Reichsvizekanzler 1734 aufzugeben, seine Aufgaben in Wien waren aber auch nur selten mit seinen Pflichten in den Bistümern Bamberg und Würzburg in Einklang zu bringen.6
Es gibt indes keinen Beleg für einen Streit zwischen Schönborn und dem Kaiser. Die 1720er Jahre hindurch war er mit Ländereien in Österreich und Ungarn belohnt worden; umfängliche Zuschüsse ermöglichten ihm den Bau eines Sommerpalasts bei Göllersdorf nahe Wien. Die Wende kam offenbar mit seiner Bewerbung für das Erzbistum Mainz 1732: Der Kaiser hatte gute Gründe, eine Wahl zu verhindern, die ihm einen dynamischen Führer der deutschen Länder eingebracht hätte. Den Habsburgern als Kaiser blieb Schönborn auch nach dieser Abfuhr treu, in erster Linie jedoch dem Reich als Institution: Im Österreichischen Erbfolgekrieg nach 1740 beharrte er auf Neutralität und brachte andere kleine Länder dazu, ihm zu folgen.7
Die diversen Initiativen vor 1730 hatten nur teils Erfolg. Die kaiserlichen Eingriffe in die internen Belange der Reichsstädte Hamburg (1708–1716) und Frankfurt (1712–1732) waren sicherlich dramatisch und entscheidend. Die Kombination kaiserlicher Kommissionen und Erlasse stabilisierte eine möglicherweise revolutionäre Situation und trug zur Modernisierung der oligarchischen oder aristokratischen Verfassungen bei, die Anlass der Unruhen gewesen waren.8 Das machte es jedoch nicht unbedingt leichter, von diesen Städten Gelder zu kassieren. Hamburg etwa hatte nach einem antikatholischen Aufruhr, bei dem 1719 das Haus des Botschafters samt der katholischen Kapelle zerstört wurde, allen Grund, sich dem Kaiser zu fügen. 1720 indes verweigerte der Senat die Bezahlung von Steuern auf Juden und eines Beitrags zur Erhaltung der Reichsfestungen Kehl und Philippsburg am Rhein.9
Die Judensteuer war eine von mehreren traditionellen kaiserlichen Einnahmequellen, die Wien wiederbeleben wollte. Karl VI. hatte nach seiner Krönung angeordnet, dass ihm die Frankfurter Juden formell ihre Ehrerbietung erweisen und damit seine Oberherrschaft anerkennen. Der nächste Schritt, die Einführung einer allgemeinen Steuer für alle Juden in den Reichsstädten und den Ländern der Reichsritter, erwies sich aber als undurchführbar. In der Mehrheit der Territorien hatten längst die lokalen Herrscher die Verantwortung für die Juden und das Recht, sie zu besteuern, übernommen. Darauf beriefen sich Reichsstädte und Ritter nun auch in eigener Sache. So weigerten sich etwa 1721 die Ritter rigoros, den Juden in ihren Ländern kaiserliche Steuern aufzuerlegen, und nach längeren Diskussionen lenkte Wien schließlich ein. 1733 wurden die Reichsritter als Territorialherrscher wie Fürsten anerkannt; der Kaiser konnte sich dem nicht widersetzen, weil er von ihrer Bereitschaft abhängig war, weiterhin die sogenannten subsidia charitativa zu bezahlen.10
Neue Anläufe zur Durchsetzung kaiserlicher Vorrechte bei kirchlichen Wahlen blieben ebenso erfolglos. So wie es Joseph I. nicht gelungen war, 1706 in Münster seinen Kandidaten durchzusetzen, konnte auch Karl VI. 1724 die Wahl von Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn in Würzburg nicht herbeiführen.11 Sobald das Domkapitel Wind von den kaiserlichen Plänen bekam, wählten die Domherren eilends Christoph Franz von Hutten, bevor der kaiserliche Wahlbeauftragte Graf Wurmbrand auch nur in der Stadt eingetroffen war.
Der Reichshofrat prüfte daraufhin die Rechte des Kaisers auf Empfehlung, Ausschluss und Verweigerung der Einsetzung eines gewählten Bischofs in sein Territorium. Man kam zu dem Schluss, diese Rechte existierten nach wie vor, riet jedoch, in Zukunft äußerst behutsam damit umzugehen. Sie kamen tatsächlich nie wieder zur Anwendung. Informelle Einflussnahme erwies sich als wirkungsvoller. Friedrich Karl von Moser notierte 1787, es gebe »Beispiele, daß zuweilen die Wahl auf einen kundbaren Dummkopf gelenkt und durchgesetzet worden, bloß weil er sich mit Leib und Seel zu Dienst, Willen und Absichten des kaiserlichen Hofes oder vielmehr des Hauses Österreich ergeben.«.12 Im Allgemeinen dominierten auf diesem Gebiet jedoch die Wittelsbacher bis zum Aussterben ihrer zwei Hauptlinien nach 1750. Die Habsburger hatten mehr Erfolg auf der niedrigeren Ebene der Vergabe von Kanonikaten, womit sich auch Netzwerke gegenseitiger Begünstigung knüpfen und die prokaiserliche Tendenz der Reichskirche aufrechterhalten ließen.
Die Auffrischung lange erloschener Privilegien erwies sich als unmöglich. Andere Initiativen trugen eher Früchte. 1731 gelang die Einführung einer neuen Reichshandwerksordnung. Die Initiative zur Regulierung der Zünfte von 1672 war 1680 aufgegeben worden, neue Anläufe (zum Beispiel 1707) waren gescheitert.13 Der Aufstand der Augsburger Schuhknechte 1726 führte zu Forderungen des Stadtrats nach raschem Handeln. 1727 bat der Kaiser den Reichstag um Prüfung des Reichsgutachtens von 1672. Als er nach drei Jahren noch keine Antwort erhalten hatte, drohte er mit einem Erlass ohne vorherige Konsultation. Am 4. September 1731 wurde schließlich ein Kommissionsdekret ratifiziert, das im Wesentlichen auf dem Entwurf von 1672 beruhte, mit der wichtigen Ergänzung, dass reisende Gesellen nicht mehr in benachbarten Territorien Zuflucht suchen durften und alle Landesherren verpflichtet waren, Missetäter auszuliefern – die Augsburger Rebellen hatten sich durch Flucht nach Bayern dem Zugriff der Strafbehörden entzogen.
Auch die erfolgreichen Verhandlungen über eine neue Reichswährungsordnung zwischen 1732 und 1738 stehen für die anhaltenden Bemühungen um Reformen im Reich.14 Die endgültigen Regelungen wurden zwar nie formell publik gemacht, lieferten aber den Rahmen für regionale Vorschriften zwischen zwei oder mehr Herrschern sowie innerhalb und zwischen verschiedenen Kreisen.
Auch in den Kreisen selbst zeigte Karl VI. neues Engagement. Wegen der Militäreinsätze anderswo in Europa war der Kaiser zur Sicherung des Rheins auf die Vorderen Kreise angewiesen und pflegte daher behutsam die Beziehungen zu ihnen: Der schwäbische Kreis wurde hinsichtlich habsburgischer Territorien direkt involviert, andere durch Korrespondenz und Konsultation.15
Der bayerische Kreis war problematisch, weil der Kurfürst von Bayern dem Reich eher gleichgültig und bisweilen – im Bund mit Frankreich – offen feindselig gegenüberstand. Sein Mitoberhaupt, der Kurfürst von Salzburg, sorgte jedoch für Ausgleich. Als der bayerische Kreis 1727 eingeladen wurde, sich der Nördlinger Allianz zur Verteidigung gegen Frankreich anzuschließen, lehnte er ab; Karl Albrecht von Bayern schloss stattdessen gegen Subsidien ein Geheimabkommen mit Frankreich.16
Die anderen Kreise hingegen standen zum Reich, wobei die größte Loyalität gegenüber dem Kaiser meist die zeigten, die nicht von einer größeren Macht dominiert waren. Im schwäbischen Kreis hielt die kaiserliche Unterstützung der Thronfolge in Mömpelgard Württemberg bei der Stange, im Oberrheinkreis führten Bemühungen um eine Beilegung der Streitigkeiten zwischen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1678–1739) und Pfalz-Neuburg 1722 zu seiner Wahl zum Kreisoberst.17 Im fränkischen Kreis sorgten die Mitglieder selbst für Viabilität und Treue zum Kaiser, indem sie Brandenburgs Versuch abwehrten, durch Besetzung der Grafschaft Limpurg nach dem Erlöschen von dessen Herrscherlinie im Jahr 1713 Aufnahme in den Kreis zu finden. Auf einen Appell an den Reichshofrat hin erfolgte ein Urteil gegen Brandenburg, dem sich der König fügte, nachdem der Kaiser angekündigt hatte, es mit militärischer Gewalt durchsetzen zu lassen.18 1726 trugen die Kreismitglieder finanziell dazu bei, Bayreuth einer jüngeren Kulmbacher Nebenlinie und nicht Brandenburg zu übertragen, als das herrschende Hohenzollerngeschlecht erlosch.19
Die Übernahme der Spanischen Niederlande 1714 brachte den Habsburgern neue Einflussmöglichkeiten in Norddeutschland, besonders in den westfälischen und niedersächsischen Kreisen. Die Spanischen Niederlande bildeten offiziell immer noch den burgundischen Kreis, der allerdings seit dem Vertrag von Burgund 1548 von Verpflichtungen gegenüber dem Reich und von seiner Jurisdiktion befreit war. Unter spanischer Herrschaft hatten sie sich von einer Reichsregion zu einer Art selbstständigem Staat entwickelt und im 18. Jahrhundert fragte sich manch einer, ob sie überhaupt noch zum Reich gehörten.20 Vom genauen legalen Status der westlichen Bereiche von Flandern und Brabant abgesehen, grenzte das Herzogtum Luxemburg im Osten zumindest an Kernterritorien des Reichs.
Die dortige Präsenz der Habsburger und ihr Wille, die neuen Territorien vor Frankreich, den Niederlanden und den Ambitionen mächtiger Länder wie Brandenburg und Hannover zu schützen, machten den benachbarten westfälischen Kreis interessant. Umgekehrt wollten viele von dessen Mitgliedern die Vorherrschaft von Brandenburg-Preußen, das acht der Territorien im Kreis hielt, abschütteln.21 Im Mai 1715 setzten sich die minderen Herrscher in der Kreisversammlung gegen Brandenburg durch und beschlossen, ihre Selbstverteidigung durch eigene Truppen zu organisieren, anstatt für brandenburgische Streitkräfte zu bezahlen. Selbst die Äbtissin von Essen kündigte nun ihre Absprachen mit Berlin und stellte vierundvierzig Soldaten bereit.22 Im Dezember 1715 verpflichtete der Kaiser den Erzbischof von Lüttich, dem Kreis wieder beizutreten, den er 1713 verlassen hatte, um sich die Kosten für die gemeinsame Verteidigung zu sparen.
Weiter gestärkt wurde der habsburgische Einfluss dadurch, dass einige kleinere westfälische Grafschaften von österreichischen Dynastien wie Kaunitz und Sinzendorf beziehungsweise Familien wie den katholischen Grafen von Salm, Arenberg und Löwenstein, die zur Klientel der Habsburger zählten, ererbt worden waren.23 Einige davon, etwa die Grafen von Gronfeld, Aspremont-Linden und de Ligne, besaßen auch Ländereien in den Spanischen Niederlanden und dienten nun eben dem Kaiser und nicht mehr dem König von Spanien. Andere, wie die Grafen von Lippe, stärkten die kaiserliche Autorität durch regelmäßige Anrufung des Reichshofrats bei internen Konflikten. Zwar gingen wesentlich mehr Fälle ans Reichskammergericht, aber auch dessen Urteile wurden im Namen des Kaisers verkündet.24 Das Verhältnis zwischen dem Kaiser und dem Herrscherhaus von Lippe wurde durch dessen Erhebung in den Fürstenstand 1720 weiter gefestigt.25
Das übergreifende strategische Ziel der kaiserlichen Politik war, den Einfluss Brandenburgs zu begrenzen, nicht zuletzt durch Ausnutzung der Spannungen zwischen dessen Interessen an Kleve und Mark und den pfälzischen Ansprüchen auf Jülich und Berg, die bestanden, seit die zwei Dynastien diese Länder 1614 gemeinsam ererbt hatten. Andererseits gab es auch Bemühungen, Berlin nicht gänzlich zu verprellen. Im langwierigen Streit um die Grafschaft Tecklenburg etwa stellte sich der Kaiser letztlich auf die Seite von Friedrich Wilhelm I., der das Territorium 1729 vom Grafen von Bentheim erwerben konnte.26 Die Sicherung der Unterstützung des Kurfürsten für die Pragmatische Sanktion überwog alle Bedenken bezüglich der Rechte der Grafen von Bentheim und Solms, die seit dem 16. Jahrhundert Tecklenburg für sich reklamierten.27 In diesem Fall wurde das Urteil des Reichshofrats politischem Opportunismus und den dynastischen Interessen der Habsburger geopfert.
Im niedersächsischen Kreis war der habsburgische Einfluss weniger direkt; dort war der Kaiser wie eh und je auf Hannover angewiesen, um Brandenburgs Ambitionen zu bremsen. Auf österreichisch-hannoverschen Druck zog sich Brandenburg aus der Reichsstadt Nordhausen zurück, die es unter dem Vorwand des Schutzes gegen Sachsen seit 1703 besetzt hielt.28 Die kaiserliche Autorität fand jedoch ihre Grenzen im wachsenden Durchsetzungsvermögen Hannovers selbst, vor allem nach der Thronfolge in Großbritannien 1714. Der Versuch, Hannover durch Verzögerung der formellen Einsetzung in neu erworbene Gebiete wie Lauenburg, Hadeln sowie Bremen und Verden zu zügeln, machte die Sache nur noch schlimmer: 1722 erklärte Georg I., er werde seine neuen Ländereien behalten, »ob der Kaiser die Investitur bewilligt oder nicht«.29
Das Einschreiten des Reichshofrats in Mecklenburg (Kreis Niedersachsen) und Ostfriesland (westfälischer Kreis) zeigt Möglichkeiten und Hindernisse der Ausübung kaiserlicher Macht im Norden nach 1715 auf. In Mecklenburg verschärfte das tyrannische Gehabe des seit 1713 regierenden Herzogs Karl Leopold einen seit 1664 anhaltenden Disput über Steuern. Der Reichshofrat fällte eine lange Reihe von Urteilen gegen den Herzog, der sich indes mit Peter dem Großen verbündete, was die Durchsetzung erschwerte.30 Umso mehr war kaiserliches Einschreiten geboten.
Der Plan, Hannover mit der Exekution der Anweisungen des Hofs zu beauftragen, verzögerte sich, weil der preußische König beharrlich seine Mithilfe anbot und dies als sein Recht beanspruchte, weshalb der Reichshofrat umso hartnäckiger darauf bestand, ihn nicht zu beteiligen. 1719 schließlich marschierten Truppen aus Hannover und Wolfenbüttel in das Herzogtum ein und eine Kommission aus Hannover übernahm die Regierungsgeschäfte. Mehrere Jahre lang herrschte eine unbehagliche Pattsituation, da Karl Leopold von seinen verbliebenen Hochburgen Schwerin und Dömitz aus die Herrschaft wiederzuerlangen suchte, während die Besatzungstruppen die Hannoversche Kommission schützten, die von den meisten Territorialständen unterstützt wurde.
Die Kommission wurde schnell selbst zum Problem, weil sie Befürchtungen weckte, ihre Verlängerung könne zur Annexion des Herzogtums führen. Aufgelöst wurde sie erst nach dem Tod von Georg I. 1727; der Absetzung von Karl Leopold 1728 folgte dann die Einsetzung seines Bruder Christian Ludwig als Übergangsherrscher.31 Nun wurde Brandenburg-Preußen beauftragt, die Rechte des Adels zu garantieren, was einmal mehr der Reichshofrat bestätigte. Dies war ein klarer Versuch Österreichs, Brandenburg für die Pragmatische Sanktion zu gewinnen, gegen den Georg II., Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, und andere Fürsten protestierten, während die Mecklenburger Stände beklagten, dass keine dauerhafte territoriale Einigung erzielt worden war. Dass sich Karl Leopold 1733 zum Führer eines Bauernaufstands aufschwang, führte zum Eingreifen von Hannover, Wolfenbüttel und Brandenburg. Zur Deckung der Kosten dieses Schritts (und im Fall Hannovers der gesamten Affäre) reklamierten Hannover und Brandenburg Teile des Mecklenburger Territoriums für sich.
1735 gelang es Christian Ludwig (der bis 1756 regierte), seinen Bruder aus Schwerin zu vertreiben; Karl Leopold floh in den schwedischen Hafen Wismar, kehrte 1741 nach Dömitz zurück und lebte dort zurückgezogen bis zu seinem Tod 1747. Ironischerweise entwickelte Christian Ludwig, sobald er die Nachfolge seines Bruders angetreten hatte, ebenfalls tyrannische Züge. 1755 schritt schließlich Friedrich der Große ein und konnte den Konflikt beilegen, indem er die bereits 1701 von kaiserlichen Beratern empfohlenen Regelungen durchsetzte.32
In Ostfriesland wurde der ebenso langwierige Streit der Cirksena-Dynastie mit ihren Ständen verschärft durch die Verwicklung von Truppen aus den Niederlanden, Münster, Celle und Brandenburg vor 1700. Eine Phase relativer Ruhe und Prosperität endete mit einer Reihe von Naturkatastrophen nach 1715, die 1717 in einer Sturmflut gipfelte, bei der viele Seefestungen zerstört wurden. Im Zuge der folgenden Finanzkrise gingen Fürst Georg Albrecht (1708–1734) und sein Kanzler Enno Rudolph Brenneysen wegen deren Haushaltschaos gegen die Stände vor. Nicht ganz zu Unrecht warfen sie ihnen vor, das Land durch regelmäßige Inanspruchnahme fremder Militärhilfe in den Ruin getrieben zu haben. Dahinter stand eine kleine Gruppe von größtenteils Bürgern der Stadt Emden, die nach wie vor Althusius’ revolutionären Ideen folgte und eine despotische Oligarchie errichten wollte, der alle, auch der Fürst, untertan sein sollten.33
Während sich der Reichshofrat um eine Lösung bemühte, bewaffneten sich beide Seiten. Brandenburg-Preußen hielt zu den Ständen, weil diese den brandenburgischen Kurfürsten als Nachfolger der Cirksena anerkannten. Zur gewaltsamen Konfrontation kam es nur deswegen nicht, weil weder Brandenburg noch die Niederlande einen Krieg mit Österreich riskieren wollten. Karl ließ 1727 dänische Truppen zugunsten Georg Albrechts für Recht und Ordnung sorgen, die Rebellen behielten jedoch Emden und seine Umgebung unter Kontrolle. Dieses labile Gleichgewicht führte zu langwierigen Verhandlungen zwischen dem Reichshofrat, dem Fürsten, den Ständen, den Niederlanden und Brandenburg, die erst 1744 nach dem Tod von Carl Edzard (1734–1744) ein Ergebnis fanden. Die Dynastie erlosch und Ostfriesland ging an Friedrich den Großen, der die verfassungsrechtliche Situation von vor 1721 wiederherstellte.34
Letztlich scheiterten die kaiserlichen Initiativen in Mecklenburg und Ostfriesland. Aber wichtiger als das Ergebnis war wohl das rechtliche Verfahren als solches. Mecklenburg zeigte, dass Untertanen gegen ihre Fürsten klagen konnten, Ostfriesland belegte umgekehrt, dass Herrscher gegen übermächtige Untertanen vorgehen konnten. Die kaiserliche Justiz kam gegen die Tyrannei der Masse ebenso zur Geltung wie gegen den Despotismus Einzelner. In diesen speziellen Fällen scheint es nicht zu politischer Einflussnahme auf die Justiz gekommen zu sein, die Umsetzung der Entscheidungen hing indes zwangsläufig von den österreichischen Beziehungen zu den beteiligten Fremdmächten ab.
Die Tyrannei der mecklenburgischen Herzöge wurde beendet, die Beschwerden der ostfriesischen Fürsten endeten mit Carl Edzards Tod. Karl VI. hätte es nicht gefallen, dass in beiden Fällen Brandenburg profitierte, da er sich stets – und innerhalb der durch die Entfernung von Wien bedingten Grenzen einigermaßen erfolgreich – bemüht hatte, durch kaiserliche Rechtsprechung einen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Ambitionen der großen Regionalmächte zu schaffen.