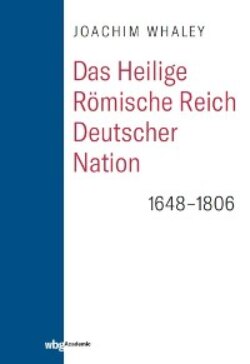Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 22
Оглавление8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte
Die Fürstbischöfe und Prälaten der Reichskirche waren die natürlichsten Verbündeten des Kaisers im Reichstag, ihre Stellung ab 1648 durch Reichsgesetze gesichert. Die vierundzwanzig Fürstbistümer und sechsundzwanzig reichsunmittelbare Abteien bildeten eine Schlüsselmacht im Rheinland (wegen der Kette von Bistümern am linken Ufer von Chur und Konstanz bis Trier und Köln gern als »Pfaffengasse« bezeichnet), in Süd- und Mitteldeutschland sowie in Westfalen. Die Fürstbistümer waren vom Adel dominierte Institutionen mit Kurwürde, meist besetzt mit Reichsrittern oder Nachfahren von Grafen. Auch die von ihnen Gewählten entstammten fast immer dem Hochadel, entweder Dynastien oder Fürstenhäusern. Die Habsburger hatten versucht, ein Netzwerk von Bistümern mit Familienangehörigen zu besetzen, aber ab den 1660er Jahren erforderte der Mangel an männlichem Nachwuchs andere Strategien.
Die erfolgreichste Dynastie in der Reichskirche waren die bayerischen Wittelsbacher. Ihre jüngeren Söhne amtierten von 1583 an zwei Jahrhunderte lang als Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln, zudem beherrschten sie eine Reihe kleinerer Bistümer in Westfalen und Nordwestdeutschland. Ihr größter Pfründensammler, Clemens August (* 1700, † 1761), vereinte die Ämter in Münster, Paderborn, Köln, Hildesheim und die Würde eines Hochmeisters des Deutschen Ordens auf sich.1 Die Macht der Wittelsbacher in der Reichskirche dehnte Bayerns Einfluss bis in den Norden aus; das machte die Beziehungen zu Österreich besonders heikel, vor allem angesichts der bayerischen Neigung, sich durch Allianzen mit Frankreich der habsburgischen Dominanz zu entziehen.
Da es keine Kandidaten aus seiner eigenen Familie gab, setzte Leopold oft auf Verwandte seiner Frau Eleonore von Pfalz-Neuburg. Die Dynastie hielt wichtige Territorien am Niederrhein und erbte 1685 die Pfalz. Kurfürst Philipp Wilhelms vierter Sohn, Franz Ludwig (* 1664), wurde Hochmeister des Deutschen Ordens, Bischof von Breslau, Kurbischof von Trier und schließlich Kurbischof von Mainz.2 Später spielte das Haus Lothringen eine ähnliche Rolle als quasi adoptierte Verwandtschaft der Habsburger.3
Parallel zu den Dynastien Pfalz-Neuburg und Lothringen wirkte auch die Familie Schönborn zugunsten Habsburgs und besetzte über mehrere Generationen wichtige Positionen in der Reichskirche.4 Ursprünglich ein Ministerialgeschlecht mit Ämtern in Mainz und Trier, schafften sie den Durchbruch mit der Wahl von Johann Philipp von Schönborn zum Erzbischof von Kurmainz 1647.5 Es folgte die Erhebung auch seiner Verwandten; der Dynastie entstammten im folgenden Jahrhundert ein weiterer Kurfürst von Mainz und eine Reihe kirchlicher und kaiserlicher Würdenträger. Obwohl Johann Philipp anfangs gemeinsam mit Frankreich gegen den habsburgischen Einfluss im Reich arbeitete, wurde er nach der Auflösung des Rheinischen Bundes 1668 ein verlässlicher Mitstreiter des Kaisers und begründete damit eine Familientradition für folgende Generationen.6
Während Leopolds Herrschaft wurden kaiserliche Bevollmächtigte zu sämtlichen kirchlichen Wahlen entsandt, selbst in so entlegene Gegenden wie Lüttich und das protestantische Bistum Lübeck, wo nur Angehörige des Hauses Holstein-Gottorp gewählt werden konnten. Auch in dieser Hinsicht hatte der Dreißigjährige Krieg die Habsburger in Berührung mit Gebieten des Reichs gebracht, mit denen sie zuvor wenig zu tun hatten, und ihnen Kenntnisse der örtlichen Bedingungen sowie Kontakte verschafft, auf die sie bauen konnten. Der Kaiser hatte kein formelles Vetorecht, aber seine Gesandten waren oft in der Lage, die Wahl von Gegnern der Habsburger zu verhindern. Ihre Anwesenheit demonstrierte die imperiale Dimension derartiger Wahlen und ein damit verbundener entscheidender Teil des Zeremoniells war die Verleihung der Regalien an den neuen Amtsinhaber. Sie erlaubte einem neu gewählten Fürstbischof, noch vor der päpstlichen Bestätigung zum Abschluss der Wahl die weltliche Herrschaft über sein Land anzutreten, und diente dem Kaiser als Druckmittel gegen unwillkommene Kandidaten. 1688 informierte der kaiserliche Bevollmächtigte bei der Wahl des neuen Kölner Erzbischofs das Domkapitel, im Fall der Wahl des französischen Kandidaten Wilhelm Egon von Fürstenberg werde ihm der Kaiser die Kurwürde verweigern.7 Fürstenbergs Kandidatur war damit erledigt.
Im Fall Lübecks hingegen stieß der Einfluss der Habsburger an seine Grenzen, da die Niederländische Republik entschlossen war, ihre Ostgrenze zu sichern. Nach den katastrophalen Erfahrungen mit dem kriegslüsternen Bischof Bernhard von Galen († 1678) nahmen die Niederländer regen Anteil an allen Wahlen in niederrheinischen und westfälischen Bistümern.8 1706 gelang es ihnen sogar, den kaiserlichen Kandidaten, Karl Joseph von Lothringen, Bischof von Osnabrück und Erzbischof von Olmütz, auszuschalten und die Wahl von Franz Arnold Josef Wolf von Metternich durchzusetzen, der bis 1718 regierte.9 Solche Fehlschläge sowie gelegentliche Konflikte zwischen einzelnen Fürstbischöfen und der Krone unterstrichen, dass der Kaiser eher Einfluss auf als Kontrolle über die Reichskirche hatte.
Diesen machte er auch in den Domkapiteln geltend, indem er auf das alte Recht zurückgriff, nach jeder auf die Krönung eines neuen Kaisers erfolgten Kirchenstiftung den ersten neuen Domherrn oder Pfründner zu nominieren.10 Der kaiserliche Einfluss auf Abteien und nichtbischöfliche Stifte war eher indirekt. Viele Prälaten waren einfache Bürger und daher nicht in die auf den Kaiser ausgerichteten aristokratischen Netzwerke eingebunden, die die Domkapitel beherrschten.11 Andererseits waren sie wie Reichsstädte und Reichsritter auf den Schutz des Kaisers angewiesen.
Die starke Konzentration solcher Stiftungen in Schwaben bildete eine weitere Verbindung mit der Krone. Nach dem Erlöschen der Tiroler Linie der Habsburger 1665 fielen die zersplitterten schwäbischen und Breisgauer Territorien Vorderösterreichs, die seit 1651 von Freiburg aus regiert worden waren, an Leopold, der somit als Territorialherrscher einer Region, in der der kaiserliche Einfluss traditionell stark war, ins Reich »zurückkehrte«.12 Das Verhältnis zwischen Kaiser und schwäbischen Prälaten war nun in der Tat ein anderes als im 16. Jahrhundert. Damals waren sie bereit gewesen, ungeheure Geldmengen vorzustrecken, die nie zurückgezahlt wurden. Nun blieben die Prälaten ohne entsprechende Gegenleistungen eher zurückhaltend, und wenn sie sich auf anspruchsvolle Bauvorhaben einließen, was viele von ihnen nach 1648 taten, trugen sie finanziell oft gar nichts bei.13 Dennoch stärkten diese kleinen kirchlichen Territorien die religiöse und kulturelle Präsenz der Reichskirche. Im Reichstag trugen die schwäbischen und rheinländischen Prälaten (also alle, die nicht dem schwäbischen Kollegium angehörten) stets zuverlässig die kaiserliche Politik mit. Ihr informeller Koordinator und Sprecher im Reich war der schwäbische Abt von Weingarten, der gewöhnlich das schwäbische Kollegium leitete.
Eine kirchliche Institution verband direkt die Sphären von Kirche, Reichsrittern und den österreichischen Erblanden mit einem Führer, der entweder Habsburger oder ein Kandidat des Kaisers war14: Der Deutsche Orden mit seinem Hauptquartier im fränkischen Mergentheim umfasste die acht Vogteien des Reichs, die die Säkularisierung des Herzogtums Preußen und anderer norddeutscher Besitzungen überlebt hatten. Den Verlust der Vogtei Utrecht im Dreißigjährigen Krieg glichen Landkäufe in Mähren und Schlesien aus, wodurch zu den existierenden Ländereien in Österreich und Besitzungen in Wien (insbesondere dem deutschen Haus hinter dem Stephansdom) eine neue Basis auf österreichischem Territorium entstand. Die Bestätigung der Besitzungen des Ordens 1648 sicherte das Überleben seines verstreuten Patrimoniums und des Bundes von Priestern und Rittern, die es besaßen. Die fest katholische Ausrichtung wurde nur in Hessen aufgeweicht, wo der Landgraf auch reformierte und lutherische Adlige zum Orden zuließ. Die kaisertreue Haltung änderte sich dadurch jedoch nicht, sondern wurde noch gestärkt durch die Rolle des Ordens im Kampf gegen die Türken nach 1663.
Im Allgemeinen war das Verhältnis der Krone zur Reichskirche geprägt von der Rückbesinnung auf traditionelle Vorrechte und guter Kommunikation mit den Fürsten und fürstlichen Institutionen. Das galt auch für die Beziehungen zu den Reichsstädten. Bezeichnenderweise ließ Leopold den alten Brauch wieder aufleben, kaiserliche Abgesandte in die Städte zu schicken, um Huldigungen zu seiner Krönung entgegenzunehmen.15 Dies untermauerte die traditionelle kaiserliche Schirmherrschaft über die urbanen Kommunen und bot eine willkommene Gelegenheit, ansehnliche finanzielle Tribute einzufahren. Vor allem jedoch trugen die Huldigungsakte zur Begründung eines Netzwerks von kaisertreuen Kommunen bei, das sich über das ganze Reich erstreckte.16
Gleichzeitig sorgte die Ausweitung der Tätigkeiten des Reichshofrats dafür, dass kaiserliche Gesandte immer häufiger in die internen Konflikte und finanziellen Krisen der Städte in den hundertfünfzig Jahren nach 1648 involviert wurden. Selbst eine so weit von Wien entfernte Stadt wie Hamburg, dessen Status als Reichsstadt überhaupt erst 1768 formell bestätigt wurde, beging kaiserliche Geburten, Hochzeiten, Krönungen und Todesfälle oft mit kostspieligen Zeremonien und ließ seine inneren Turbulenzen im späten 17. Jahrhundert von 1708 bis 1712 durch eine kaiserliche Kommission klären.17
Kirche, Ritter und Städte bildeten die angestammte Klientel des Kaisers im Reich. Der traditionelle geografische Schwerpunkt im Süden und Südwesten galt nach wie vor, aber das Netz von Kontakten reichte nun bis zur Nordsee und an die baltische Küste. Ebenso blieb der Katholizismus ein wichtiges Band zwischen der Krone und manchen Netzwerken, aber weder protestantische Adlige noch protestantische Städte wurden aus religiösen Gründen ausgeklammert.
Anmerkungen
1 Wilson, Reich, 203; Weitlauff, Reichskirchenpolitik.
2 Reinhardt, »Reichskirchenpolitik«.
3 Wolf, Reichskirchenpolitik, 296–303; vgl. auch S. 346.
4 Schraut, Haus Schönborn, 15–19; Forster, Catholic Germany, 106f.
5 Gotthard, »Friede«, 21–44.
6 Vgl. S. 23ff.
7 Klueting, Reich, 91f.
8 Vgl. S. 54, 272, 347.
9 Duchhardt, Altes Reich, 64f.; Aretin, Altes Reich II, 185ff.; Press, »Großmachtbildung«, 141; Klueting, Reich, 92.
10 Press, »Kaiserliche Stellung«, 63; Klueting, Reich, 91.
11 Neuhaus, Reich, 30f.; Reden-Dohna, »Problems«; Braunfels, Kunst III, 353–422, untersucht eine Auswahl solcher Stiftungen. Die Institutionen für Frauen, meist im rheinländischen Kollegium, waren in der Regel aristokratisch.
12 Press, »Schwaben«, 54–58; Quarthal, »Vorderösterreich«,44–47.
13 Reden-Dohna, Reichsstandschaft, 36f.
14 Evans, Making, 280f.; Schindling und Ziegler, Territorien VI, 224–228; Boockmann, Deutscher Orden, 229ff., 291; von 1591 bis 1664 waren alle Hochmeister Habsburger; Johann Kaspar von Ampringen (aktiv 1664–1684) war ein treuer Diener der Habsburger aus einer Breisgauer Familie, seine Nachfolger bis 1806 zwei Pfalz-Neuburger, ein bayerischer Wittelsbacher, ein Fürst von Lothringen und weitere Habsburger; vgl. zu Ampringen BWDG II, 1316f.
15 Aretin, Altes Reich I, 105–112.
16 North, »Integration«.
17 Whaley, Toleration, 19, 179–185; Berbig, »Kaisertum«.