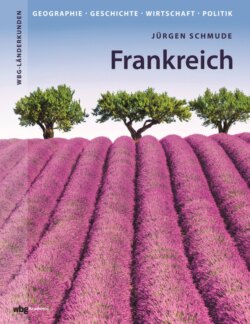Читать книгу Frankreich - Jürgen Schmude - Страница 11
1.1 Zur Territorialentwicklung des französischen Staates
ОглавлениеDie Beschäftigung mit dem französischen Staat und der geschichtlichen Entwicklung Frankreichs führt zwangsläufig zur Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Zentralismus, denn in nahezu allen Bereichen spielen zentralistische Strukturen eine wichtige Rolle: Dies gilt beispielsweise für die Entwicklung des französischen Städtenetzes ebenso wie für die Persistenz räumlicher Disparitäten, etwa im französischen Verkehrsnetz. Um das Phänomen des Zentralismus einordnen zu können, ist es notwendig, sich mit der Entwicklung des französischen Territorialstaates zu beschäftigen. Dieser historischräumliche Prozess wiederum ist für eine Reihe anderer Phänomene wie die räumliche Verteilung der regionalen Minderheiten (vgl. hierzu 2.3) mitverantwortlich. Für das Verständnis der Territorialentwicklung des französischen Staates ist ein Blick auf einige wesentliche geschichtliche Ereignisse hilfreich (vgl. Tab. 1.1).
Auch wenn die Begründung für einige kulturlandschaftsprägende Faktoren in Frankreich zeitlich noch weiter zurückliegt (vgl. Pletsch 2003: 69), kann die Kapetinger-Monarchie unter König Hugo Capet ab dem Jahre 987 als Keimzelle des späteren Frankreichs und als Ausgangspunkt des französischen Nationalstaates angesehen werden. Sie ist eine Folge der Teilung des Fränkischen Reiches durch den Vertrag von Verdun im Jahre 843. Die Île-de-France mit Paris und Orléans bildet die Krondomäne, die von den Nachfolgern Hugo Capets konsolidiert wird und über mehrere Generationen den Kapetingern gehört (987–1328).
Mit Beginn des 12. Jahrhunderts kommt es zu einer Ausweitung des Machtbereiches und einer räumlichen Ausdehnung des Reiches (z.B. durch den Einbezug der Normandie ab dem Jahr 1204). Der Einfluss Englands wird vornehmlich unter Philipp II. August (1180–1223) deutlich zurückgedrängt. Der Sieg über die mit dem deutschen Kaiser verbündeten Engländer bei Bouvines (1214) hat eine weitere territoriale Ausweitung der Krondomäne zur Folge und gilt als wichtige Etappe für das Entstehen eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls (vgl. Grosse/Lüger 2008: 6). In der Folgezeit verstärkt sich die vorherrschende Stellung der königlichen Zentralgewalt in Paris.
Neben den territorialen und administrativen Einigungsprozessen sind religiöse Auseinandersetzungen von großer Bedeutung. So wird beispielsweise durch die Albingenserkriege bzw. Kreuzzüge (1209–1229) die Bewegung der Albingenser (= Katharer) zerschlagen, ihre Anhänger werden weitgehend ausgerottet, und der größte Teil des Languedoc wird französisch (ab dem Jahr 1229). Somit kommt es zur Etablierung des nordfranzösischen Königreiches im Süden, der sprachlich und kulturell deutliche Unterschiede zum Norden aufweist, die teilweise bis heute fortbestehen. Diese Entwicklung wird oft als wichtiger Schritt zur Herausbildung einer gesamtfranzösischen Nation betrachtet (vgl. Köller/Töpfer 1978: 96f.). Die Machtansprüche der französischen Krondomäne wirken also bereits im 13. Jahrhundert einer feudalen Zersplitterung Frankreichs entgegen.
In der Folgezeit wird dieser Machtanspruch immer wieder durch Kriege und Auseinandersetzungen in Frage gestellt. So ist der Konflikt mit England im Hundertjährigen Krieg (1339–1453) eine ernsthafte Bedrohung für die Herrschaft des französischen Königs. Nach dem Ende des Krieges gelingt es jedoch, aufbegehrende Territorialfürsten unter die Autorität der französischen Könige zu zwingen (etwa unter Karl VII. oder vor allem unter Ludwig XI.) und das Königreich territorial weiter auszudehnen (u.a. die Provence ab dem Jahr 1481 oder die Bourgogne ab dem Jahr 1477). Schließlich wird unter König Franz I. (1515–1547) ein zentralistischer Beamtenapparat aufgebaut, und im Jahr 1539 mit dem Edikt von Villers-Cotterêts wird Französisch anstelle von Latein Urkundensprache im gesamten damaligen Machtbereich.
Tab. 1.1 Ausgewählte geschichtliche Ereignisse mit Bedeutung für die Entwicklung des Territorialstaates
Ab Mitte des 16. Jahrhunderts sowie im 17. Jahrhundert wird die Monarchie auf Grund von Glaubenskriegen (z.B. Hugenottenkriege 1615/16 und 1621/22) und durch Revolten des Adels (z.B. Aufstand von Heinrich von Montmorency im Languedoc im Jahr 1632) nochmals gefährdet, doch nicht zuletzt aufgrund brutaler Methoden von Kardinal Richelieu als Minister im Staatsrat (1624–1642) setzt sich die Monarchie durch. Der Widerstand des Protestantismus wird gebrochen und die Aristokratie unterworfen. Intendanten als direkte Kontroll- und Verwaltungsinstanzen des Königs stärken fortan den königlichen Machtapparat in den Provinzen. Die nationale Einheit und die königliche Autorität finden ihren Höhepunkt im Absolutismus unter Ludwig XIV. (1643–1715). Gemeinsam mit seinem Finanzminister Colbert setzt der Monarch eine mit allen Kompetenzen ausgestattete Zentralverwaltung ein. Dieser durch die Staatsautorität repräsentierte Absolutismus führt dazu, dass ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber jeder Form von Dezentralisierungsbestrebung entsteht, das noch Jahrhunderte andauern wird. Die territoriale Ausdehnung ist zur Zeit des vorrevolutionären Absolutismus des ancien régime weitgehend abgeschlossen, in der Folgezeit kommt es nur noch vereinzelt zu einer territorialen Ausweitung (z.B. Savoie ab dem Jahr 1860).
Abb. 1.2 Territorialentwicklung Frankreichs
Tab. 1.2 Fläche (in km2) und Einwohnerzahl der französischen Kolonien und ihres Mutterlandes im Jahr 1914
Mit der Französischen Revolution im Jahr 1789 geht eine weitere Stärkung des Machtzentrums in Paris einher. Sie führt nicht zur Abschaffung der zentralistischen Strukturen, denn sie ist keine Revolution gegen den Zentralismus, sondern gegen die Privilegierung von Adel und Geistlichkeit. Die zuvor geltende Verwaltungsstruktur des Landes in Provinzen wird durch die Einführung von 83 flächenmäßig etwa gleich großen Départements ersetzt. Die Jakobiner bzw. der Nationalkonvent verteidigen und festigen den Zentralstaat, der im Jahr 1792 in die Erste Republik (1792–1804) übergeht. Diese so geschaffenen Verwaltungsstrukturen bleiben bis heute weitgehend erhalten, wenngleich sich die Anzahl der Départements von damals 83 auf heute 101 erhöht hat (überwiegend durch Teilung von Départements). Auch im Ersten Kaiserreich unter Kaiser Napoléon Bonaparte (1804–1815) wird die zentralistische Struktur eher gestärkt denn geschwächt, da er als Kontrollorgan der Zentralgewalt in Paris Präfekte in den Départements einsetzt. Sowohl in der Zweiten Republik (1848–1852) als auch im Zweiten Kaiserreich (1852–1870) bleiben diese Strukturen bestehen.
Ab dem Jahr 1830 und während der Dritten Republik (1870–1940) kommt es auf Grund der Vergrößerung des französischen Kolonialreiches zu erheblichen territorialen Ausweitungen (z.B. in Nordund Äquatorialafrika, Madagaskar). Außerdem übernimmt Frankreich in dieser Zeit für einige heute selbständige Staaten das politische Mandat (z.B. Syrien, Libyen, Togo und Kamerun). Im Jahr 1870 übertrifft das französische Kolonialreich flächenmäßig bereits das Mutterland und Frankreich ist bis zum Ersten Weltkrieg eine der größten europäischen Kolonialmächte. Im Jahr 1914 umfasst die Fläche des Kolonialreiches mehr als das Zwanzigfache des europäischen Mutterlandes. Bevölkerungsmäßig fällt das Gewicht der Kolonien weit geringer aus (vgl. Tab. 1.2). Die politisch-zentralistischen Strukturen werden vom europäischen Mutterland auf das gesamte Kolonialgebiet übertragen, das nur in geringem Maße tatsächlich auch von Franzosen besiedelt und bewirtschaftet wird. Ihre Präsenz konzentriert sich meist auf wenige Städte. Bis zum Jahr 1938 wächst das französische Kolonialreich weiter und umfasst eine Fläche von 12,132 Mio. km2 mit einer Bevölkerung von 69,6 Mio. Einwohnern, von denen nur 2,5 Mio. Einwohner französische Staatsbürger sind (vgl. Grüner/Wirsching 2003: 112).
Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt das empire colonial zu zerfallen und es findet eine Entkolonialisierung (décolonisation) statt. Während der Vierten Republik (1946–1958) werden französische Kolonien zunächst in die Union Française umgewandelt. Es kommt zu einer Reihe von Kriegen und Konflikten (z.B. Indochina 1946; Algerien 1954). Insbesondere in der Fünften Republik (ab 1958) werden eine Vielzahl ehemaliger Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen (z.B. 1960 Äquatorialafrika und Madagaskar, 1962 Algerien). Dennoch besteht gerade auf wirtschaftlichem Gebiet noch lange Zeit eine hohe Abhängigkeit einzelner ehemaliger Kolonien von Frankreich (etwa im Bereich der afrikanischen Franc-Zone). Ausnahmen in dieser Entwicklung sind die Überseegebiete La Réunion im Indischen Ozean, die karibischen Inseln Guadeloupe und Martinique sowie Guyane auf dem südamerikanischen Kontinent. Diese vier ehemaligen Kolonien werden am 19. März 1946 durch das Gesetz No 46–451 verfassungsrechtlich zu départements d’outre-mer (Überseedépartements) erklärt (départementalisation) und sind seitdem gleichberechtigt mit den europäischen Départements. Als letztes Überseegebiet wird das im Indischen Ozean gelegene, zur Inselgruppe der Komoren gehörende Mayotte im April 2011 Teil des französischen Staates. Damit besteht Frankreich aus dem europäischen Mutterland (France métropolitaine) mit 96 Départements sowie fünf Überseedépartements (DOMs). Die Fläche des europäischen Teils ist im Jahr 2018 mit 543 940 km2 deutlich größer als die Fläche der DOMs (89 167 km2). Im Jahre 2018 beträgt die Einwohnerzahl von France métropolitaine rund 65 Mio., in den DOMs leben rund 2,2 Mio. Einwohner (vgl. Tab. 1.3).
Tab. 1.3 Fläche (in km2) und Einwohnerzahl des europäischen Frankreichs (France métropolitaine) und seiner Überseedépartements (DOMs) im Jahr 2018
Daneben gehören noch einige Überseegebiete zu Frankreich, die einen Sonderstatus haben. Im Einzelnen sind dies:
Abb. 1.3 Das Kolonialreich Frankreichs im Jahr 1937
▪ Collectivité d’outre-mer (COM): Diese Gebiete haben keinen einheitlichen Status, verfügen aber über weitreichende Autonomie. So gelten französische Gesetze in den COM nur nach ausdrücklicher Zustimmung. Die COM haben in etwa einen den Départements oder Regionen entsprechenden Rang und entsenden daher auch Abgeordnete in die französische Nationalversammlung. Bevor Mayotte im Jahr 2011 ein Überseedépartment wird, ist es ebenfalls eine COM. Als COM gelten im Jahr 2015:
- St. Martin,
- St. Barthélemy,
- St. Pierre et Miquelon,
- Wallis und Futuna,
- Französich-Polynesien.
St. Martin und St. Barthélemy liegen in der Karibik (Kleine Antillen) und sind bis zum Jahr 2007 Teil des Überseedépartements Guadeloupe. Durch ein Referendum vom 7. Dezember 2003 entscheidet sich die Bevölkerung beider Inseln mehrheitlich (95,5 % auf St. Barthélemy; 76,2 % auf St. Martin) für eine größere Unabhängigkeit von Frankreich und einen Wechsel vom département d’outre-mer zur collectivité d’outre-mer. St. Martin gehört weiterhin zur Europäischen Union, St. Barthélemy ist lediglich assoziiertes EU-Mitglied. Beide COM haben den Euro als Währung. Die Inseln St. Pierre et Miquelon liegen vor der kanadischen Ostküste bei Neufundland. Sie gehören nicht zur Europäischen Union, haben als Währung aber ebenfalls den Euro. Wallis und Futuna sowie Französisch-Polynesien sind Inseln im südlichen Pazifik. Beide COM gehören nicht zur Europäischen Union und haben den CFP (Franc de colonies françaises du Pacifique) als Währung.
▪ Collectivité sui generis (CSG): In dieser Kategorie befindet sich im Jahr 2015 nur Neukaledonien (Nouvelle Calédonie), das nach den Artikeln 76 und 77 der französischen Verfassung über einen Sonderstatus verfügt. Bis zum Jahr 2019 sollen die Bürger von Neukaledonien eine Abstimmung über ihre Unabhängigkeit von Frankreich durchführen. Die CSG ist mit zwei Vertretern in der Nationalversammlung vertreten, Währung ist der CFP.
▪ Terres australes et antarctiques françaises (TAAF): Hierbei handelt es sich überwiegend um Inseln im Indischen Ozean und Antarktisgebiete (z.B. die Inseln Amsterdam, St. Paul, der Kerguelen-Archipel oder die Crozetinseln), die aber nicht dauerhaft bewohnt sind. Diese Gebiete gehören nicht zur EU und sind nicht in der Nationalversammlung vertreten. Währung ist aber dennoch der Euro.
▪ Île Clipperton: Die Insel, im Pazifik rund 1000 km südwestlich von Mexiko liegend, kann keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden. Sie ist französisches Staatseigentum und gehört seit dem Jahr 2007 nicht mehr zum Hoheitsgebiet von Französisch-Polynesien, sondern wird direkt von dem für die Überseegebiete zuständigen Minister der französischen Regierung verwaltet. Die Insel ist nicht dauerhaft bewohnt und darf aus Gründen des Naturschutzes nur zu wissenschaftlichen Zwecken betreten werden.