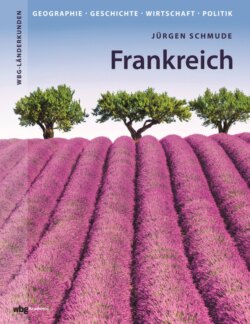Читать книгу Frankreich - Jürgen Schmude - Страница 20
1.4 Beispiel der raumprägenden Wirkung des Zentralismus: Das Eisenbahnwesen
ОглавлениеDie frühe Konsolidierung einer politisch mächtigen Zentrale, die Idee eines zentralistisch organisierten Staates und die periphere Lage der übrigen Ballungsgebiete sind für die räumlichen Strukturen des französischen Verkehrswesens von großer Bedeutung. Der in der Folge ausgebildete étoile parisienne, d.h. die sternenförmig auf Paris zulaufenden Verkehrsadern, werden nicht nur vom Straßennetz gebildet, vielmehr bündeln sich in diesen Achsen verschiedene Verkehrsadern bzw. -träger: Nationalstraßen, Autobahnen, Eisenbahn- und Flugnetz sind primär radial angelegt. Transversale Verkehrslinien, z.B. zwischen Regionalzentren oder zentralen Orten unterer Ordnung, spielen lange Zeit eine nur unbedeutende Rolle. Sichtbar wird diese Ausrichtung auf Paris bereits durch das napoleonische Straßennetz Anfang des 19. Jahrhunderts (vgl. Abb. 1.13). Ursache ist der Anspruch, dass jedes Département in kürzester Zeit von Paris aus erreichbar sein soll (und umgekehrt die Präfekten aus den Départements schnell Paris erreichen sollen). Entsprechend findet ein systematischer Ausbau des sekundären Straßennetzes erst später statt. Dieses ist im Zuständigkeitsbereich der Départements und Kommunen angesiedelt und daher verläuft der Ausbau regional sehr unterschiedlich. Die Leistungsfähigkeit des sekundären Straßennetzes ist damit von Beginn an stark eingeschränkt (vgl. Pletsch 2003: 232f.).
Die durch das Straßennetz angelegte Struktur wird durch die neuen Verkehrsträger verstärkt und verfestigt. Durch die erhöhte Geschwindigkeit und größeren Transportkapazitäten wird eine immer schnellere und direktere Anbindung des restlichen Frankreichs an die Hauptstadt Paris erreicht. Auch das Autobahnnetz des 20. Jahrhunderts ist eindeutig auf Paris ausgerichtet und verstärkt das räumliche Grundmuster im Verkehrswesen (vgl. Brücher 1992: 78ff.). Dagegen warten Regionalzentren, wie beispielsweise Straßburg und Mülhausen, obwohl sie nicht weit voneinander entfernt sind und die natürlichen Voraussetzungen im Rheintal es auch erlauben würden, bis heute auf die Fertigstellung einer durchgehenden Autobahn (A35). Ganz typisch für die hier skizzierte, auf Paris ausgerichtete Entwicklung des Verkehrswesens ist das Beispiel der französischen Eisenbahn.
Frankreich hat bereits sehr früh eine Personenbeförderung mit der Eisenbahn: Schon im Jahr 1831 werden zwischen St. Etienne und Lyon Passagiere befördert (zum Vergleich: Die erste Eisenbahn in Deutschland bedient die Strecke von Fürth nach Nürnberg im Jahr 1835). Ausgangspunkt ist der mit der Eisenbahn vorgenommene Steinkohletransport. Auch das französische Eisenbahnnetz wird auf einer gesetzlichen Grundlage aus dem Jahr 1842, die auf Planungen von Baptiste Alexis Victor Legrand aus dem Jahr 1838 zurückgeht, sternförmig angelegt. Der Ziel- bzw. Ausgangspunkt Paris erhält sechs Kopfbahnhöfe, von denen der étoile parisienne das übrige Frankreich erschließt. Die Anlage von sechs Kopfbahnhöfen basiert auch auf militärstrategischen Überlegungen, denn so wird kein zentrales Angriffsobjekt geschaffen. Zudem werden die französischen Eisenbahnen im 19. Jahrhundert noch von sechs konkurrierenden, privaten Eisenbahngesellschaften betrieben.
Im Zeitraum von 1878 bis 1914 wird das radial auf Paris ausgerichtete Eisenbahnnetz durch zahlreiche Querverbindungen ergänzt, so dass alle Orte mit einer sous-préfecture (Hauptort eines arrondissement) in das Netz eingebunden werden. Die Länge des französischen Eisenbahnnetzes wächst bis zum Ersten Weltkrieg auf knapp 40.000 km an. Zum 31.8.1937 wird dann durch den Zusammenschluss von vier privaten und zwei staatlichen Eisenbahngesellschaften die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF (Société Nationale de Chemins de Fer Français) gegründet, an der der französische Staat eine Beteiligung von 51 % hält und 49 % im Besitz der Aktionäre der ehemals privaten Gesellschaften verbleiben. Diese Konstellation wird für 45 Jahre gesetzlich fixiert, im Jahr 1982 geht die SNCF vollständig in staatlichen Besitz über.
Abb. 1.13 Hauptstraßennetz im Jahr 1911
Tab. 1.15 Entwicklung des französischen Eisenbahnnetzes (in km) von 1870 bis 2016
Abb. 1.14 TGV im Courtine Gare TGV in Avignon
Abb. 1.15 Erreichbarkeit von Paris mit der Eisenbahn im Oktober 2016
Mit dem Aufkommen des Individualverkehrs als Massentransportmittel erwächst der Eisenbahn ein Konkurrent, der sie vor Rentabilitätsprobleme stellt. So kommt es bereits ab dem Jahr 1933 wieder zu Stilllegungen von Nebenstrecken (erste Stilllegungswelle), wobei es sich hierbei überwiegend um Schmalspurbahnen handelt. Gravierende Nachteile dieser Nebenstrecken sind die geringe Reisegeschwindigkeit (fehlende Modernisierung) bzw. die hieraus resultierenden vergleichsweise langen Reisezeiten. So dauert die von Bordeaux nach Lyon überwiegend über Nebenstrecken (chemin de fer secondaire) verlaufende Bahnreise (639 km) im Jahr 1938 noch 12 Stunden und 5 Minuten, während für die erheblich weitere Strecke von Bordeaux nach Paris (1093 km) damals eine Reisezeit von „nur“ 10 Stunden und 50 Minuten benötigt wird (vgl. Brücher 1992: 81).
Die Rentabilitätsprobleme auf den Nebenstrecken bestehen auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter und es kommt insbesondere ab den 1960er Jahren zu einer zweiten Stilllegungswelle. So schrumpft die Länge des französischen Eisenbahnnetzes bis auf etwa 28.000 km im Jahr 2016. Diese Reduzierung des Streckennetzes geht vor allem zu Lasten von Nebenstrecken, wodurch die peripheren, ländlichen Räume in Frankreich weiter benachteiligt werden. Gleichzeitig investiert der Staat in ehrgeizige Prestigeobjekte der Bahn, mit denen auch die technologische Leistungsfähigkeit des Landes unterstrichen werden soll. So erzielt die Gleichstromlokomotive BB 9004 im März 1955 mit 331 km/h einen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge, der in Frankreich erst 26 Jahre später vom TGV (train à grande vitesse) verbessert wird.
Auch der TGV (vgl. Abb. 1.14) ist ein Prestigeprojekt des französischen Staates, für den die Regierung Ende des Jahres 1970 den Entwicklungsauftrag vergibt. Im Jahr 1978 ist der erste Prototyp entwickelt, im Februar 1981 erzielt der TGV PSE 16 mit 380 km/h auf der Strecke Paris – Lyon einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge. Im September 1981 geht der TGV auf dieser Strecke in den regulären Betrieb und verzeichnet ein Jahr nach Inbetriebnahme bereits eine Auslastung von über 60 %.
Mit der Einführung des Hochgeschwindigkeitszuges TGV werden die zentral-peripheren Disparitäten der Bahnversorgung weiter verschärft und dies betrifft selbst bis dahin relativ gut ins Eisenbahnnetz eingebundene Städte. So verbindet die erste Trasse des TGV seit dem Jahr 1981 die Hauptstadt Paris mit Lyon. Die direkte Trassenführung verkürzt die Fahrstrecke für den TGV-Sud-est auf 435 km gegenüber 512 km auf der herkömmlichen Strecke. Die Fahrzeit kann hierdurch von 3 Stunden und 48 Minuten auf rund 2 Stunden reduziert werden. Den Preis für diesen Distanz- und Zeitgewinn bezahlt u.a. Dijon, denn die Stadt wird bei der Trassenführung nicht berücksichtigt und erhält später nur einen Zubringerdienst.
Auf Grund seines Erfolgs auf der ersten Strecke wird das TGV-Netz weiter ausgebaut und im Jahr 1989 wird der Betrieb des TGV-Atlantique aufgenommen, der Paris und Tours bzw. Le Mans verbindet. Auch der überwiegende Teil der in den Folgejahren entstehenden Verbindungen namens LGV (ligne à grande vitesse) laufen auf Paris zu und unterstützen das auf die Hauptstadt ausgerichtete Verkehrsnetz (vgl. Abb. 1.16), z.B.
▪ LGV Nord-Europe: Paris – Calais
▪ LGV Rhône-Alpes: Paris – Valence (Verlängerung der Strecke Paris – Lyon)
▪ LGV Méditerranée: Paris – Marseille (Verlängerung der Strecke Paris – Lyon)
Einzig die LGV Interconnexion, die eine Ostumfahrung von Paris darstellt und die beiden Strecken LGV Sud-est und Nord-Europe umsteigefrei miteinander verbindet sowie die LGV Rhine-Rhône sind nicht auf Paris ausgerichtet, sondern stellen Nord-Süd- bzw. West-Ostverbindungen abseits der Hauptstadt dar. Der sukzessive Ausbau der Hochgeschwindigkeitstrassen, deren Netz im Jahr 2016 gut 2600 km umfasst und die eine Reisegeschwindigkeit von 320 km/h erlauben (vgl. SNCF 2018), führt dazu, dass weit mehr als 90 % der französischen Bevölkerung Paris in einer Fahrzeit von weniger als fünf Stunden erreichen kann (vgl. Abb. 1.15). Teilweise werden im Zuge des Streckenausbaus auch neue TGV-Bahnhöfe errichtet (vgl. Abb. 1.14).
Der TGV wird von der französischen Bevölkerung gut angenommen und nimmt dem konkurrierenden Verkehrsträger Luftverkehr auf innerfranzösischen Strecken erhebliche Marktanteile ab (auf der Strecke Lyon – Paris bis zu 70 %). Der Zug wird technisch kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert im Jahr 2007 auf der Strecke zwischen Paris und Straßburg erneut den Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge (513,3 km/h). Auch ins internationale Streckennetz ist der Hochgeschwindigkeitszug eingebunden und verbindet Paris mit Amsterdam, Brüssel oder Köln. Für die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF wird der TGV immer mehr zum wichtigsten Kernprodukt: So nimmt der Anteil des TGV an der Gesamt-Passagier-Beförderungsleistung deutlich zu und macht im Jahr 2001 erstmals mehr als 50 % der Gesamt-Passagierleistungen aus (vgl. Abb. 1.17).
Gleichwohl muss konstatiert werden, dass die zentral-peripheren Strukturen durch die Einführung des TGV eher gestärkt als geschwächt werden und sich das Fahrgastaufkommen auf den „traditionellen“ Strecken rückläufig entwickelt. Allerdings kann man dies auch so interpretieren, dass mit dem TGV der Zentralismus angenehmer zu leben ist.
Abb. 1.16 Streckennetz des TGV im Jahr 2016
Abb. 1.17 Entwicklung der Beförderungsleistung der SNCF insgesamt und mit dem TGV in Mrd. Passagier-km von 1990 bis 2016