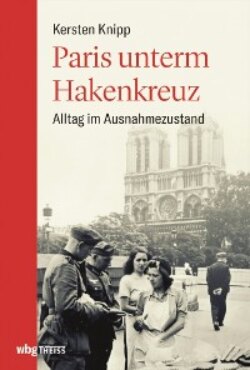Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 18
Angst und Alarm
ОглавлениеJa, man wartete. Und man reagierte im entscheidenden Moment, und zwar richtig. Die Pariser hätten »Disziplin« gezeigt, schrieb in ihrer nächsten Ausgabe die Zeitung Le Matin.7 Sie hätten es an »dem ruhigen Mut, den man von ihnen erwartet«, nicht fehlen lassen. Auch hätten die Bürger in dieser Nacht ein neues Miteinander entdeckt. In den Kellern hätten sich Kameraderie und Solidarität entwickelt – »zwischen Bewohnern die seit vielen Jahren dasselbe Haus bewohnen, ohne sich zu kennen.« Besonnene Reaktionen überwogen, fasste die Zeitung La Victoire den Schrecken der Nacht zusammen. »Sehr gut, die Pariser!« Allerdings hörte man auch von Menschen, die sich beim hastigen Abstieg in die Keller und Schutzräume verletzt hatten. Einige hatten sich das Bein gebrochen, andere den Fuß verrenkt. Und noch etwas mussten die Pariser zur Kenntnis nehmen: Nicht alle Mitbürger waren ehrenhaft. Einige nutzten die Zeit des Alarms, um in leer stehende Wohnungen einzudringen und fremder Leute Besitz zu rauben.
Vor allem aber bildete die Nacht des ersten falschen Alarms nur den Auftakt zu einer zähen Reihe ermüdender, zermürbender Vorsichtsmaßnahmen. Um dem Feind die Orientierung zu erschweren, war das Licht in der Stadt auf ein Minimum zu reduzieren. Die Straßenlaternen waren ausgeschaltet, die Autos fuhren mit ihren blau übermalten, nur einen winzigen Lichtstreif durchlassenden Scheinwerfern auf kürzeste Sicht. Die Geschwindigkeit war auf 20 Stundenkilometer begrenzt. Dennoch war die Unfallquote deutlich höher als zuvor.
Zugleich verloren die Bürger einen Teil ihrer Freiheit. Restaurants, Theater und Kinos nahmen am 4. September 1939 empfindliche Maßnahmen hin: Größere Veranstalten mussten um 20.30 Uhr beendet sein, die Restaurants spätestens um 23 Uhr schließen. Strenge Regelungen galten auch für die privaten Haushalte: Die Bewohner waren verpflichtet, kein Licht aus ihren Wohnungen dringen zu lassen – Zuwiderhandlungen wurden streng geahndet. Am 10. September hatte sich Simone de Beauvoir früh zu Bett gelegt. »Um elf Uhr abends lese ich ›Meine Mutter‹ von Pearl Buck, ein zähes Buch, als ich auf der Straße grobe Stimmen höre: ›Licht! Licht!‹ – Ich versuche mit den Leuten zu reden, aber man schreit: ›Knall ihr ein paar Revolverschüsse auf die Fensterläden! Wenn Sie spionieren wollen, gehen Sie woanders hin!‹ Ich entscheide mich, das Licht auszumachen.«8
Reizbarkeit lag in der Luft, die ständige Angst vor einem Angriff zermürbte. Die nächtlichen Fehlalarme – es waren nicht wenige – brachten die Menschen aus dem Rhythmus. Sie schliefen zu wenig, das Leben geriet aus dem Takt. Ruhe und Selbstverständlichkeit der bisherigen Tage waren verschwunden, an ihre Stelle trat eine ermüdende Wachsamkeit, der Zwang, jederzeit mit dem Schlimmsten zu rechnen. Die Menschen nahmen die Geräusche der Stadt und die Gespräche mit Freunden, Nachbarn und Kollegen weiterhin wahr, achteten zugleich aber auch auf das jederzeit mögliche Heulen der Sirenen. Sie wussten, dass ihre Sicherheit bedroht, zumindest aber infrage gestellt war. Ein unbehagliches Gefühl, das Distanz zum Alltag schaffte, ihm seine Vertrautheit nahm und unter das Zeichen eines allzeit möglichen Angriffs stellte. Dieses Bewusstsein setzte sich im Kopf fest und zwang aller Wahrnehmung eine eigene Färbung auf. Noch die kleinste Handlung verlor ihre Unschuld – etwas Drohendes, Gefährliches schwebte über allem. Der Krieg, auch wenn er auf sich warten ließ, wurde zur psychologischen Herausforderung. »Man hat sich in der Unruhe eingerichtet und sich daran gewöhnt«, hielt der Schriftsteller und Anwalt Maurice Garçon am 12. September in seinem Tagebuch fest.9 Und weil man der Situation nicht entkommen konnte, aber auch nicht vor ihr in die Knie gehen wollte, blieb nur eine Möglichkeit: Man musste sich ihr stellen. »Die falschen Alarme vermitteln ein Gefühl der Ruhe«, so Garçon weiter. »Man hat entschlossen, das Leben wieder aufzunehmen, als gäbe es keine äußeren Ereignisse, die es stören könnten.«
Doch auch, wenn es vorerst ruhig blieb: Das Leben war gestört, und zwar fundamental. Frankreich und Deutschland befanden sich seit dem 3. September im Krieg miteinander. Niemand hatte diesen Krieg gewollt. Die führenden Politiker, und mit ihnen die Militärs, hatten ihn unbedingt zu vermeiden gesucht. Doch angesichts der bedrohlichen Gesten aus Deutschland schien die Entscheidung unausweichlich: Sobald die Deutschen Polen angreifen würden, musste Frankreich Deutschland den Krieg erklären. Nur so ließe sich verhindern, dass Hitler seine Truppen nach Westen wandte, sobald Polen unterworfen wäre. Darum galt es, den Feind in einen Zweifrontenkrieg zu verwickeln und auf diese Weise zu schwächen. Außerdem hatten Frankreich und Großbritannien im März 1939 eine Garantieerklärung unterzeichnet: Sollte sich Polen gezwungen sehen, seine Souveränität mit militärischen Mitteln zu verteidigen, würden die beiden Westmächte ihm beistehen. Gemeint war damit nicht zwingend ein militärischer Einsatz – auch diplomatischer Beistand war denkbar. Der Pakt war vor allem eine Warnung an Hitler, verbunden mit dem Angebot, alles Weitere am Verhandlungstisch zu regeln. Den Pakt galt es nun einzulösen. Andernfalls hätten Frankreich und Großbritannien als ebenso unglaubwürdige wie unverlässliche Staaten dagestanden. Europa, so das unterschwellige Eingeständnis, hätte Nazi-Deutschland nichts entgegenzusetzen. Zudem: Die Mobilisierung vom Juli 1939 war seit dem April 1936 die fünfte ihrer Art. Die Franzosen so oft aus ihrem Rhythmus zu reißen und dann wieder nach Hause zu schicken – das hatte auf Dauer einen ermüdenden Effekt.
Titelseite der Zeitung »Marianne« mit der Überschrift »Rien que la terre« (»Nicht weniger als die Welt«) vom 13.9.1939.
Hitler ließ sich nicht beeindrucken: Am 1. September griff das deutsche Heer Polen an. Frankreich und Großbritannien reagierten. Am 3. September um 9 Uhr morgens überreichte der britische Botschafter Nevile M. Henderson dem deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop ein auf zwei Stunden befristetes Ultimatum, das den britischen Kriegseintritt bekannt gab. Ihm folgte gut drei Stunden später, um 12.20 Uhr, der französische Botschafter Robert Coulondre, auch er mit der Kriegserklärung seiner Regierung im Gepäck, angesetzt auf 5 Uhr nachmittags. Sein Eindruck von dem deutschen Außenminister und damit von den Möglichkeiten, den Frieden doch noch zu retten, stand zu diesem Zeitpunkt schon fest.
»Hitler verfällt in Monologe, wenn die Leidenschaft ihn hinreißt. Herr von Ribbentrop aber monologisiert eiskalt. Es ist vergeblich, ihm seine Auffassung auseinanderzusetzen, er hört ebenso wenig hin, wie seine kalten, leeren Mondaugen einen sehen. Immer von oben herab, immer in Pose, versetzt er mit schneidender Stimme seinem Gegenüber die wohlvorbereitete Ansprache; das weitere interessiert ihn nicht mehr; man hat sich nur noch zurückzuziehen. An diesem, übrigens gut aussehenden Germanen ist nichts Menschliches außer den niedrigen Instinkten.«10