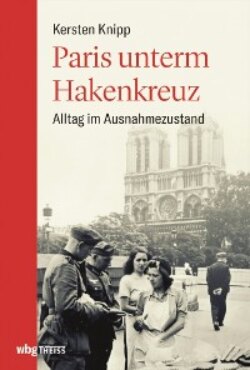Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 22
Krieg? Was für ein Krieg?
ОглавлениеEntspannung auch in Paris und vielen anderen Städten des Landes. Der Schrecken des ersten Luftalarms, so groß er war, ließ rasch nach. Wiederholt heulten die Sirenen, ohne dass die Deutschen sich am Himmel über der Hauptstadt auch nur gezeigt hatten. Schon nach wenigen Tagen gewöhnten sich die Bürger an den Krieg – es war ja kein »richtiger« Krieg. Bald fanden sich für diesen ein paar gängige Begriffe. Das Wort vom »Drôle de guerre«, dem »komischen Krieg«, machte die Runde. Ein Begriff, der Lässigkeit signalisierte, aber auch Hoffnung: Vielleicht blieb das Land von einem tatsächlichen Krieg ja verschont? Andere Formeln machten die Runde: »Guerre-qui-n’ose pas dire son nom« (»Krieg, der seinen Namen nicht zu sagen wagt«); »guerre blanche« (»Weißer Krieg«); »guerre-en-vacances« (»Krieg, der in die Ferien gefahren ist«); »guerrepaix« (»Friedenskrieg«). Der verbale Einfallsreichtum deutete es an: Ein solcher Krieg war etwas Neues, dergleichen kannte man nicht. So gab man sich bald wieder entspannt, wurde der Krieg als das wahrgenommen, was er in erster Linie war: ein Quell unangenehmer Belästigungen. Sobald ein deutsches Flugzeug die Grenze zu Frankreich überflog, gingen auch in Paris die Sirenen an – ein ermüdender Mechanismus, der umgehend Spötter auf den Plan rief. »Jede Nacht sich anziehen/um sich am Morgen wieder auszuziehen«, reimte schon am 8. September die Zeitschrift Le Petit Bleu, um der Aufregung zu dunkler Stunde dann augenzwinkernd ihren Schrecken zu nehmen: »Es ist ein Alarm – das ist alles«.28 Auch die ungeliebten Gasmasken wollten die Franzosen lieber heute als morgen wieder loswerden. »Hat die zunächst so klug akzeptierte Disziplin nachgelassen«, fragte am 9. November die Zeitung Le Jour. »Gestern Morgen traf man viel weniger Passanten ohne die wertvolle Maske als noch am Vortag.«29 Und wenn sie die Maske in dem Etui doch dabei hatten – dann war es insbesondere von den Frauen um eine Funktion erweitert worden: Es diene ihnen als Handtasche, vermeldete die Zeitschrift Le Canard, in der sie die verschiedensten Utensilien verstauten: den Lippenstift, das Schminkpuder, den Busfahrschein, das Ticket für die Metro und den jüngsten Brief des Geliebten von der Front. Wo Gefahr war, sollte wieder Schönheit walten, der ästhetische Sinn ließ den Sinn für die mögliche Gefahr in die zweite Reihe treten. Auch die Nacht sollte wieder heller werden: Nicht wenige Autofahrer handelten sich Ärger mit der Polizei ein, weil sie, entgegen der Vorschrift, nicht mit abgedunkelten Scheinwerfern fuhren. Und immer mehr Bürger nahmen es mit der Abdunkelung ihrer Wohnung nicht mehr so genau. Auch die Händler wurden ungeduldig: Geschäfte konnten sie unter den obligatorischen Vorsichtsmaßnahmen viel schwerer machen als vorher. »Der Handel von Nizza will leben, und in der Frage der Beleuchtung in den Geschäften protestiert er zurecht«, hieß es am 20. Oktober in der Zeitung Le Petit Niçois. »Will man den Wiederaufschwung des wirtschaftlichen Lebens, oder will man ihn nicht«, fragte die Zeitung zwei Monate später.
Freilich nahmen nicht alle Franzosen die Vorsichtsmaßnahmen so leicht. Insbesondere die chefs d’îlot, die Sicherheitsbeauftragten der einzelnen Viertel, gaben sich streng. »Ihre Wohnung ist ein Leuchtturm«, ranzten sie die allzu nachlässig ihre Fenster abdeckenden Bürger an. »Sie hätten ihn hören sollen, wie er die Leute anschreit, die ihr Licht nicht abdecken«, erzählte ein Franzose seinem Gegenüber. »Ernie (so der Spitzname des hier erwähnten chef d’îlot, Anm. d. A.) nimmt den Krieg ernst.« Und er hatte Gründe dafür, so die Vermutung: »Er ist ein tapferer Typ. Sein Hund ist gestorben, er war sein bester Freund.«30 Die chefs d’îlot waren Helden des Alltags. Als solche erhielten sie jene Anerkennung, die nicht wenige von ihnen ganz offenbar brauchten. Unverkennbar schwang in manchen Schilderungen des Sicherheitsbeauftragten ein ironischer Ton mit. Er nehme seine Rolle ernst, erinnerte sich der Komiker Pierre Dac. Das könne man ihm kaum hoch genug anrechnen. Allerdings übertreibe er es bisweilen auch mit seiner Hingabe. »Bei der Morgendämmerung fällt der chef d’îlot in eine Art Trance. Er hat zwei unverwechselbare Ausdrucksmittel: zum einen die Trillerpfeife, von der er verschwenderischen Gebrauch macht. Und zum anderen einen gutturalen, unmenschlichen Schrei, der fast jede Sekunde zu hören ist, und den man ungefähr mit »›Licht! Licht!‹ übersetzen könnte.«31 Der chef d’îlot war jener Mann, den die Franzosen brauchten in den ersten Wochen des Krieges – und der seinerseits nicht selten nichts dringender brauchte als die anerkennenden Blicke der ihm Anvertrauten. Keine Krise, die nicht ihre Helden schafft, jene, die in schwierigen Zeiten über sich hinauswachsen und zu Recht den Ruhm der dunklen Stunden ernten. »Die Pförtnerinnen lächeln mir zu, die Geschäftsleute sprechen mich ehrerbietig an, die Polizisten grüßen mich mit militärischer Ehre«, umriss einer von ihnen die neue Anerkennung.32