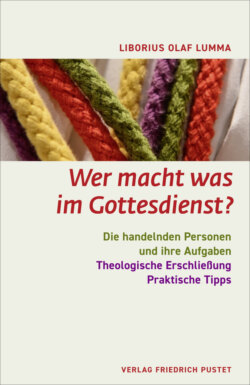Читать книгу Wer macht was im Gottesdienst? - Liborius Olaf Lumma - Страница 23
Konsequenzen für die Praxis
ОглавлениеSchon an dieser Stelle ergeben sich erste Konsequenzen für die Praxis. Eine Versammlung, die das Amen nicht aktiv übernimmt, kann auch nicht die Verantwortung tragen, die ihr liturgisch zukommt. Das geschieht natürlich meistens nicht aus Boshaftigkeit oder bewusster Verweigerung, sondern aus Unkenntnis. (Dass es Menschen gibt, die wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder fehlender Sprachkenntnisse nicht aktiv und laut zustimmen können, ist ohnehin klar; darum geht es hier natürlich nicht.) Es zeigt sich, wie dringlich eines der Anliegen ist, die das Konzil ganz nach oben auf die Tagesordnung der katholischen Kirche gesetzt hat: liturgische Bildung, und zwar liturgische Bildung aller, nicht nur der Hauptamtlichen. Für liturgische Bildung sind theoretische Kenntnisse hilfreich, aber noch entscheidender ist das, was man heutzutage best practice nennt: Die katholische Kirche braucht dringend Orte, an denen Liturgie in sachgerechter Gestaltung erlebt und dabei zugleich erlernt werden kann. Die Theorie braucht man dann nur noch, um die Sache besser zu verstehen, aber nicht, um sie überhaupt zu verstehen. Dieses grundlegende Verstehen geschieht ohnehin nicht rational, sondern durch das Miterleben und Sich-Hineinbegeben in die Würde der Versammlung als Trägerin der Liturgie.
Ein weiterer Aspekt: Ein Liturgievorsteher, der das Amen selbst spricht, handelt gegenüber der Versammlung übergriffig (so wie die Vereinsvorsitzende, die bei der Entlastung des Vorstands schnell noch ihre Stimme in die Wahlurne wirft, in der Hoffnung, dass das niemandem auffällt). Natürlich hat auch das oft praktische Gründe und ist gut gemeint – der Vorsteher will den Menschen helfen, an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen –, aber es läuft langfristig darauf hinaus, die Versammlung zur Zuschauerin zu degradieren, anstatt sie als Trägerin der Liturgie und damit als Kirche ernst zu nehmen. Haupt- und Ehrenamtliche stehen hier vor einem unlösbaren Problem, denn oft müssen sie Gottesdienste leiten, in denen nur sehr wenige oder gar keine Mitfeiernden ihre Rolle kennen und aktiv ausfüllen, zum Beispiel bei Taufen, Trauungen oder Begräbnissen. Das muss man dann irgendwie praktisch regeln und versucht es vielleicht mit eingeschobenen kommentierenden Anleitungen, mit der Produktion von Liturgieheften, aus denen der gesamte Ablauf hervorgeht, oder mit radikaler Vereinfachung des gesamten Rituals. Wie man es auch tut: Immer wird das Bild von Bühne und Publikum verstärkt, wahlweise auch von Lehrer und Schülern oder von Mächtigen und Machtlosen. Die Liturgie wird unweigerlich den Charakter einer Belehrung bekommen, sie wird dem alltäglichen Leben als Fremdkörper gegenüberstehen, anstatt das Leben symbolisch zu deuten und ihm eine Zielrichtung zu geben.