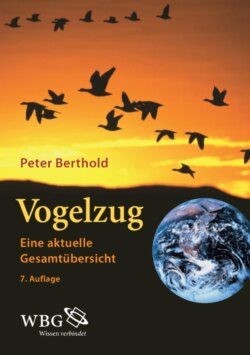Читать книгу Vogelzug - Peter Berthold - Страница 10
2. Evolution, genetische Grundlagen und Umfang des Vogelzugs
ОглавлениеOb die „Urvögel“ Archaeopteryx, die in den Jurakalkschichten bei Eichstätt in Bayern gefunden worden sind und die vor rund 140 Mio. Jahren gelebt haben, oder die China-Urvögel Confuciusornis der Unterkreidezeit schon irgendwelche bescheidenen Wanderungen unternommen haben, wissen wir nicht. Ihre Flugunfähigkeit kann jedenfalls nicht einfach als Hindernis dafür angesehen werden, denn zum einen können rezente Arten laufend oder schwimmend wandern (5.30), zum anderen haben wahrscheinlich die flugunfähigen Zahnvögel Hesperornis der Kreidezeit schon ausgedehnte Wanderungen durchgeführt. Fossile dieser großen, mit Taucherfüßen und stark reduzierten Flügeln ausgestatteten marinen Fischfänger wurden in Nordamerika gefunden. Die Fundumstände machen wahrscheinlich, dass diese Vögel, ähnlich wie viele heutige Seevögel, zum Brüten bereits beträchtliche Strecken in höhere Breiten wanderten (Tyrberg 1986). Wenn diese Annahme richtig ist, dann wäre Vogelzug im engeren Sinn (5.1) nahezu so alt wie die Vögel selbst, wie dies Alerstam (1990) postulierte. Ähnlich frühe Entstehung des Vogelzugs wird auch von einer Reihe anderer Untersucher angenommen (Berthold 1999).
Wir müssen davon ausgehen, dass schon sehr frühe Vogelformen Ausbreitungsbewegungen durchgeführt haben, wie wir sie von vielen Jungvögeln kennen (5.3, 5.8), sei es, um sich aus den elterlichen Brutgebieten zu entfernen, um intraspezifischer Konkurrenz, Populationsdruck, zu entgehen, um neue Nahrungsgründe zu erschließen u.a.m. Je nachdem, ob man derartiges Abwandern in die Definition von Vogelzug mit einbezieht oder nicht, wird man die Entstehung des Vogelzugs eher früher oder später anzusetzen haben. Folgt man einer engeren Definition, die unter Vogelzug vor allem die regelmäßigen saisonalen Pendelbewegungen versteht (5.1, 5.2), dann betreffen unsere ersten Hinweise die oben genannten Hesperornis. Wie es danach weitergegangen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber über die Entstehung des Vogelzugs als Lebensform ist natürlich in zahlreichen Untersuchungen spekuliert worden, die kaum zu überblicken sind und bis zu Aristoteles zurückreichen (Kap.3). Erfreulicherweise gibt es neuere zusammenfassende Übersichten wie vor allem die von Rappole (1995), die weiterhelfen. Rappole (1995) hat alle bekannten Theorien zur Entstehung des Vogelzugs in acht Kategorien von Ursachen zusammengefasst: 1. weit zurückliegende Änderungen von Umweltbedingungen, vor allem bewirkt durch frühere Eiszeiten, Meeresspiegelschwankungen oder die Kontinentaldrift bei der Entstehung der heutigen Kontinente, 2. Klimaänderungen in neuerer Zeit, vor allem nach den letzten Eiszeiten, 3. proximate Faktoren verschiedenster Art (Kap. 4), vor allem Vorläufer sich anbahnender größerer Umweltveränderungen, 4. anderswo, in mehr oder weniger großer Entfernung zeitweilig zur Verfügung stehende günstige Ressourcen, 5. die jahreszeitliche Nutzung von Früchten und Nektar in einer Reihe von Gebieten mit zeitlicher Abfolge im Nahrungsangebot, 6. Saisonalität von Ressourcen in Verbindug mit interspezifischer Konkurrenz, 7. Saisonalität von Ressourcen in Verknüpfung mit intraspezifischer Konkurrenz (Dominanzeinflüsse), und 8. die Zugschwellen-Hypothese, die auf Baker (1978) zurückgeht und postuliert, jeder Organismus habe eine genetisch determinierte „Zugschwelle“, so dass sich verschlechternde Umweltbedingungen ab einer bestimmten Grenze zu Wegzug führen.
So unterschiedlich die zahlreichen Theorien, auf den verschiedensten Ursachen aufbauend, auch sein mögen – sie haben nach Rappole (1995) alle eines gemeinsam: die Annahme, dass Zugvögel ursprünglich aus Standvögeln entstanden sind und dass „irgendetwas“ das Ziehen in Gang gebracht hat. Für diese Verhaltensänderung vom Stand- zum Zugvogel gibt es in der Literatur zwei Erklärungsversuche: zum einen die Annahme von zufälligen Mutationen und zum anderen die Vorstellung, Vogelzug habe sich aus ursprünglichen Streubewegungen, v.a. der Jugenddispersion, die auch bei Standvögeln regelmäßig vorkommt (5.3), oder Nomadisieren (5.5) und fakultativem über obligaten Teilzug (5.10) bis hin zu obligatorischem Pendelzug schrittweise entwickelt (Terrill 1991; in einfacherer Form auch Merkel 1966: Entwicklung aus Hungerunruhe, Baker 1978: Explorationsverhalten-Zugmodell). Weiter wurde angenommen, Vogelzug sei wahrscheinlich in verschiedenen systematischen Vogelgruppen und in unterschiedlichen Regionen der Erde mehrfach oder sogar vielfach und unabhängig voneinander entstanden (polyphyletische Entstehung, Farner 1955). Und schließlich bildeten sich zwei gegensätzliche Ansichten über die Großräume der Vogelzugentstehung aus: die Theorie des nördlichen Ursprungs, die davon ausgeht, Vogelzug sei in der heutigen nördlichen gemäßigten Zone entstanden, sowie die Theorie des südlichen Ursprungs, die Entstehung von Zugvögeln eher in den Tropen sieht (Rappole 1995). Aus heutiger Sicht besteht kaum Zweifel, dass Vogelzug seinen Ursprung eher in tropischen Regionen oder zumindest unter tropisch-subtropischen Bedingungen genommen hat. Die höchste Beweiskraft dafür liegt in der Feststellung, dass – zumindest in Amerika – die meisten Langstreckenzieher der Nordhemisphäre eng verwandte, nicht oder wenig ziehende Formen in den Tropen haben (Rappole 1995). Außerdem ist Vogelzug auch innerhalb der Tropen – entgegen früherer Lehrmeinung – nicht etwa selten, sondern weit verbreitet. Curry-Lindahl (1981) berichtet z.B. von Wanderungen bei über 500 Arten und Unterarten innerhalb Afrikas. Inzwischen sind Intratropikalzüge in derartigem Ausmaß festgestellt worden (Schüz et al. 1971, Dowsett-Lemaire 1989, Rappole 1995), dass Winker et al. (1997) davor warnten tropische Vogelformen als Standvögel anzusehen, bevor sie nicht gründlich auf Wanderungen hin untersucht wurden. Levey und Stiles (1992) haben in Intratropikalzügen eine unmittelbare Prädisposition für die Entwicklung von Zugverhalten außerhalb der Tropen angenommen (Evolutions-Vorläufer-Hypothese, Chesser u. Levey 1998).
Abb. 2: Die Ausdehnung der Brutverbreitung des Girlitz (Serinus serinus) in Europa seit 1800 (aus Berthold 1998 nach Burton 1995).
Die bisher vorgestellten Vogelzug-Theorien besitzen folgende Mängel: Sie können nur schwer erklären, wie Zugverhalten im Falle polyphyletischer Evolution immer wieder neu entstanden sein mag, wie die Verhaltensänderung vom Stand- zum Zugvogelverhalten immer wieder eingetreten sein soll und vor allem, wie mit der Annahme von Mutationen der häufig zu beobachtende Wechsel im Zug-/Standvogel-Verhalten erklärt werden soll. Derartige Verhaltenswechsel, die – wie gleich gezeigt werden wird – häufig auftreten, würden regelmäßig gegengerichtete und bei vielen Arten gleichartig verlaufende Mutationen erfordern, die kaum vorstellbar sind. Die genannten Schwierigkeiten lassen sich gut am Beispiel von Girlitz (Serinus serinus) und Amsel (Turdus merula) erläutern. Der Girlitz hat sein Brutgebiet seit etwa 1800 vom Mittelmeerraum zunehmend nach Norden ausgedehnt – um 1925 bis in den norddeutschen Raum und danach bis nach Skandinavien (Abb. 2). Dabei wurde der ursprüngliche Teilzieher zum reinen Zugvogel mit mehr und mehr nach Süden ausgerichteten Zugrichtungen (Mayr 1926). Heutzutage, im Zuge der gegenwärtigen Klimaerwärmung (Kap. 10), überwintert der Girlitz wieder zunehmend im Brutgebiet, und zwar nun in seinem gesamten europäischen Verbreitungsgebiet (Bauer u. Berthold 1997) und wird damit wieder zum Teilzieher, der er früher im Mittelmeerraum war (Berthold 1999). Ein ähnliches Beispiel stellt die Amsel dar. Sie ist in ihrem mediterran-atlantischen Verbreitungsgebiet Standvogel oder Teilzieher. Nach ihrer postglazialen (Wieder-)Besiedlung Europas war sie dort bis ins 19. Jahrhundert Zugvogel, später Teilzieher, und gegenwärtig entwickelt sie Standvogelpopulationen, die bei weiterer Klimaerwärmung vorherrschen könnten (5.10). Derartige Veränderungen, die wir z.Z. bei vielen Arten beobachten (Kap. 10), sind schwer mit gleichgerichteten Mutationen zu erklären. Für sie gibt es, wie im Folgenden gezeigt wird, eine näherliegende Erklärungsmöglichkeit.
Eine Reihe von neuen Versuchsergebnissen, Beobachtungen und Verknüpfungen von Erkenntnissen haben es ermöglicht, auf dem Internationalen Ornithologenkongress 1998 in Durban eine neue umfassende Vogelzug-Theorie vorzustellen (Berthold 1999), die sowohl die Evolution des Vogelzugs, seine Steuerung als auch seine Anpassungsfähigkeit durch Mikroevolution erklärt. Sie baut auf einfachen experimentell erhärteten Befunden auf und kommt mit wenigen zusätzlichen Annahmen aus. Ihre wesentliche Grundlage ist der obligate Teilzug (5.10). Im Folgenden werden zunächst ihre Grundlagen kurz dargestellt, und anschließend wird sie formuliert.
Langfristige Untersuchungen in der Vogelwarte Radolfzell an einer Reihe von Arten, vor allem der Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) sowie an Rotschwanzarten, haben inzwischen gezeigt: Alle wichtigen morphologischen und physiologischen Grundlagen sowie Verhaltensgrundlagen des Vogelzugs werden unmittelbar genetisch gesteuert (also z.B. der Zugtrieb und der Beginn des Wegzugs, die Menge der Zugaktivität und damit die Dauer der Zugperiode und die bis ins Winterquartier zurückzulegende Strecke bei zugunerfahrenen, erstmals ziehenden Individuen, weiterhin die Zugdisposition, hier vor allem die Fettdeposition für den Zug, ferner das Orientierungsverhalten, aber auch Anpassungen in der Flügelform u.a.m., 5.32, 6.3, 6.12–6.15, 6.18, 6.21, 7). Derartige genetische Steuerung ist für sehr viele weitere Zugvogelarten wahrscheinlich. Weiterhin zeigen die untersuchten Zugmerkmale beträchtliche phänotypische und additiv-genetische Variabilität und besitzen dadurch ein großes Mikroevolutionspotential (Berthold 1999). Im Hinblick auf das Mikroevolutionspotential erwies sich der obligate Teilzug als besonders aufschlussreich. An einer teilziehenden Mönchsgrasmückenpopulation ließ sich nämlich zeigen, dass aus ihr durch experimentelle Selektion – die gerichteter Mikroevolution in der freien Natur entspricht – nahezu reine Zug- bzw. fast ausschließliche Standvögel innerhalb von nur 3–6 Generationen gezüchtet werden können (6.18). Damit stellt Teilzug bei diesen Vögeln eine Art Drehscheibe dar, von der aus – je nach den Umwelterfordernissen – größere oder kleinere Anteile von Zugvögeln in einer Population selektiert werden können. Weiterhin ließ sich nachweisen, dass bei Teilziehern die Verhaltensweise Ziehen (oder der Zugtrieb) und bei den ziehenden Individuen die Menge der Zugaktivität (die die Zugstrecke bestimmt, 6.13) von ein und demselben genetischen Mechanismus gesteuert werden, also ein Zugsyndrom darstellen (6.18). Da Ziehen und Nichtziehen bei Teilziehern nach den an Mönchsgrasmücken erzielten Ergebnissen offenbar polygen gesteuerte Schwellenmerkmale sind (6.18), ist nach dem Zugsyndrom zu erwarten: Auch bei der Selektion von reinen Zugvögeln auf kleinere Zugaktivitätsmengen (also kürzere Zugstrecken) sollte irgendwann eine kritische Schwelle erreicht werden, von der ab „automatisch“, ohne die Wirkung weiterer Faktoren wie z.B. Mutationen, Nichtzieher auftreten – also Teilzug entsteht (Pulido et al. 1996, Berthold 1999, 6.18). Damit nimmt Teilzug eine Schlüsselstellung im Vogelzug ein für den Übergang von reinen Zugvögeln zu weniger ausgeprägten Zugvögeln bis hin zu Standvögeln, und es ist nicht überraschend, dass er offenbar sehr weit verbreitet ist. Von den rund 400 Brutvogelarten Europas z.B. sind über 60 % Teilzieher, und es spricht vieles dafür, dass die restlichen knapp 40 % zwar derzeit vorwiegend sehr hohe Zugvogelanteile besitzen, aber ebenfalls genotypische Teilzieher sind (d.h. potenzielle Teilzieher, die in ihrem Genom auch Gene besitzen, die Standvogelverhalten, also Nichtziehen, bewirken können; Berthold 1999, 6.18). Obwohl unsere Kenntnisse über den Umfang und die Art von Wanderungen in den Tropen noch sehr unvollständig sind, ist dennoch wahrscheinlich, dass Teilzug auch dort weit verbreitet ist. Das liegt schon deshalb nahe, weil die meisten Intratropikalzüge über kurze Strecken erfolgen und Kurzstreckenzug allgemein häufig mit Teilzug verbunden ist. Teilzug könnte sich bei weiteren Studien durchaus als die am weitesten verbreitete Lebensform bei Vögeln überhaupt erweisen – und damit als ein Grundmuster des Verhaltens von Vögeln (Berthold 1999). Es ist nicht überraschend, dass der offenbar sehr erfolgreiche Teilzug nicht etwa erst von Vögeln „erfunden“ wurde, sondern eine alte und weit verbreitete Verhaltensweise darstellt, die bei vielen Insekten, Krustazeen sowie in allen anderen Wirbeltierklassen und sogar bei Pflanzen vorkommt (Berthold 1999). Vögel könnten somit bereits bei ihrer Evolution Teilzugverhalten von Vogelvorfahren mitgebracht haben, wie man das für ihre Orientierungsmechanismen annimmt (7.7).
Nach dieser kurzen Übersicht über neuere Befunde zur Steuerung des Vogelzugs und zum Teilzug lässt sich die neue Vogelzug-Theorie in wenigen Kernsätzen folgendermaßen formulieren: 1. Vogelzug entwickelte sich ursprünglich in tropischen Regionen oder zumindest unter tropischen Bedingungen und sehr wahrscheinlich schon bald nach Entstehung der Vögel. 2. Zugbewegungen führten unter tropischen Verhältnissen zunächst nur über kurze Entfernungen und waren dabei schon frühzeitig mit Teilzug verknüpft. Vögel haben das alsbald weit verbreitete Teilzugverhalten vielleicht bereits von Vogelvorfahren mitgebracht und ihr gesamtes späteres Zugverhalten daraus entwickelt. 3. Wie Teilzug auch immer entstanden sein mag – er hat sich als eine außergewöhnlich erfolgreiche und anpassbare Lebensform erwiesen und zunehmend verbreitet. Falls er nicht schon ursprünglich im Erbgut der Vögel allgemein fest verankert war, könnte er inzwischen eine evolutionsstabile Verhaltensform geworden sein – eine Verhaltensweise, die über Selektion und Mikroevolution durch keine andere Verhaltensweise (in diesem Fall reines Stand- oder ausschließliches Zugvogelverhalten) ersetzt werden kann. Da Teilzieher – wie experimentell gezeigt – unter extremen Bedingungen rasch bis zu phänotypisch (fast) reinen Zug- oder Standvögeln selektiert werden können, brächte die evolutionsstabile Verankerung des Teilzugs keinerlei Nachteile. Sie hätte aber den großen Vorteil, dass selbst nach extremer Selektion auf nur einen Phänotyp die Entwicklung später, unter andersartigen Umweltbedingungen, jederzeit durch einfache Gegenselektion wieder umkehrbar wäre. 4. Nachdem Teilzugverhalten bei Vögeln genetisch verankert war, besaßen sie ein genetisches Grundmuster, von dem aus die gesamte Verhaltenspalette vom (fast reinen) Standvogel bis zum (fast ausschließlichen) Zugvogel – und in dieser Gruppe bis hin zum interkontinentalen Langstreckenzieher (5.24) – rein durch Selektion und Mikroevolution entwickelt werden konnte. Und diese Entwicklungen adaptiver Radiation können, wenn dies neuartige Umweltverhältnisse erfordern, jederzeit und relativ rasch durch Gegenselektion umgekehrt werden (10), ohne dass Mutationen oder sonstwie gesteuerte „Verhaltenssprünge“ erforderlich sind. Damit stellt die genotypische Veranlagung zum Teilzugverhalten eine ideale Ausgangsbasis für alle Formen von regelmäßigem Zug dar, und sie mag durchaus auch genetische Verbindungen zum Dispersionsverhalten oder zu mehr fakultativem Zugverhalten besitzen (5.3ff.), nach denen es zu suchen gilt. Berechnungen ergaben, dass die Umwandlung von einer (fast) ausschließlich ziehenden in eine (nahezu reine) Standvogelpopulation (oder umgekehrt) bei Singvögeln nur etwa 25 Generationen oder 40 Jahre dauern würde (Berthold 1999).
Für die spezifische Entwicklung des heutigen Vogelzugs z.B. im eurasisch-afrikanischen Raum haben sicher die Eiszeiten eine große Rolle gespielt. Während der Eiszeiten war die Vogelwelt Europas stark reduziert (Moreau 1954), viele Arten und Populationen waren gezwungen, sich in mediterrane, nordafrikanische oder asiatische Refugien zurückzuziehen, von wo aus sie nach der letzten Eiszeit „wieder“ einwandern konnten (Mayr u. Meise 1930). Das Wieder ist in Anführungszeichen gesetzt, denn manche ursprünglichen Arten haben sich offensichtlich durch die zeitweilig erfolgte Trennung von Populationen zu nah verwandten Arten aufgespalten, nämlich zu sogenannten Zwillingsarten. Solche Artenpaare sind in unserem Raum z.B. Garten- und Waldbaumläufer (Certhia brachydactyla, C. familiaris), Fitis und Zilpzalp (Phylloscopus trochilus, P. collybita) und Sumpf- und Weidenmeise (Parus palustris, P. montanus). Manche dieser Zwillingsarten sind ausgeprägte Zugvögel und Langstreckenzieher wie der Fitis, andere mehr Kurz- und Mittelstreckenzieher wie der Zilpzalp und andere im wesentlichen Standvögel wie der Waldbaumläufer.
Die vor rund 15.000 Jahren mit dem Ende der letzten Eiszeit einsetzende Entwicklung zum heutigen Vogelzugsystem in Europa dauert bis in unsere Gegenwart an, und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Beispiele für bis in die Gegenwart andauernde Entwicklungen im Zug- und Ansiedlungsverhalten finden wir bei vielen Arten: Der Kiebitz (Vanellus vanellus) etwa hat Finnland im Wesentlichen erst in unserem Jahrhundert besiedelt, die nördlichen Landesteile sogar erst Ende der 60er Jahre, die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) erreichte Ende der 40er Jahre Grönland, wo sie seitdem regelmäßig brütet (Schüz et al. 1971), und auch bei uns etablieren sich gegenwärtig neue Zugvogelarten als Brutvögel: vom Südwesten her der Orpheusspötter (Hippolais polyglotta), vom Osten der Karmingimpel (Carpodacus erythrinus), und vom Süden dringen z.Z. Arten wie der Bienenfresser (Merops apiaster) vor (Bauer u. Berthold 1997, Berthold 1998, Kap. 10). Und anthropogene Veränderungen unserer Umwelt, allen voran rezente Klimaänderungen, bedingt durch zunehmende Luftverschmutzungen („Treibhauseffekt“), könnten die Entwicklung neuartiger Vogelzugmodi bei rezenten Populationen stark beschleunigen. Darauf wird in 10 näher eingegangen. Das einzige derzeit bekannte Beispiel dafür, dass sich gegenwärtig aus Teilzug ausgeprägtes Zugverhalten entwickelt, wird in 5.2 behandelt (Hausgimpel Carpodacus mexicanus).
In vielen, vor allem älteren Arbeiten ist die Frage diskutiert worden, inwieweit die gemäß der Drifttheorie erfolgte Kontinentalverschiebung, also die Entstehung der heutigen Kontinente aus den Urkontinenten, Nachwirkungen auf den heutigen Vogelzug haben mag. Während die Systematiker aufgrund immer feinerer Methoden der Verwandtschaftsbestimmung und anhand von Fossilfunden recht gut in der Lage sind, die historische Verteilung früher Vogelformen auf den verschiedenen Kontinenten und die nachfolgende Weiterentwicklung der Avifaunen zu rekonstruieren (Brodkorb 1971), sind entsprechende historische Aspekte des Vogelzugs rein spekulativ geblieben (Schüz et al. 1971, Gauthreaux 1982) und sollen hier nicht weiter erörtert werden. Im Hinblick auf die in der Nordhemisphäre nach der Eiszeit entstandenen Wanderwege sieht es jedoch so aus, als ob noch heute eine Reihe von Arten die ehemaligen Wiederbesiedlungsrouten ihrer Gründerpopulationen als Zugwege benützen würde, auch wenn diese Zugrouten heute eher umständlich erscheinen (5.17). Andererseits müssen wir uns aber auch klar vor Augen halten, dass jüngste experimentelle Befunde zeigen, dass Zugverhalten beim Zusammentreffen von einer ziehenden und einer nicht ziehenden Population u.U. von einer Generation zur anderen in die Nachkommen der sesshaften Individuen vererbt werden und damit sehr rasch neu entstehen kann. Ähnlich schnell können wohl auch andere wesentliche Eigenschaften von Zugvögeln beim Einwirken starker Selektionsfaktoren auf genetischer Basis verändert werden, so dass konservative Verhaltensweisen von Zugvögeln zumindest theoretisch bei Bedarf wohl sehr schnell abgewandelt werden können (6.18, Kap. 10).
In höheren geographischen Breiten führen, wie oben bereits angesprochen, die meisten Vogelarten irgendwelche Wanderungen durch, und sei es wenigstens in einigen ziehenden Populationen oder Rassen (wie z.B. beim Haussperling Passer domesticus in der in Asien ziehenden Rasse bactrianus, 6.6), und reine Standvögel sind dort selten. Von Eurasien wandern alljährlich etwa 200 Arten nach Afrika. Moreau (1972) hat mit einer Reihe von Methoden abgeschätzt, dass damit jährlich über fünf Milliarden Individuen nach Afrika ziehen. Von den rund 1850 in Afrika lebenden Vogelarten mit schätzungsweise 70 Milliarden Individuen führen ebenfalls einige hundert Arten regelmäßig größere Wanderungen durch (Curry-Lindahl 1981, Lövei 1989), die mehr als zehn Milliarden Individuen betreffen mögen. Unter der berechtigten Annahme, dass in dem nearktisch-neotropischen, dem paläarktisch-orientalisch-australischen und dem antarktischen Vogelzugsystem ähnliche Mengen von Zugvögeln wandern wie in dem näher dargestellten paläarktisch-afrikanischen, dürften von den gegenwärtig in der Welt lebenden 200–400 Milliarden Vögeln alljährlich Zugvögel in der Größenordnung von mindestens 50 Milliarden unterwegs sein.