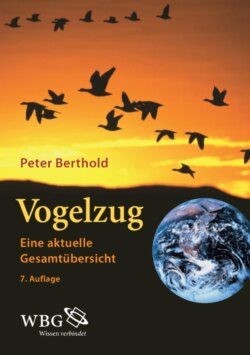Читать книгу Vogelzug - Peter Berthold - Страница 11
3. Geschichte der Vogelzugforschung
ОглавлениеSie beginnt zweifellos mit Aristoteles, dem Stresemann in seiner „Entwicklung der Ornithologie“ (1951) bescheinigt, dass er „die Vogelkunde zum Rang einer Wissenschaft erhoben hat“. Während Aristoteles erstaunlich detaillierte Beobachtungen aus den Gebieten der späteren Systematik, Morphologie, Physiologie, Embryologie, Ethologie u.a. mitteilt, hat er, was Zugvögel anbelangt, vor allem „das Märchen vom Winterschlaf der Vögel verbreitet“, wie Stresemann formuliert. Diese Meinung wurde immer wieder abgeschrieben und hielt sich erstaunlich lange, so dass noch der Systematiker Linné im 18. Jahrhundert der Ansicht war, Schwalben z.B. versänken im Herbst in Sümpfen und kämen erst im Frühjahr wie Amphibien wieder hervor (Schüz et al. 1971). Der zeitgenössische französische Naturforscher Cuvier hielt sogar Angaben für zutreffend, nach denen Fischer unter dem Eis von Gewässern zusammengeklumpte, aber noch lebende Schwalben gefunden haben sollen. Aristoteles glaubte zudem, eine Reihe von Arten würde sich zum Überwintern in andere Arten verwandeln (Transmutationstheorie, Mead 1983), und selbst Wanderungen bis zum Mond wurden angenommen (Nachtigall 1987).
Der erste große Ornithologe, den die Geschichte kennt (Stresemann 1951), war der Stauferkaiser Friedrich II., und ihm verdanken wir auch eine erste Darstellung des Vogelzugs mit einer großen Zahl erstaunlich präziser, bis auf den heutigen Tag gültiger Beobachtungen und Deutungen. In seinem berühmten Werk „De arte venandi cum avibus“ führt er die Ursachen des Vogelzugs auf äußere Einwirkungen wie Kälte und Nahrungsmangel zurück. Seiner hervorragenden Beobachternatur entging nicht, dass in den Keilformationen wandernder Kraniche (Grus grus) die Führervögel wechseln, worin er Aristoteles korrigiert. Er beschreibt treffend, wie Zugvögel im Frühjahr der Nahrung und der Wärme folgend allmählich in die Brutheimat einrücken und gibt eine faszinierende Beschreibung des Vogelfluges.
Unter den frühen Vogelzugbeobachtern haben sich einige weitere einen bleibenden Namen gemacht: der Vorläufer der modernen Verhaltensforschung, von Pernau, der bereits 1702 die Vorstellung von Instinkten, also vorgegebenen Verhaltensweisen, entwickelte und klar erkannte, dass der Zugvogel oftmals nicht direkt durch Hunger und Kälte zum Aufbruch veranlasst, sondern „durch einen verborgenen Zug zur rechten Zeit getrieben werde …“. Auch Reimarus und Legg vertreten bereits 1760 bzw. 1780 die Meinung, dass Zugvögel vielfach zu bestimmten Zeiten eine Art vorprogrammiertes „Zugweh“ bekommen bzw. „innerer Kenntnis“ folgen (Berthold 1996). Johann Andreas Naumann (1791, 1795–1817) schließlich gibt die erste klare Beschreibung der Zugunruhe, d.h. der Zugaktivität in Gefangenschaft befindlicher Zugvögel und deutet sie bereits im Sinne eines Zug-Zeitprogramms. Die Kenntnis der Zugrichtung sieht er als in des Vogels „Natur gepflanzet“ an (4.8, 6.13, 7.6.7).
Die intensive Erforschung des Vogelzugs setzte im 19. Jahrhundert ein. Farner (1955) unterscheidet zwei wesentliche Perioden. Etwa von 1825–1925 dauerte die Periode der Beobachtungen. Aus ihrer Zeit sind Namen wie Brehm, von Homeyer, Palmén und Wallace zu nennen, und von Lucanus (1923) und Wachs (1926) schrieben kritische, umfassende Übersichten über diesen Zeitabschnitt. In dieser Periode vielfältiger Mischung aus richtigen und falschen Beobachtungen, vorgefassten Meinungen und naturphilosophischen Konstruktionen kam es zu recht eigenwilligen Vorstellungen, auch Rückfällen gegenüber weit besserer Kenntnis der Materie in zurückliegender Zeit. Palmén z.B. nahm in seinem 1876 erschienenen Buch „Über die Zugstraßen der Vögel“ an, der „sogenannte Zug instinct“ gehe zum Teil auf Vererbung von Erfahrung zurück, Zugvogelscharen hätten allgemein ältere Individuen als Anführer, Vogelzug vollziehe sich nur in festgelegten Korridoren, den Zugstraßen, vornehmlich im Bereich großer Flüsse und einen angeborenen Richtungssinn gebe es nicht.
1925 begann mit den Pionierarbeiten des Kanadiers Rowan die Periode der experimentellen Vogelzugforschung. Rowan setzte in Freilandvolieren gehaltene Individuen zweier Zugvogelarten, nämlich Junkos (Junco hyemalis) und Amerikanerkrähen (Corvus brachyrhynchos) bereits mitten im Winter langen Tagen aus durch zusätzliche künstliche Beleuchtung, wodurch die Vögel vorzeitig sangen und Gonadenreifung zeigten, und derartig vorbehandelte freigelassene Krähen wanderten verfrüht in Richtung auf ihre nördlichen Brutgebiete ab. Damit war die erste Hypothese für die Steuerung des Vogelzugs auf experimenteller Basis geboren: Rowan folgerte, zumindest der Heimzug werde durch die Gonaden gesteuert, genauer, durch Sexualhormone ausgelöst (6.10).
Schon um die Jahrhundertwende war ein anderes Vogelzugexperiment eingeleitet worden – das Beringungsexperiment. Auf dem ersten Internationalen Ornithologen-Kongress 1884 in Wien war beschlossen worden, den Vogelzug mit Hilfe einer Vielzahl von Beobachtungsstationen systematisch zu erfassen. 1901 kam es zur Gründung einer solchen, sich später als überaus wichtig erweisenden Station: der Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung in Ostpreußen. Kurz zuvor, 1890, hatte der dänische Lehrer Mortensen damit begonnen, Stare (Sturnus vulgaris) und andere Vögel systematisch mit Metallringen am Bein (Lauf) zu kennzeichnen und erhielt sogenannte Rückmeldungen von weggezogenen und anderswo geschossenen oder wiedergefundenen Individuen. Derartige Kennzeichnungen waren auch schon früher gelegentlich vorgenommen worden – bereits in der Antike, worüber Plinius berichtet (Bub u. Oelke 1989). Aufsehen erregte z.B. auch ein Weißstorch (Ciconia ciconia), den eine Gräfin in Deutschland mit einem Silbermedaillon markiert hatte und der 1846 in Palästina gefangen wurde. Aber erst Mortensen verhalf der Kennzeichnung von Zugvögeln zu einem ersten Durchbruch. Das Beringungsexperiment wurde alsbald − 1903 − in der frisch gegründeten Vogelwarte Rossitten unter der damaligen Leitung von Johannes Thienemann institutionalisiert und brachte in kurzer Zeit viel Licht in die bislang nur andeutungsweise bekannten, z.T. komplizierten Wanderwege vieler Zugvögel. Bereits 1931 konnten Schüz und Weigold einen ers ten Atlas des Vogelzugs herausgeben, der in Kartenform über die Wanderwege einer ganzen Reihe von Zugvogelarten Auskunft gibt und der von Zink (1973–1985) und Zink und Bairlein (1995) fortgesetzt wurde. Inzwischen ist die Methode der Beringung ein Welterfolg geworden: Sie wird in den meisten Ländern der Erde praktiziert, und inzwischen sind in Europa über 120 Millionen und weltweit mehr als 200 Millionen Vögel beringt worden. In vielen Ländern wurden dafür spezielle Beringungszentralen eingerichtet, in Europa über 30, die EURING angehören, der European Union for Bird Ringing, und nach einheitlichen Methoden arbeiten (4.6).
Ähnlich wie die Vogelzugforschung mittels Beringung hat sich auch die sonstige Zugforschung zunehmend institutionalisiert. Schon die Vogelwarte Rossitten hat nach anfänglich reiner Beobachtung und Beringung ihre Arbeitsbereiche erweitert und ab 1925 Orientierungsexperimente und ab 1935 physiologische Untersuchungen begonnen. Sie sind in dem Nachfolgeinstitut, der Vogelwarte Radolfzell, einer Abteilung der Forschungsstelle für Ornithologie der Max-Planck-Gesellschaft, stark ausgeweitet worden und schließen heute auch Bereiche der Vogelzugendokrinologie und der Vogelzuggenetik ein (4.10, 4.8 u. 6.18). 1910 kam es zur Gründung einer weiteren Vogelwarte in Deutschland, der Vogelwarte Helgoland, die heute ihren Hauptsitz im Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven hat. Sie geht letztlich auf die Tätigkeit des Künstlers und Vogelbeobachters Heinrich Gätke auf Helgoland zurück, der auch den Begriff „Vogelwarte“ in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt hat (Weigold 1930, Bairlein u. Hüppop 1997). 1936 wurde eine dritte deutsche Vogelwarte auf der Insel Hiddensee in der Ostsee gegründet, die seit 1964 auch eigene Ringe ausgibt. In vielen Ländern, in denen solide naturwissenschaftliche Forschung betrieben wird, haben sich inzwischen darüber hinaus Arbeitsgruppen von Vogelzugforschern etabliert, häufig an Universitäten, die meist bestimmte Bereiche wie Orientierungsprobleme, periodische Vorgänge, Stoffwechselvorgänge usw. konzentriert untersuchen und die entsprechende Ausstattung für anspruchsvolle Experimente und Analysen besitzen. Besonders wichtige Impulse erhielt die Vogelzugforschung aus dem Gebiet der Biorhythmik, das sich zunächst in Bezug auf die Tagesperiodik (Wagner 1930, Palmgren 1944) und später im Bereich der Jahresperiodik (Aschoff 1955) rasch ausweitete.