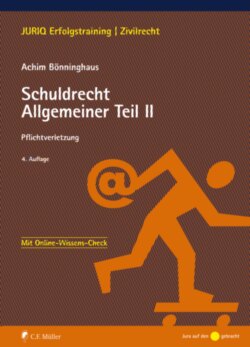Читать книгу Schuldrecht Allgemeiner Teil II - Achim Bönninghaus - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Teil Einführung › A. Pflichten im Schuldverhältnis
A. Pflichten im Schuldverhältnis
1
[Bild vergrößern]
2
Nach § 241 BGB[1] begründet ein Schuldverhältnis Leistungspflichten (Abs. 1) und Rücksichtspflichten (Abs. 2). Und sogleich stellt sich die Frage, worin sich diese beiden Pflichtenarten eigentlich unterscheiden.
Ein wichtiger Anhaltspunkt findet sich in den Formulierungen der beiden Absätze des § 241. Nach § 241 Abs. 1 ist der „Gläubiger“ „kraft des Schuldverhältnisses“ berechtigt „eine Leistung zu fordern“. Hingegen heißt es in Abs. 2, dass das Schuldverhältnis „seinem Inhalt nach“ zur Rücksicht verpflichten „kann“.
Leistungspflichten sind also solche Pflichten, auf die der Gläubiger kraft des Schuldverhältnisses einen klagbaren Anspruch hat. Das Schuldverhältnis ist dazu da, dem Gläubiger die Leistung zu verschaffen.[2]
Diejenigen Pflichten, die das Schuldverhältnis primär begründet und deren Inhalt für seine gesetzliche Typisierung ausschlaggebend ist, nennen wir „Hauptleistungspflichten“.[3] Die anderen Leistungspflichten bestehen von Anfang an oder später mit untergeordneter Bedeutung daneben. Man nennt diese Pflichten „Nebenleistungspflichten“.
Beispiel
Der Kaufvertrag verpflichtet den Käufer zur Zahlung des Kaufpreises und den Verkäufer zur Verschaffung des verkauften Gegenstandes in mangelfreiem Zustand (vgl. §§ 433, 453). Beide Leistungspflichten sind Hauptleistungspflichten, da sie primär mit Abschluss des Kaufvertrages entstehen und den Vertragstypus prägen. Die nach § 433 Abs. 2 vom Käufer auch geschuldete Abnahme der Kaufsache ist hingegen Nebenleistungspflicht, da sie zwar ebenfalls primär entsteht, aber für die Zuordnung zum Vertragstyp „Kauf“ nicht bedeutsam ist.[4]
Weitere Nebenleistungspflichten sind auch die Pflicht des Verkäufers zur Rechnungsstellung über den Kaufpreis[5] oder Erteilung einer Quittung (§ 368).
3
Bei den Leistungspflichten ist in der Regel ein bestimmter Erfolg durch Verhalten geschuldet. Das reine Verhalten ist nur ausnahmsweise Leistungsinhalt. Erfüllung der Leistungspflicht gem. § 362 Abs. 1 kann nur eintreten, wenn der Leistungserfolg herbeigeführt und die Leistung damit bewirkt worden ist.[6]
Beispiel 1
Der Verkäufer schuldet nicht sein Bemühen um Verschaffung des Eigentums an der Kaufsache, sondern die tatsächlich vollendete Übereignung der Sache im mangelfreien Zustand. Erfüllung tritt erst ein, wenn der Käufer Besitz und mangelfreies Eigentum erhalten hat.
Beispiel 2
Wer sich zur Unterlassung einer wiederholten Störung (etwa unlauteren Wettbewerbs) verpflichtet hat, schuldet den im Ausbleiben einer weiteren Störung zu sehenden Erfolg.
Beispiel 3
Der zur Dienstleistung Verpflichtete schuldet zwar kein besonderes Leistungsergebnis, aber immerhin das vereinbarungsgemäße Leistungsverhalten. So kann der Arzt keine Heilung versprechen, sondern immer nur sein fachmännisches Bemühen nach den anerkannten Regeln seines Fachgebietes.[7] Dieses Bemühen ist aber als Erfolg geschuldet. Unternimmt der Dienstverpflichtete gar nichts oder mangelhaft, erfüllt er seine Verpflichtung nicht.
4
Die Begründung der in § 241 Abs. 2 erwähnten Rücksichtspflichten ist hingegen nicht das Ziel des Schuldverhältnisses, sondern eine Begleiterscheinung („Schuldverhältnis kann verpflichten“). Rücksichtspflichten sind außerdem nie erfolgsbezogen, sondern immer verhaltensorientiert. Geschuldet ist also niemals ein bestimmter Erfolg, sondern immer nur ein bestimmtes Verhalten.[8]
Beispiel
A bestellt bei Gastwirt B einen „Cevapcici“-Grillteller. Beim Verzehr bricht ihm ein Zahn ab. Unter dem Aspekt einer Rücksichtspflichtverletzung im Rahmen des Bewirtungsvertrages genügt der Abbruch des Zahnes als solcher nicht, um eine Rücksichtspflichtverletzung zu begründen.[9] Nach der Verhaltenspflicht i.S.d. § 241 Abs. 2 ist eben kein bestimmter Erfolg – hier etwa Unversehrtheit von Gesundheit und Körper des Gastes – geschuldet. Eine solche umfassende Rücksichtspflicht gibt es nicht.[10] Vielmehr kommt es darauf an, ob der Gastwirt sich anders hätte verhalten müssen, weil sich in dem Fleisch ein harter Fremdkörper befand, den er hätte erkennen können. Das muss A darlegen und beweisen, weil die Beweislastumkehr des § 280 Abs. 1 S. 2 sich nur auf das Vertretenmüssen bezieht.
Ob eine Leistungs- oder Rücksichtspflicht vorliegt, ist im Zweifel durch Auslegung zu entscheiden. Maßgeblich ist, ob eine Partei von der anderen Partei nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses von vornherein ein konkretes Verhalten erzwingen kann oder ob es grundsätzlich ins Belieben der anderen Partei gestellt ist, wie sie sich bei der Durchführung des Schuldverhältnisses verhält. Im letzteren Fall sind dann nur die sich aus der Verletzung ergebenden Sekundäransprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche einklagbar.
Als Leitlinie können Sie sich an Folgendem orientieren: Immer dann, wenn eine Pflichtverletzung keine Auswirkung auf die Rechtzeitigkeit und Mängelfreiheit der geschuldeten Hauptleistung hat, ist von einer Rücksichtspflicht auszugehen.[11]
Beispiel
V räumt in seinem Ladenlokal eine auf dem Gang liegende Verpackung nicht weg. Deshalb kommt seine Kundin K zu Fall und verletzt sich. Auf die Qualität seiner Ware und die Erfüllung des Kaufvertrages hat dieser Vorfall keinen Einfluss. Im Übrigen: Wie V seinen Schutz- bzw. Verkehrssicherungspflichten nachkommt, ist seinem Ermessen überlassen. Auf das Wegräumen der Verpackung hat K keinen klagbaren Anspruch. V hätte ebenso den Gang sperren können, wenn ihm das Aufheben der Verpackung zu lästig gewesen wäre.
5
Im vorvertraglichen Schuldverhältnis gem. § 311 Abs. 2, 3 stellen sich keine Abgrenzungsschwierigkeiten, da hier noch keine Leistungspflichten, sondern lediglich Rücksichtspflichten geschuldet sind (vgl. § 311 Abs. 2).