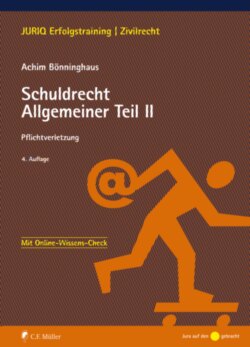Читать книгу Schuldrecht Allgemeiner Teil II - Achim Bönninghaus - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden
B. Vertretenmüssen ohne Verschulden
26
In bestimmten Fällen hat der Schuldner eine Pflichtwidrigkeit auch dann zu vertreten, wenn kein Verschulden vorliegt. Dies folgt bereits aus § 276 Abs. 1 S. 1, wonach eine „strengere“ (= verschuldensunabhängige) Haftung „bestimmt“ ist oder sich aus dem „sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses“ ergeben kann. Die „Bestimmung“ einer strengeren Haftung kann sich entweder aus dem Gesetz oder aus einer vertraglichen Vereinbarung ergeben. Es kommen folglich drei Gründe für eine verschuldensunabhängige Einstandspflicht des Schuldners in Betracht: eine gesetzliche Bestimmung, eine vertragliche Bestimmung oder der sonstige Inhalt des Schuldverhältnisses. Wir gehen die einzelnen Gründe in dieser Reihenfolge durch.
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › I. Gesetzliche Bestimmung
I. Gesetzliche Bestimmung
1. Gesetzliche Ersatzpflichten ohne Vertretenmüssen im Tatbestand
27
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Tatbestände parallel im Gesetz mit.
Verschiedene Tatbestände begründen eine Ersatzpflicht, ohne dass es tatbestandlich auf ein „Vertretenmüssen“ der zum Ersatz verpflichteten Person ankommt. In diesen Fällen spielt die Frage des Verschuldens keine Rolle.
Beispiel 1
Schadensersatzhaftung wegen Nichtigkeit einer Willenserklärung nach § 122;
Beispiel 2
Schadensersatzhaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht nach § 179;
Beispiel 3
Schadensersatzhaftung des Vermieters wegen anfänglicher Mängel des Mietobjekts aus § 536a Abs. 1 Var. 1;
Beispiel 4
Deliktische Gefährdungshaftung wegen Gefährlichkeit eines Gegenstandes aus § 833 S. 1 BGB, § 7 Abs. 1 StVG, §§ 1, 2 HaftpflG sowie aus § 1 ProdHaftG;
Beispiel 5
Entschädigungspflichten aus §§ 904 S. 2, 906 Abs. 2 S. 2.
2. Zufallshaftung nach § 287 S. 2
28
Für das Thema dieses Skripts, nämlich die Pflichtverletzung im Rahmen von Schuldverhältnissen, spielt ein anderer Tatbestand eine ganz wichtige Rolle: § 287.
Gem. § 287 S. 2 hat der Schuldner während des Verzuges „wegen der Leistung“ auch „Zufall“ zu vertreten, sofern der Verzug für den Schadenseintritt kausal gewesen ist. Unter dem Begriff „Zufall“ ist ein ohne Verschulden des Schuldners eingetretenes Leistungshindernis i.S.d. § 275 zu verstehen, insbesondere Unmöglichkeit durch höhere Gewalt.[1]
Hinweis
Für die Schadensersatzhaftung wegen Verletzung einer Rücksichtspflicht i.S.v. § 241 Abs. 2 gilt die Haftungsverschärfung des § 287 S. 2 nicht!
Beispiel
Antiquitätenhändler V verkauft dem K eine antike Standuhr, die V dem K am nächsten Tag liefern soll. V organisiert den Transport aber nicht rechtzeitig, so dass die Lieferung am nächsten Tag ausbleibt. In der darauffolgenden Nacht brechen Diebe in die – ordnungsgemäß gesicherten – Geschäftsräume des V ein und nehmen unter anderem die Uhr mit. Die Diebe verschwinden spurlos. Schadensersatzansprüche statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 scheitern hier an der fehlenden Fristsetzung. Sie ergeben sich jedoch aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283, da der V sein mit dem Diebstahl verbundenes Unvermögen i.S.d. § 275 Abs. 1 zur Leistung nach § 287 S. 2 auch ohne Verschulden zu vertreten hat. Er befand sich nach §§ 286 Abs. 2 Nr. 1, 286 Abs. 4 mit seiner Leistung in Schuldnerverzug und kann sich auch nicht auf die Ausnahme des 287 S. 2 Hs. 2 berufen. Hätte er zum vereinbarten Fälligkeitstermin geliefert, hätte die Uhr nicht mehr Teil der Diebesbeute sein können.
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › II. Geldmangel
II. Geldmangel
29
Auch ohne ausdrückliche Regelung ist allgemein anerkannt, dass für die Erfüllung von Geldsummenschulden stets verschuldensunabhängig gehaftet wird und auch bei sonstigen Schulden der Einwand fehlender Finanzkraft unbeachtlich ist.[2]
Beispiel 1
M schuldet seinem Vermieter V die monatlich im Voraus zu zahlende Miete für drei Monate. Hier tritt Verzug nach § 286 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 auch dann ein, wenn M aufgrund Insolvenz seines Arbeitgebers unverschuldet arbeitslos geworden ist und deshalb über keine ausreichenden Finanzmittel mehr verfügt.
Beispiel 2
A verpflichtet sich gegenüber dem B, auf dessen Grundstück ein Haus zu errichten. A gehen jedoch die finanziellen Mittel aus, so dass er nicht in der Lage ist, sich die nötigen Baustoffe zu beschaffen. Hier tritt Verzug mit der Werkherstellung auch dann ein, wenn A seine Liquiditätsprobleme nicht verschuldet hat (etwa weil seine sonstigen Kunden ihre fälligen Rechnungen alle nicht bezahlen).
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › III. Vertragliche Übernahme
III. Vertragliche Übernahme
30
Aus dem Prinzip der Privatautonomie folgt, dass jeder Schuldner sich vertraglich zur Übernahme einer verschuldensunabhängigen Haftung verpflichten kann, so dass dann aufgrund der vertraglichen Regelung eine „strengere“ Haftung bestimmt ist. Dazu wird sich ein Schuldner allerdings selten freiwillig hinreißen lassen.
31
Viel häufiger kommt es vor, dass eine solche Haftungsverschärfung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Vertragspartners enthalten ist.
Beispiel
Die Klausel „Der Mieter haftet für alle Schäden am Mietobjekt, die durch ihn verursacht wurden.“ stellt allein auf die Verursachung im Sinne einer Kausalität ab – zumindest ist ein solches Verständnis nach § 305c Abs. 2 zugrunde zu legen. Der Mieter eines Pkw würde nach dieser Klausel auch dann auf Schadensersatz haften, wenn er beim Fahren des Pkw schuldlos in einen Auffahrunfall verwickelt wird.
Da eine solche Bestimmung vom wesentlichen Grundgedanken des § 276 Abs. 1 abweicht, nach dem der Schuldner grundsätzlich nur Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, stellt eine solche Klausel regelmäßig eine unangemessene Benachteiligung gem. § 307 Abs. 2 Nr. 1 dar.[3] Für die Verwendung der Klausel gegenüber einem Verbraucher gilt dies ausnahmslos. Bei Verwendung gegenüber einem Unternehmer gilt dies im Prinzip ebenfalls, wobei hier Ausnahmen aufgrund besonders günstiger, die strenge Haftung ausgleichender Gesamtkonditionen in Betracht kommen.[4]
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › IV. „Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
IV. „Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
32
Schließlich kann sich nach § 276 Abs. 1 S. 1 eine verschuldensunabhängige Haftung auch aus dem „sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses“ ergeben. Beispielhaft nennt die Vorschrift die Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.
1. Garantieübernahme
33
Bei der Garantie macht der Schuldner deutlich, in besonderer Weise für einen bestimmten Erfolg „mit seinem Namen“ einstehen zu wollen. In diesem Zusammenhang kommen insbesondere Eigenschaftszusicherungen in Betracht, bei denen ein Vertragspartner, z.B. der Verkäufer, für bestimmte Vorzüge des Leistungsgegenstandes wirbt.[5]
Eine Zusicherung im Sinn einer Garantie liegt vor, wenn der Verkäufer vertraglich die Gewähr für das Vorhandensein einer Beschaffenheit übernimmt und dabei seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen des Fehlens dieser Beschaffenheit uneingeschränkt einstehen zu wollen.[6]
34
Eine besondere Form sieht das Gesetz für die Garantieübernahme als solche nicht vor.
Beispiel
V verkauft dem K einen gebrauchten Pkw und teilt dem K mit, der Wagen habe „keine Unfallschäden“.
Die Frage, ob die Angabe „keine Unfallschäden“ lediglich als Beschaffenheitsangabe (§ 434 Abs. 1 S. 1) oder aber als Beschaffenheitsgarantie i.S.d. § 443 Abs. 1 zu werten ist, ist durch Auslegung nach §§ 133, 157 zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass an eine Garantie einschneidende Rechtsfolgen geknüpft sind, wie sich aus der Haftungsverschärfung nach den Regeln der §§ 276 Abs. 1, 442 Abs. 1 S. 2 Var. 2, 444 Hs. 2 Var. 2 ergibt.
Handelt es sich bei dem Verkäufer um einen Gebrauchtwagenhändler, so ist die Interessenlage typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass der Käufer sich auf die besondere, ihm in aller Regel fehlende, Erfahrung und Sachkunde des Händlers verlässt. Er wird daher zumindest bei Angaben auf seine ausdrückliche Nachfrage erkennbar darauf vertrauen, dass der Händler sich für seine Angaben zur Beschaffenheit des Fahrzeuges „stark macht", diese mithin „garantiert“.[7] Anders liegt es dann, wenn der Händler für die von ihm angegebenen Beschaffenheiten eine hinreichend deutliche Einschränkung zum Ausdruck bringt, indem er etwa darauf hinweist, dass er die Angaben nicht überprüft hat[8] (z.B. „laut Vorbesitzer keine Unfällschäden“[9]).
Auf den Kauf direkt vom Privatmann trifft die für den gewerblichen Verkauf maßgebliche Erwägung, dass der Käufer sich in der Regel auf die besondere Erfahrung und Sachkunde des Händlers verlässt und in dessen Erklärungen daher die konkludente Übernahme einer Garantie sieht, nicht zu.[10] Insbesondere bei Angaben über technische Beschaffenheiten kann der Käufer beim Privatverkauf eines Gebrauchtfahrzeugs nicht davon ausgehen, der Verkäufer wolle für die Richtigkeit dieser Angabe unter allen Umständen einstehen und gegebenenfalls auch ohne Verschulden auf Schadensersatz haften. Will der Käufer beim Gebrauchtwagenkauf unter Privatpersonen eine Garantie für Beschaffenheiten (z.B. Laufleistung, Unfallfreiheit) des Fahrzeugs haben, muss er sich diese regelmäßig ausdrücklich von dem Verkäufer geben lassen.[11] Von einer stillschweigenden Garantieübernahme kann beim Privatverkauf eines Gebrauchtfahrzeugs daher nur ausnahmsweise bei besonderen Umständen ausgegangen werden.
2. Übernahme eines Beschaffungsrisikos
35
Ferner kann es sein, dass ein Vertragspartner im Vertrag ein besonderes Beschaffungsrisiko übernommen hat.
36
Regelmäßig ist mit der Vereinbarung einer Gattungsschuld, die nicht auf einen bestimmten Vorrat beschränkt wird, aus Sicht des Käufers zugleich die Übernahme des Risikos für die typischen Beschaffungshindernisse verbunden.[12] Schließlich erklärt der Lieferant mit dem Versprechen einer solchen Leistung konkludent, er könne die Ware beschaffen. Dies gilt umso mehr, wenn der Lieferant zugleich Hersteller der Ware ist. Wenn der Verkäufer das Beschaffungsrisiko nicht übernehmen will, muss er dies zum Ausdruck bringen. Dem dient die häufig verwendete Klausel „Selbstbelieferung vorbehalten“.
Hinweis
Nach überwiegender Ansicht bezieht sich dieses Beschaffungsrisiko nur auf das Risiko, die Leistung überhaupt und rechtzeitig erfüllen zu können. Für das Risiko einer Schlechtleistung ist hingegen nur bei einer zusätzlichen Beschaffenheitsgarantie verschuldensunabhängig einzustehen.[13]
Beispiel 1
Händler H importiert Ware aus Fernost. Am 1.3. verkauft er dem Einzelhändler K 5000 Fußbälle, die am 1.6. ausgeliefert werden sollen. Nun erfährt der H, dass sein chinesischer Lieferant die Produktion der Fußbälle eingestellt hat und er sich um einen neuen Lieferanten bemühen muss. Er wird erst am 30.4. mit einem anderen Lieferanten handelseinig, so dass sich der Auslieferungstermin um 1 Monat verschiebt. Die Leistungsverzögerung hat H zu vertreten, da er das Beschaffungsrisiko übernommen hat und Ausfälle einzelner Lieferanten zum typischen Risiko einer marktbezogenen Gattungsschuld gehören.
Beispiel 2
Anders läge es, wenn sich erst nach Vertragsschluss herausstellt, dass die Ausstattung der verkauften Fußbälle inländische Schutzrechte Dritter verletzt und die Fußbälle deshalb weder importiert noch in Deutschland weiter vertrieben werden dürfen.[14] Denn schließlich gehört die fehlende Vertriebsmöglichkeit der Fußbälle nicht zum Beschaffungsrisiko, sondern zum Risiko der Rechtsmängelfreiheit, die H nicht garantiert hat. Die Fußbälle hätten auch bei rechtzeitiger Beschaffung nicht vertrieben werden dürfen. Hier haftet H nur bei schuldhafter Unkenntnis.