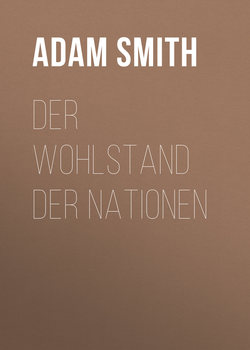Читать книгу Der Wohlstand der Nationen - Адам Смит, Adam Smith - Страница 14
Erstes Buch
Von den Ursachen der Zunahme in der Ertragskraft der Arbeit und von den Regeln, nach welchen ihr Ertrag sich naturgemäß unter die verschiedenen Volksklassen verteilt
Zehntes Kapitel
Lohn und Gewinn in den verschiedenen Verwendungen der Arbeit und des Kapitals
Zweite Abteilung
Ungleichheiten, welche durch die europäische Wirtschaftspolitik veranlasst sind
ОглавлениеDies sind die in der Gesamtheit der Vorteile und Nachteile bei den verschiedenen Arbeits- und Kapitalanlagen vorkommenden Ungleichheiten, welche die Abwesenheit eines der drei oben erwähnten Erfordernisse auch da veranlasst, wo die vollkommenste Freiheit herrscht. Aber andere viel bedeutendere Ungleichheiten veranlasst die europäische Wirtschaftspolitik dadurch, dass sie den Dingen nicht ihre volle Freiheit lässt.
Dies geschieht vornehmlich auf dreierlei Weise. Erstens dadurch, dass in gewissen Gewerben die Konkurrenz auf eine geringere Anzahl von Mitwerbern beschränkt wird als sich sonst damit befassen würden; zweitens dadurch, dass in anderen die Mitwerber über das natürliche Maß vermehrt werden und drittens dadurch, dass die freie Bewegung von Arbeit und Kapital, sowohl von Gewerbe zu Gewerbe als von Ort zu Ort gehemmt wird.
Erstens, die europäische Wirtschaftspolitik veranlasst eine sehr bedeutende Ungleichheit in der Gesamtheit der Vorteile und Nachteile bei den verschiedenen Arbeits- und Kapitalanlagen dadurch, dass sie in gewissen Gewerben die Konkurrenz auf eine geringere Anzahl von Mitwerbern beschränkt, als sich sonst damit befassen würden.
Die ausschließlichen Zunftprivilegien sind das hauptsächlichste Mittel, dessen sie sich zu diesem Zwecke bedient.
Das ausschließliche Privilegium eines zünftigen Gewerbes schränkt notwendig in der Stadt, in der es betrieben wird, den Wettbewerb auf diejenigen ein, die zur Zunft gehören. Das notwendige Erfordernis zur Erlangung des Zunftrechts besteht gewöhnlich darin, dass man in der Stadt unter einem gehörig qualifizierten Meister gelernt hat. Die Zunftordnungen bestimmen öfters die Zahl der Lehrlinge, welche einem Meister zu halten gestattet ist, und fast immer die Zahl der Jahre, die ein Lehrling dienen muss. Die Absicht dieser beiden Bestimmungen geht dahin, die Konkurrenz auf eine geringere Anzahl einzuschränken als sich sonst auf das Geschäft einlassen würden. Die Beschränkung der Zahl der Lehrlinge beschränkt den Wettbewerb direkt; eine lange Lehrzeit tut es mehr indirekt, aber ebenso wirksam durch die vermehrten Kosten der Ausbildung.
In Sheffield kann zufolge eines Ortsstatuts der Zunft kein Messerschmidt zu gleicher Zeit mehr als einen Lehrling halten. In Norfolk und Norwich kann kein Webermeister, bei Strafe von fünf Pfund monatlich, mehr als zwei Lehrlinge haben. In ganz England und den englischen Kolonien darf ein Hutmacher nicht mehr als zwei Lehrlinge haben, bei Strafe von fünf Pfund monatlich, die halb dem Fiskus und halb dem Angeber zufallen. Diese beiden Bestimmungen sind, obgleich sie durch ein allgemeines Staatsgesetz bestätigt sind, offenbar von demselben Zunftgeiste diktiert, der die Sheffielder Verordnung eingegeben hat. Kaum waren die Seidenwirker in London ein Jahr lang eine Zunft als sie auch schon eine Verordnung erließen, die jedem Meister untersagte, mehr als zwei Lehrlinge zu gleicher Zeit zu haben. Es bedurfte einer eigenen Parlamentsakte, um dieses Ortsstatut umzustoßen.
In früherer Zeit scheinen sieben Jahre in ganz Europa der übliche Zeitraum gewesen zu sein, der für die Dauer der Lehrjahre in den meisten zünftigen Gewerben festgesetzt war. Alle diese Zünfte wurden früher Universitäten genannt, was in der Tat der eigentliche lateinische Name für jede Körperschaft ist. Die Universität der Schmiede, die Universität der Schneider usw. sind Ausdrücke, denen man in den vergilbten Dokumenten alter Städte oft begegnet. Als jene besonderen Korporationen, die man noch jetzt Universitäten nennt, gegründet wurden, hat man augenscheinlich die Anzahl der Jahre, die man studieren musste, um den Grad eines Magisters der freien Künste zu erlangen, von den Feststellungen der Lehrzeit in den gewöhnlichen Gewerben, deren Vereinigungen viel älter waren, kopiert. Wie man sieben Jahre unter einem gehörig qualifizierten Meister gearbeitet haben musste, wenn man in einem gewöhnlichen Gewerbe die Berechtigung, Meister zu werden und selber Lehrlinge zu halten erwerben wollte, so musste man auch sieben Jahre unter einem gehörig qualifizierten Meister studiert haben, um das Recht zu erwerben, in den freien Künsten Magister, Lehrer oder Doktor (früherhin gleichbedeutende Wörter) zu werden, und Schüler oder Lehrlinge (ursprünglich ebenfalls gleichbedeutende Ausdrücke) zu haben, die unter dem Meister studierten.
Durch ein Statut ans dem fünften Jahre Elisabeths, gewöhnlich das Lehrzeitstatut genannt, wurde bestimmt, dass in Zukunft niemand ein zu jener Zeit in England betriebenes Handwerk, Gewerbe oder Geschäft treiben sollte, wenn er nicht zuvor darin wenigstens sieben Lehrjahre bestanden hätte; und was früher bloßes Ortsstatut einzelner Zünfte gewesen war, wurde nun in England allgemeines Staatsgesetz für alle in Marktstädten betriebenen Geschäfte. Die Worte des Statuts lauten zwar ganz allgemein, und scheinen das ganze Königreich zu umfassen, doch ist seine Wirkung durch Auslegung auf die Marktstädte beschränkt worden, weil man dafür hielt, dass auf dem Lande dieselbe Person verschiedene Gewerbe müsse treiben können, auch ohne in jedem sieben Jahre gelernt zu haben, da Handwerker für den Bedarf der Einwohner nötig, und diese doch nicht immer zahlreich genug sind, um einen Mann, der nur sein Handwerk betreibt, zu ernähren.
Ferner ist durch eine strenge Auslegung der Worte die Wirkung dieses Statuts auf die Gewerbe beschränkt worden, welche in England vor dem fünften Regierungsjahre Elisabeths bestanden haben, und niemals auf solche ausgedehnt worden, die seit jener Zeit erst eingeführt worden sind. Diese Beschränkung hat zu einigen Unterscheidungen Anlass gegeben, die als Maßregeln der Wirtschaftspolitik betrachtet, so töricht als möglich erscheinen. So ist z. B. entschieden worden, dass ein Wagner seine Wagenräder weder selbst machen, noch durch Gesellen machen lassen darf, sondern sie von einem Radmachermeister kaufen muss, weil letzteres Handwerk schon vor dem fünften Regierungsjahre Elisabeths existiert hat. Dagegen kann ein Radmacher, wenn er auch niemals bei einem Wagner in der Lehre gewesen ist, selbst Wagen machen oder von Gesellen machen lassen, weil das Gewerbe eines Wagners in dem Statut nicht inbegriffen ist, da es in England zur Zeit, als jenes erlassen worden ist, noch nicht bestanden hat. Viele Gewerbe zu Manchester, Birmingham und Wolverhampton sind dem Statut ebenfalls nicht unterworfen, weil sie vor dem fünften Regierungsjahre Elisabeths in England nicht betrieben worden sind.
In Frankreich ist die Dauer der Lehrjahre in verschiedenen Städten und Gewerben verschieden. In Paris sind bei vielen fünf Jahre der vorgeschriebene Zeitraum; ehe jemand jedoch das Recht erhält, das Gewerbe als Meister zu treiben, muss er in vielen Gewerben noch fünf Jahre als Gehilfe gearbeitet haben. In dieser Zeit heißt er der Geselle seines Meisters, und die Zeit selbst heißt seine Gesellenschaft.
In Schottland gibt es kein allgemeines Gesetz, das die Dauer der Lehrjahre überhaupt bestimmte; die Zeit ist in den einzelnen Zünften verschieden. Wo sie lang ist, kann in der Regel ein Teil von ihr durch eine kleine Geldsumme abgelöst werden. Auch ist in den meisten Städten eine sehr mäßige Summe hinreichend, um die Zunftgerechtigkeit zu erkaufen. Die Weber von leinenen und hänfenen Zeugen – das Hauptgewerbe des Landes – sowie alle die für sie beschäftigten Handwerker, wie die Verfertiger der Spinnräder, Haspeln usw., können ihr Gewerbe in jeder korporierten Stadt treiben, ohne etwas dafür zu zahlen. In allen korporierten Städten steht es jedermann frei, an einem vom Gesetz bestimmten Wochentage Fleisch zu verkaufen. Drei Jahre sind in Schottland die gewöhnliche Zeit der Lehrjahre selbst in manchen recht schwierigen Gewerben; und im Allgemeinen kenne ich kein Land in Europa, in dem die Zunftgesetze so wenig drückend wären.
Wie das Eigentum, das jeder an seiner Arbeit hat, die ursprüngliche Grundlage alles anderen Eigentums ist, so ist es auch die heiligste und unverletzlichste. Das Erbteil eines armen Mannes liegt in der Kraft und Geschicklichkeit seiner Hände: ihn zu hindern, diese Kraft und Geschicklichkeit so anzuwenden, wie er es passend findet, ohne dadurch seinen Nächsten zu schädigen, ist eine klare Verletzung dieses heiligsten Eigentums. Es ist ein offenbarer Eingriff in die rechtmäßige Freiheit sowohl des Arbeiters, wie derer, die ihn beschäftigen wollen. Wie es den einen hindert, das zu arbeiten, wozu er sich am geschicktesten weiß, so hindert es die anderen, solche zu beschäftigen, die ihnen geeignet erscheinen. Das Urteil darüber, ob jemand sich für die Arbeit eignet, kann sicherlich den Arbeitgebern überlassen werden, deren Interesse es so nahe angeht. Die erheuchelte Ängstlichkeit des Gesetzgebers, sie könnten einen ungeeigneten Menschen beschäftigen, ist offenbar ebenso ungehörig wie lästig.
Die Anordnung einer langen Lehrzeit kann keine Sicherheit gewähren, dass nicht oft mangelhafte Arbeit zum Verkauf komme. Wenn dies geschieht, so ist gewöhnlich Betrug und nicht Ungeschicklichkeit daran schuld; gegen Betrug aber kann auch die längste Lehrzeit keinen Schutz bieten. Zur Abstellung dieses Missbrauchs sind ganz andere Vorkehrungen erforderlich. Die Marke auf Geschirr von Gold und Silber und die Stempel auf Leinen- und Wollenzeug geben dem Käufer eine weit größere Sicherheit als irgendein Lehrlingsstatut. Auf jene sieht er in der Regel, aber niemals hält er es der Mühe wert, zu untersuchen, ob der Arbeiter eine siebenjährige Lehrzeit bestanden habe.
Die Anordnung einer langen Lehrzeit hat nicht den Erfolg, die jungen Leute an Fleiß zu gewöhnen. Ein Geselle, der nach dem Stück arbeitet, wird wahrscheinlich fleißig sein, weil er von seinem Fleiße Vorteil hat; ein Lehrling wird voraussichtlich faul sein, und ist es fast immer, weil er kein unmittelbares Interesse hat fleißig zu sein. In den niedrigeren Geschäften besteht der Reiz der Arbeit durchaus nur in ihrem Lohn. Wer am frühesten in der Lage ist, die Früchte der Arbeit zu genießen, wird auch am schnellsten Geschmack daran finden und sich frühzeitig an Fleiß gewöhnen. Ein junger Mensch fasst natürlich eine Art Abneigung gegen die Arbeit, wenn er lange Zeit keinen Gewinn aus ihr zieht. Die Knaben, welche auf Kosten der öffentlichen Armenpflege in die Lehre gegeben werden, müssen in der Regel eine längere Reihe von Jahren als sonst üblich, darin bleiben, und werden gewöhnlich Faulenzer und Taugenichtse.
Bei den Alten war das Lehrlingswesen ganz unbekannt. Dagegen machen die gegenseitigen Pflichten des Meisters und Lehrlings in jedem modernen Gesetzbuch einen starken Artikel aus. Das römische Recht schweigt darüber gänzlich, und ich kenne kein griechisches oder lateinisches Wort, und ich darf wohl behaupten, es gibt keines, welches den Begriff ausdrückt, den wir heute mit dem Worte Lehrling verbinden, nämlich einen Dienenden, der in einem bestimmten Gewerbe eine Reihe von Jahren hindurch zum Vorteil eines Meisters zu arbeiten verpflichtet ist unter der Bedingung, dass der Meister ihn dies Gewerbe lehrt.
Eine lange Lehrzeit ist durchaus unnötig. Künste, die weit höher stehen, als gewöhnliche Handwerke, wie z. B. die Uhrmacherkunst, enthalten keine Geheimnisse, die einen langen Unterrichtskursus erforderten. Die erste Erfindung so schöner Maschinen, und auch die Erfindung einiger zu ihrer Verfertigung nötigen Werkzeuge musste allerdings das Ergebnis eines tiefen Nachdenkens und langer Zeit sein, und kann mit Recht zu den glücklichsten Früchten des menschlichen Geistes gezählt werden. Aber nachdem sie einmal erfunden und vollkommen bekannt sind, kann es kaum den Unterricht einiger Wochen erfordern, einen jungen Menschen mit der Handhabung der Werkzeuge und dem Bau der Maschinen vertraut zu machen. Vielleicht reichen schon ein paar Tage dazu hin, und in den gewöhnlichen Handwerken ist dies sicher der Fall. Die Fertigkeit der Hand kann allerdings selbst in gewöhnlichen Handwerken nicht ohne viele Übung und Erfahrung erworben werden. Aber ein junger Mensch würde viel fleißiger und aufmerksamer sein, wenn er von Anfang an als Geselle arbeitete und nach Verhältnis seiner geringen Leistungen bezahlt würde, seinerseits aber die Rohstoffe bezahlte, die er etwa aus Ungeschicklichkeit und Unerfahrenheit zuweilen verdirbt. Seine Ausbildung würde auf diese Weise gewöhnlich erfolgreicher und stets weniger langwierig und kostspielig sein. Der Meister würde dabei allerdings verlieren. Er würde den Lohn des Lehrlings, den er jetzt spart, volle sieben Jahre hindurch verlieren. Am Ende wäre vielleicht auch der Lehrbursche selbst im Verluste: denn er würde in einem so leicht erlernten Gewerbe mehr Konkurrenten haben, und sein Lohn würde, sobald er ein ausgelernter Handwerker geworden, viel geringer sein als jetzt. Dieselbe Zunahme des Wettbewerbs würde ebenso den Gewinn der Meister wie den Lohn der Arbeiter vermindern. Die Geschäfte, die Gewerbe, die Geheimnisse würden alle dabei verlieren. Aber das Publikum würde dabei gewinnen, da alle Handwerkserzeugnisse viel wohlfeiler zu Markte kämen.
Gerade um dieses Sinken des Preises und folgeweise des Lohnes und Gewinnes durch Hemmung der freien Konkurrenz, die zu einem solchen führen würde, zu verhindern, sind alle Zünfte und die meisten Zunftgesetze eingeführt worden. Zur Errichtung einer Zunft bedurfte es in früheren Zeiten an vielen Orten Europas keiner anderen Genehmigung als der der korporierten Stadt, in welcher sie eingeführt wurde. In England war zwar auch ein Privilegium des Königs nötig; aber dieses Vorrecht der Krone scheint mehr den Zweck gehabt zu haben, Geld von dem Untertanen zu erpressen als die allgemeine Freiheit gegen drückende Monopole zu schützen. Wenn dem Könige eine Geldsumme gezahlt wurde, scheint das Privilegium in der Pegel gern bewilligt worden zu sein, und wenn eine Klasse von Gewerbsleuten es für angemessen hielt, ohne ein Privilegium als Zunft aufzutreten, so wurden solche unechte Gilden, wie man sie nannte, nicht immer ihrer Vorrechte beraubt, sondern nur genötigt, für die Erlaubnis, ihre usurpierten Rechte auszuüben, jährlich eine Geldsumme an den König zu entrichten. Die unmittelbare Aufsicht über alle Zünfte und über die Ortsstatuten, welche sie behufs ihrer Verwaltung zu erlassen für gut fanden, hatte die korporierte Stadt, in der sie sich befanden, zu führen; und die Disziplin, in der sie gehalten wurden, ging in der Regel nicht von der Regierung, sondern von der größeren Körperschaft aus, deren untergeordnete Teile oder Glieder sie waren.
Die Regierung der korporierten Städte war durchaus in den Händen der Geschäftsleute und Handwerker, und es lag offenbar im Interesse jeder Klasse, zu verhindern, dass der Markt, wie sie sich auszudrücken pflegten, mit den Produkten ihres besonderen Gewerbszweiges überführt wurde, was in Wirklichkeit nichts anderes heißt als dass er niemals vollständig versorgt wurde. Jede Klasse war beeifert, zu diesem Zweck geeignete Verordnungen zu erlassen, und war, was ihr erlaubt wurde, gern bereit, auch den andern Klassen zu gestatten. Durch solche Verordnungen wurde freilich jede Klasse gezwungen, die Waren, die sie brauchte, von einer anderen Klasse in der Stadt etwas teurer zu kaufen als es sonst nötig gewesen wäre. Zum Ersatz konnte sie aber auch die ihrigen um so viel teurer verkaufen, so dass es, wie man zu sagen pflegt, so lang wie breit war, und in dem Handel der verschiedenen Klassen innerhalb der Stadt keine durch jene Verordnungen etwas verlor. Aus dem Verkehr mit dem Lande dagegen zogen sie großen Gewinn, und in diesem Verkehr besteht das ganze Geschäft, das jede Stadt aufrecht erhält und bereichert.
Jede Stadt bezieht ihren ganzen Unterhalt und alle Rohstoffe für ihren Gewerbfleiß von dem Lande. Sie bezahlt dafür besonders auf zweierlei Art: erstens dadurch, dass sie einen Teil dieser Rohstoffe verarbeitet und nach dem Lande zurückschickt, in welchem Falle ihr Preis durch den Lohn der Arbeiter und den Gewinn ihrer Meister oder unmittelbaren Arbeitgeber vermehrt wird, und zweitens dadurch, dass sie einen Teil sowohl der rohen wie der verarbeiteten Produkte anderer Länder oder entfernter Gegenden desselben Landes in die Stadt einführt und wieder nach dem platten Lande ausführt, in welchem Falle gleichfalls der ursprüngliche Preis dieser Güter um den Lohn der Fuhrleute oder Schiffer, und um den Gewinn der Kaufleute, die letztere beschäftigen, erhöht wird. In den Gewinnen aus dem ersteren dieser Handelszweige besteht der Vorteil, den die Stadt von ihren Gewerben hat, und in den Gewinnen aus dem letzteren besteht der Vorteil des in- und ausländischen Handels. Der Lohn der Arbeiter und der Gewinn der verschiedenen Arbeitgeber ist alles, was in beiden Fällen gewonnen wird. Daher dienen alle Verordnungen, welche diesen Lohn und diesen Gewinn über ihren sonstigen Stand zu erhöhen bezwecken, nur dazu, dass die Stadt mit weniger Arbeit das Produkt einer größeren Arbeit des platten Landes kaufen kann. Sie geben den Geschäftsleuten und Handwerkern der Stadt ein Übergewicht über die Gutsbesitzer, Pächter und Arbeiter des platten Landes, und heben die natürliche Gleichheit auf, welche sonst in dem zwischen ihnen stattfindenden Verkehr Platz greifen würde. Das ganze Jahresprodukt der Arbeit der Gesellschaft verteilt sich jährlich unter diese beiden Klassen der Bevölkerung, und durch jene Verordnungen erhalten die Städter einen größeren und die Landbewohner einen kleineren Anteil als er ihnen sonst zufallen würde.
Der Preis, den die Stadt für die Jahr für Jahr eingeführten Lebensmittel und Rohstoffe wirklich bezahlt, besteht in der Menge der Industrieerzeugnisse und anderen Waren, die jährlich von ihr ausgeführt wird. Je teurer die letzteren verkauft werden, desto wohlfeiler werden die ersteren gekauft, und der städtische Gewerbfleiß wird desto gewinnbringender, je weniger es der ländliche ist.
Dass der städtische Gewerbfleiß in ganz Europa einträglicher ist als der ländliche, davon kann man sich, ohne auf sehr genaue Berechnungen einzugehen, leicht durch eine einfache, in die Augen fallende Beobachtung überzeugen. In jedem Lande Europas findet man wenigstens hundert Leute, die in Handel und Gewerbe, den eigentlich städtischen Beschäftigungen, klein angefangen haben und dabei reich geworden sind, gegen einen, der durch Landwirtschaft, d. h. Vermehrung der Rohprodukte durch Verbesserung und Kultur des Bodens dazu gelangte. Es muss also in dem einen Falle offenbar der Fleiß besser belohnt und der Arbeitslohn und Kapitalgewinn größer sein als in dem anderen. Da aber Kapital und Arbeit naturgemäß die einträglichste Beschäftigung suchen, so ziehen sie sich so viel als möglich nach der Stadt, und verlassen das Land.
Die Städter können vermöge ihres nahen Beisammenwohnens sich leicht miteinander vereinbaren. Selbst die unbedeutendsten Gewerbe sind daher hier oder dort zu Zünften zusammengetreten, und wo sie keine Zunft bildeten, war doch der Zunftgeist, die Eifersucht gegen Fremde, die Abneigung, Lehrlinge anzunehmen, oder ihr Gewerbsgeheimnis mitzuteilen, im Allgemeinen unter ihnen stark, und lehrte sie oft, durch freiwillige Verbindungen und Übereinkünfte den freien Wettbewerb, den sie nicht durch Verordnungen verbieten konnten, zu hemmen. Gewerbe, die nur wenige Hände beschäftigen, treffen solche Verabredungen am leichtesten. Ein halbes Dutzend Wollkämmer reicht wohl hin, um tausend Spinnern und Webern das Material zu liefern. Wenn sie übereinkommen, keine Lehrlinge zu nehmen, so können sie nicht nur das ganze Geschäft an sich reißen, sondern auch die gesamte Manufaktur in eine Art von sklavischer Abhängigkeit bringen, und den Preis ihrer Arbeit weit höher treiben als er ihrer Natur nach wäre.
Die Bewohner des platten Landes können in ihrer Zerstreuung über verschiedene Orte nicht leicht derartige Vereinigungen zustande bringen. Sie haben nicht nur niemals eine Zunft gebildet, sondern der Zunftgeist ist auch niemals unter ihnen herrschend geworden. Nie hat man Lehrjahre zur Erlernung der Landwirtschaft, des großen ländlichen Gewerbes, für nötig gehalten. Und doch gibt es nächst den schönen Künsten und freien Berufsarten. vielleicht kein Gewerbe, das eine solche Mannigfaltigkeit von Kenntnissen und Erfahrungen voraussetzt. Die zahllosen Bücher, die darüber in allen Sprachen geschrieben worden sind, können uns den Beweis liefern, dass die Landwirtschaft unter den weisesten und unterrichtetsten Nationen niemals für eine ganz leicht zu begreifende Sache gehalten worden ist. Und in allen diesen Büchern würde man vergebens jene Kenntnis der mancherlei zusammengesetzten Handgriffe suchen, die jeder gewöhnliche Landmann zu besitzen pflegt, so affektiert hochmütig auch die verächtlichen Verfasser einiger dieser Bücher von ihnen sprechen. Dagegen gibt es kaum irgendein gewöhnliches Handwerk, dessen Fertigkeiten sich nicht in einem Büchlein von wenigen Seiten so vollständig und deutlich darstellen ließen als es durch Wort und Zeichnung überhaupt möglich ist. In der Geschichte der Gewerbe (Histoire des Arts et Métiers), welche jetzt von der französischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird, sind einige von ihnen auf diese Art beschrieben worden. Überdies erfordert die Leitung diejenigen Tätigkeiten, die sich nach jedem Wetterwechsel und anderen Zufällen richten müssen, viel mehr Urteil und Vorsichtigkeit als bei immer ganz oder beinahe gleichbleibenden Handlungen erforderlich ist.
Aber nicht nur die Kunst des Landwirts: die allgemeine Leitung der landwirtschaftlichen Operationen, sondern auch viele untergeordnete Zweige der ländlichen Arbeit erfordern viel mehr Geschicklichkeit und Erfahrung als die meisten Handwerke. Der Mann, der Messing und Eisen bearbeitet, arbeitet mit Werkzeugen und Rohstoffen, deren Beschaffenheit sich immer völlig oder beinahe gleichbleibt. Der Mann dagegen, der den Boden mit einem Gespann Pferden oder Ochsen pflügt, arbeitet mit Werkzeugen, deren Gesundheit, Kraft und Temperament in verschiedenen Fällen sehr verschieden sind. Die Beschaffenheit der Stoffe, die er bearbeitet, ist ebenso verschieden, wie es seine Werkzeuge sind, und beide müssen mit vielem Urteil und großer Vorsicht behandelt werden. Der gewöhnliche Bauer, der in der Regel als ein Muster von Einfalt und Dummheit angesehen wird, ermangelt dieses Urteils und dieser Vorsicht nur selten. Allerdings ist er weniger an geselligen Umgang gewöhnt als der in der Stadt lebende Handwerker: seine Stimme und Sprache ist rauer und für den, der nicht daran gewöhnt ist, schwerer zu verstehen; aber sein Verstand, der sich täglich mit einer größeren Mannigfaltigkeit von Gegenständen beschäftigen muss, ist in der Regel dem der anderen, deren ganze Aufmerksamkeit vom Morgen bis zum Abend an eine oder zwei höchst einfache Verrichtungen gefesselt ist, weit überlegen. Wie sehr in der Tat die niederen Volksklassen auf dem Lande denen in der Stadt überlegen sind, weiß jeder, der durch Geschäfte oder Neugierde veranlasst war, viel mit beiden zu verkehren. Darum sollen auch in China und Hindostan der Rang und die Löhne der Landleute höher sein als die der meisten Handwerker. Verhinderten dies nicht die Zunftgesetze und der Zunftgeist, so wäre es wahrscheinlich allerorten so.
Die Überlegenheit, welche der städtische Gewerbfleiß in ganz Europa über den ländlichen behauptet, hat freilich ihren Grund nicht ausschließlich in den Zünften und Zunftgesetzen; sie wird auch durch andere Maßregeln aufrechterhalten. Die hohen Steuern auf fremde Industrieerzeugnisse und alle von auswärtigen Kaufleuten eingeführten Waren haben denselben Zweck. Die Zunftgesetze ermöglichen es den Städtern, ihre Preise zu erhöhen, ohne befürchten zu müssen, durch die freie Konkurrenz ihrer eignen Landsleute bedrängt zu werden; jene andern Maßregeln sichern sie gleicher Weise gegen die Konkurrenz der Fremden. Diese doppelte Preiserhöhung muss am Ende von den Gutsbesitzern, Pächtern und Bauern bezahlt werden, die sich selten der Errichtung solcher Monopole widersetzt haben. Sie haben gewöhnlich weder Neigung noch Geschick, Vereinigungen zu bilden und lassen sich leicht durch das Geschrei und die Sophisterei der Kaufleute und Gewerbetreibenden überreden, dass das Privatinteresse eines Teils, und noch dazu eines untergeordneten Teils der Gesellschaft, das allgemeine Interesse des Ganzen sei.
In Großbritannien scheint die Überlegenheit des städtischen Gewerbfleißes über den ländlichen früher viel größer gewesen zu sein als jetzt. Der Lohn der ländlichen Arbeit kommt jetzt dem der gewerblichen, und der Gewinn der auf den Landbau verwendeten Kapitalien dem in Gewerben angelegten näher als es im vorigen Jahrhundert oder im Anfang des gegenwärtigen der Fall gewesen sein soll. Dieser Umschwung kann als die notwendige, wenn auch sehr späte Folge des außerordentlichen Sporns angesehen werden, den man der städtischen Industrie zuteilwerden ließ. Das in den Städten aufgehäufte Kapital wird mit der Zeit so groß, dass es sich nicht länger mit dem alten Gewinn in den eigentlich städtischen Industriezweigen anlegen lässt. Der städtische Gewerbfleiß hat wie alles andere seine Grenzen, und das Anwachsen der Kapitalien steigert den Mitbewerb und ermäßigt dadurch notwendig den Gewinn. Das Sinken des Gewinnes in der Stadt treibt das Kapital aufs Land hinaus, wo es eine neue Nachfrage nach ländlicher Arbeit hervorruft und dadurch notwendig ihren Lohn erhöht. Dann verstreut es sich sozusagen über das flache Land und wird durch seine Anlegung im Ackerbau dem Lande, auf dessen Kosten es sich ursprünglich in der Stadt bedeutend angesammelt hatte, zum Teil wieder erstattet. Dass überall in Europa die grüßten Verbesserungen des Landes solchen Ergießungen des ursprünglich in den Städten aufgehäuften Kapitals beizumessen sind, werde ich später zeigen, und ich werde dann auch dartun, dass, obschon einige Länder auf diesem Wege einen hohen Grad von Reichtum erlangt haben, dieser Weg selbst doch notwendig langsam, ungewiss, unzähligen störenden und unterbrechenden Zufällen ausgesetzt und der natürlichen und vernünftigen Ordnung in jeder Beziehung entgegengesetzt ist. Die Interessen, Vorurteile, Gesetze und Gewohnheiten, die dazu Veranlassung geben, werde ich im dritten und vierten Buche dieser Untersuchung, so vollständig und klar ich es vermag, auseinandersetzen.
Leute desselben Gewerbes kommen, selbst auch nur zur Erholung und zum Vergnügen selten zusammen, ohne dass ihre Unterhaltung mit einer Verschwörung gegen das Publikum oder einem Plane zur Erhöhung der Preise endigt. Es ist allerdings nicht möglich, solchen Zusammenkünften durch ein Gesetz vorzubeugen, das ausführbar oder mit Freiheit und Gerechtigkeit verträglich wäre. Wenn aber das Gesetz Leute desselben Gewerbes nicht hindern kann, zuweilen zusammenzukommen, so sollte es wenigstens nichts tun, diese Zusammenkünfte zu erleichtern, geschweige denn, sie zu fordern.
Eine Verordnung, welche alle Angehörigen desselben Gewerbes in einer Stadt verpflichtet, ihre Namen und Wohnungen in ein öffentliches Register eintragen zu lassen, erleichtert jene Zusammenkünfte. Sie bringt Individuen in Berührung miteinander, die ohne dies vielleicht niemals miteinander bekannt geworden wären, und gibt jedem die Richtung an, wo er seinesgleichen finden kann.
Eine Verordnung, die die Angehörigen eines Gewerbes ermächtigt, sich selbst Steuern aufzulegen, um für ihre Armen, Kranken, Witwen und Waisen zu sorgen, zeitigt ein gemeinsames Interesse an der Verwaltung und macht dadurch jene Zusammenkünfte erforderlich.
Eine Zunft aber macht sie nicht allein notwendig, sondern gibt auch den Beschlüssen der Mehrheit eine bindende Kraft für das Ganze. In einem freien Gewerbe kann eine wirksame Verbindung nur durch die einmütige Zustimmung aller einzelnen Gewerbtreibenden zustande kommen, und kann nicht länger dauern als alle eines Sinnes bleiben. Die Mehrheit einer Zunft aber kann Statuten mit Strafandrohungen begleiten, wodurch die Konkurrenz wirksamer und dauernder eingeschränkt wird als durch irgendeine freiwillige Verbindung.
Das Vorgeben, dass Zünfte zur besseren Leitung des Gewerbes notwendig seien, entbehrt aller Begründung. Die wahre und wirksame Aufsicht, die über einen Arbeiter geführt wird, geht nicht von seiner Zunft, sondern von seinen Kunden aus. Die Furcht, seine Arbeit zu verlieren, hält ihn vom Betruge ab, und zügelt seine Nachlässigkeit. Ein Zunftmonopol schwächt notwendig die Kraft dieser Aufsicht. Eine bestimmte Klasse von Arbeitern muss dann beschäftigt werden, mögen sie ihre Sache gut oder schlecht machen. Dies ist der Grund, warum in mancher großen korporierten Stadt selbst in den notwendigsten Gewerbszweigen keine erträglichen Arbeiter aufzutreiben sind. Will man eine Arbeit ordentlich ausgeführt sehen, so muss man sie in den Vorstädten machen lassen, wo die Arbeiter kein ausschließliches Privilegium haben, sondern nur auf ihren Ruf angewiesen sind, und man muss sie dann, so gut es geht, in die Stadt einschmuggeln.
Auf diese Weise führt die europäische Wirtschaftspolitik durch die Einschränkung der Konkurrenz auf eine geringere Zahl von Mitwerbern, als sich sonst einzustellen geneigt finden würde, zu einer sehr bedeutenden Ungleichheit in der Gesamtheit der Vorteile und Nachteile bei den verschiedenen Arbeits- und Kapitalsanlagen.
Zweitens, die europäische Wirtschaftspolitik bringt durch Steigerung der Konkurrenz in einigen Geschäften über ihr natürliches Maß, eine andere gerade entgegengesetzte Ungleichheit in der Gesamtheit der Vorteile und Nachteile bei den verschiedenen Arbeits- und Kapitalsanlagen hervor.
Man hat es für so wichtig gehalten, eine gehörige Zahl junger Leute für bestimmte Berufsarten auszubilden, dass bald die Behörden, bald der fromme Sinn mildtätiger Privatleute eine Menge von Stipendien, Kostgeldern, Stiftungen usw. zu diesem Zwecke gegründet hat, die viel mehr junge Leute zu diesen Berufsarten heranbilden, als sich sonst dazu drängen würden. In allen christlichen Ländern, glaube ich, wird die Ausbildung der meisten Geistlichen auf diese Weise bestritten. Nur sehr wenige werden ganz auf ihre eigenen Kosten gebildet. Letzteren verschafft daher ihre lange, mühselige und kostspielige Erziehung nicht immer eine angemessene Belohnung, da der geistliche Stand mit Leuten überfüllt ist, die, um nur eine Anstellung zu bekommen, gern ein viel geringeres Gehalt annehmen, als eine derartige Ausbildung sonst fordern könnte; und die Konkurrenz der Armen nimmt auf diese Weise den Reichen ihren Lohn weg. Es wäre ungehörig, einen Pfarrverweser oder Kaplan mit dem Gesellen in einem gemeinen Handwerk zu vergleichen. Ein wesentlicher Unterschied in der Bezahlung eines Pfarrverwesers oder Kaplans und dem Lohne eines Gesellen besteht jedoch nicht. Sie werden alle drei für ihre Arbeit nach Maßgabe des Vertrages bezahlt, den sie mit ihren Vorgesetzten gemacht haben. Bis nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts waren in England fünf Mark, die ungefähr so viel Silber enthielten als zehn Pfund unseres jetzigen Geldes, das übliche Gehalt eines Pfarrverwesers oder eines besoldeten Gemeindepfarrers, wie es in den Dekreten verschiedener Landeskonzilien festgesetzt ist. Zu dieser Zeit wurden fünf Pence, die so viel Silber enthielten als unser jetziger Schilling als Tagelohn eines Maurermeisters, und drei Pence, d. h. neun Pence unseres jetzigen Geldes als der eines Maurergesellen erklärt7. Der Lohn dieser beiden Handwerker wird also, unter der Voraussetzung, dass Letztere den dritten Teil des Jahres keine Beschäftigung haben, einem Pfarrverwesergehalt vollständig gleich gekommen sein. Durch ein Statut aus dem zwölften Regierungsjahre der Königin Anna, Kapitel 12, wird verordnet: »dass da aus Mangel an genügendem Unterhalt und hinlänglicher Aufmunterung für die Pfarrverweser an manchen Orten die Pfarren nicht besetzt sind, der Bischof ermächtigt ist, durch ein mit seiner Unterschrift und seinem Siegel versehenes Dokument ein hinreichendes festes Gehalt anzuweisen, das nicht mehr als fünfzig und nicht weniger als zwanzig Pfund des Jahres betragen darf.« Vierzig Pfund werden gegenwärtig für ein sehr gutes Pfarrverwesergehalt angesehen, und es gibt trotz jener Parlamentsakte noch manche Pfarrverweserstellen unter zwanzig Pfund Jahrgehalt. Schuhmachergesellen in London verdienen jährlich bis zu vierzig Pfund, und es wird sich schwerlich ein Handwerker irgendeiner Art in dieser Hauptstadt finden, der nicht mehr als zwanzig verdiente. Die letztere Summe übersteigt in der Tat nicht den Verdienst gewöhnlicher Arbeiter in manchen Landgemeinden. So oft das Gesetz versucht, den Lohn der Arbeiter zu regeln, hat es ihn stets eher erniedrigt als erhöht. Dagegen hat das Gesetz bei vielen Gelegenheiten das Gehalt der Pfarrverweser zu erhöhen und um der Würde der Kirche willen die Rektoren der Kirchspiele zu verpflichten gesucht, ihnen mehr als den elenden Unterhalt zu geben, den sie anzunehmen bereit waren. In beiden Fällen aber scheint das Gesetz gleich unwirksam geblieben zu sein, und hat nie weder das Gehalt der Pfarrverweser auf das beabsichtigte Maß zu erhöhen, noch den Lohn der Arbeiter so weit herunterzudrücken vermocht, weil es jene nicht hindern konnte, sich bei der Dürftigkeit ihrer Lage und der Menge ihrer Mitbewerber mit einem geringeren als dem gesetzlichen Jahrgehalt zu begnügen, und weil es andrerseits diese nicht hindern konnte, mehr als den gesetzlichen Lohn zu nehmen, da ihnen der Wettbewerb derer, die sich von ihrer Arbeit Gewinn versprachen, gern mehr bewilligte.
Die großen Pfründen und sonstigen geistlichen Ehrenstellen halten die Ehre der Kirche trotz der ärmlichen Umstände einiger ihrer niederen Glieder aufrecht. Auch bietet die dem Stande gezollte Achtung letzteren für die Ärmlichkeit ihrer Geldbelohnung einigen Ersatz. In England und in allen römisch-katholischen Ländern ist das Los der Kirche in der Tat weit günstiger als es nötig wäre. Das Beispiel der schottischen, Genfer und einiger anderen protestantischen Kirchen kann uns überzeugen, dass in einem geachteten Berufe, in welchem die Ausbildung so wohlfeil erworben wird, schon die Hoffnung auf weit geringere Pfründen dem geistlichen Stande eine hinlängliche Zahl von gelehrten, anständigen und achtbaren Leuten zuführen wird.
Wenn für Berufsarten, in denen es keine Pfründen gibt, z. B. die Jurisprudenz und Medizin, eine gleiche Zahl Leute auf öffentliche Kosten ausgebildet würde, so würde die Konkurrenz bald so groß werden, dass der Geldlohn sich bedeutend niedriger stellen müsste.
Es würde dann nicht der Mühe lohnen, seinen Sohn auf eigene Kosten zu einem solchen Stande erziehen zu lassen, der vielmehr gänzlich denen überlassen würde, die ihre Erziehung öffentlichen Stiftungen verdankten und wegen ihrer Menge und Dürftigkeit sich im Allgemeinen mit recht elendem Lohn begnügen müssten, zum Schaden der jetzt so achtbaren Stände des Rechtsgelehrten und Arztes.
Die wenig glückliche Klasse von Leuten, die man gewöhnlich Literaten nennt, befindet sich ziemlich genau in der Lage, in welcher Rechtsgelehrte und Ärzte sich wahrscheinlich unter der obigen Voraussetzung befinden würden. In allen europäischen Ländern sind die meisten von ihnen für den Kirchendienst erzogen worden, aber durch verschiedene Gründe verhindert, in den geistlichen Stand zu treten. Sie haben also ihre Bildung in der Regel auf öffentliche Kosten erhalten, und ihre Menge ist überall so groß, dass dadurch der Preis ihrer Arbeit auf eine höchst klägliche Belohnung zusammenzuschrumpfen pflegt.
Vor der Erfindung der Buchdruckerkunst bestand die einzige Arbeit, durch die ein Literat mit seinem Talente etwas erwerben konnte, darin, dass er öffentlicher oder Privatlehrer wurde, d. h. anderen Leuten die wissenswerten und nützlichen Kenntnisse mitteilte, die er sich erworben hatte. Und dies ist sicherlich noch ein ehrenwerteres, nützlicheres und in der Regel auch einträglicheres Geschäft als die Schriftstellerei für einen Buchhändler, wozu die Buchdruckerkunst Veranlassung gegeben hat. Es sind wenigstens ebenso viel Zeit, Studium, Geist, Kenntnisse und Fleiß dazu erforderlich, ein ausgezeichneter Lehrer der Wissenschaften als ein hervorragender Arzt oder Rechtsgelehrter zu werden. Doch steht der übliche Lohn eines tüchtigen Lehrers in keinem Verhältnis zu dem eines Rechtsgelehrten oder Arztes, weil das Geschäft des einen mit dürftigen Leuten, die auf öffentliche Kosten ausgebildet wurden, überfüllt ist, während in die beiden anderen Geschäfte sich nur wenige eindrängen, die nicht auf eigene Kosten studiert haben. So gering aber auch der übliche Lohn öffentlicher und Privatlehrer erscheint, so würde er doch ohne Zweifel noch geringer sein, wenn nicht die Konkurrenz der noch dürftigeren Gelehrten abginge, die fürs Brot schreiben. Vor der Erfindung der Buchdruckerkunst scheinen Schüler und Bettler so ziemlich gleichbedeutende Ausdrücke gewesen zu sein. Die Rektoren der Universitäten stellten vor dieser Zeit ihren Studenten oft Erlaubnisscheine zum Betteln aus.
Im Altertum, wo keine Stiftungen der erwähnten Art dürftige Leute zu gelehrten Berufsarten ausbilden ließen, war anscheinend die Bezahlung tüchtiger Lehrer viel beträchtlicher. Isokrates wirft in seiner sogenannten Rede gegen die Sophisten den Lehrern seiner Zeit einen Widerspruch vor. »Sie machen«, sagt er, »ihren Schülern die glänzendsten Versprechungen und wollen sie lehren, weise, glücklich und gerecht zu sein, verlangen aber für einen so wichtigen Dienst nur einen lumpigen Lohn von vier oder fünf Minen. Wer Weisheit lehrt« – fährt er fort – »sollte doch selbst weise sein; wenn aber einer einen solchen Handel für solch einen Preis abschließt, so beweist er augenscheinlichste Torheit.« An dieser Stelle wird er gewiss den Lohn nicht größer gemacht haben als er wirklich war. Vier Minen sind aber so viel, wie dreizehn Pfund, sechs Schilling und acht Pence; fünf Minen sind sechzehn Pfund, dreizehn Schilling und vier Pence. Es wurde also damals den hervorragendsten Lehrern in Athen eine Summe gezahlt, die wenig hinter dem größeren Betrage zurückgeblieben sein wird. Isokrates selbst verlangte zehn Minen, oder dreiunddreißig Pfund, sechs Schilling und acht Pence von jedem seiner Schüler. Bei seinen Vorträgen in Athen soll er hundert Zuhörer gehabt haben. Ich verstehe dies von der Anzahl, denen er gleichzeitig Vorträge hielt, oder die, wie wir das nennen, einen Kursus bei ihm hörten, und diese Anzahl wird in einer so großen Stadt bei einem so berühmten Lehrer, der noch dazu eine Wissenschaft, die Rhetorik, vortrug, die damals eine Modewissenschaft war, durchaus nicht ungewöhnlich groß erscheinen. Er muss mithin in jedem Kursus tausend Minen oder £ 3333, 6 sh. 8 d. eingenommen haben. Auch von Plutarch wird an einer Stelle angegeben, dass tausend Minen sein Didaktron oder gewöhnliches Honorar gewesen sei. Viele andere berühmte Lehrer jener Zeit scheinen ein großes Vermögen erworben zu haben. Gorgias schenkte dem Tempel von Delphi seine eigene Statue aus gediegenem Golde. Wir brauchen allerdings nicht anzunehmen, dass sie lebensgroß gewesen sei. Der Fuß, auf dem er, sowie Hippias und Protagoras, zwei andere ausgezeichnete Lehrer jener Zeit, lebten, war nach Plato glänzend bis zur Prahlerei. Plato selbst soll großen Aufwand gemacht haben. Nachdem Aristoteles Erzieher des Alexander gewesen und sowohl von diesem als von seinem Vater Philipp, wie alle Zeugnisse bekunden, aufs Glänzendste belohnt worden war, hielt er es doch noch der Mühe für wert, nach Athen zurückzukehren, um seine Vorträge wieder aufzunehmen. Lehrer der Wissenschaften waren zu jener Zeit anscheinend weniger häufig als ein oder zwei Menschenalter später, wo der Wettbewerb wahrscheinlich sowohl den Preis ihrer Arbeit als auch die Bewunderung für ihre Person etwas ermäßigt hatte. Doch scheinen die hervorragendsten unter ihnen noch immer einen Grad von Achtung genossen zu haben, wie ihn heutigen Tages kein Mann gleichen Standes irgendwo erreicht. Die Athener betrauten den Akademiker Karneades und den Stoiker Diogenes mit einer feierlichen Gesandtschaft nach Rom, und wenn ihre Stadt damals auch schon von ihrer früheren Größe herabgesunken war, so war sie doch immer noch eine unabhängige und ansehnliche Republik. Überdies war Karneades ein Babylonier von Geburt, und da niemals ein Volk eifersüchtiger als die Athener darüber wachte, keine Fremden zu öffentlichen Würden zuzulassen, so muss ihre Achtung für ihn sehr groß gewesen sein.
Im Ganzen ist übrigens dieser Umschwung für das Publikum vielleicht eher vorteilhaft als schädlich. Der Stand eines öffentlichen Lehrers ist dadurch etwas herabgesetzt worden; aber die Wohlfeilheit der gelehrten Erziehung ist sicherlich ein Vorteil, der diesen kleinen Übelstand weit überwiegt. Auch würde davon das Publikum noch viel größeren Gewinn haben, wenn die Einrichtungen der gelehrten Schulen und Universitäten vernünftiger wären als sie es jetzt durchweg in Europa sind.
Drittens, die europäische Wirtschaftspolitik bringt durch Hemmung der freien Bewegung der Arbeit und des Kapitals sowohl von Geschäft zu Geschäft als von Ort zu Ort, in manchen Fällen eine sehr schädliche Ungleichheit in der Gesamtheit der Vorteile und Nachteile ihrer Anlagen hervor.
Das Lehrlingsgesetz hemmt die freie Arbeitsbewegung von einem Geschäft zum anderen sogar an ein und demselben Orte. Die ausschließenden Zunftprivilegien hemmen sie von einem Orte zum anderen sogar in ein und demselben Geschäfte.
Es kommt häufig vor, dass, während den Arbeitern in dem einen Gewerbe hoher Lohn gegeben wird, sie in einem anderen mit der nackten Existenz vorlieb nehmen müssen. Das eine gedeiht und hat einen steten Begehr nach frischen Arbeitskräften; das andere hingegen verfällt und der Überfluss an Arbeitskräften nimmt stets zu. Zwei solche Gewerbe können bald in einer und derselben Stadt, bald in einer und derselben Gegend sein, ohne dass sie imstande wären, einander nur die geringste Hilfe zu leisten. In dem einen Falle, ist das Lehrlingsgesetz hinderlich und in dem anderen sowohl dieses als die ausschließende Zunft. Gleichwohl sind in vielen Gewerben die Operationen einander so ähnlich, dass die Arbeiter leicht aus dem einen in das andere übertreten könnten, wenn jene abgeschmackten Gesetze es nicht verhinderten. Das Weben glatter Leinenzeuge und glatter Seidenzeuge ist z. B. fast ganz dasselbe. Das Weben glatter Wollenwaren ist etwas anderes, aber der Unterschied ist so unbedeutend, dass ein Seiden- oder Leinweber in wenigen Tagen ein ganz guter Tuchweber werden könnte. Geriete nun eines dieser drei Hauptgewerbe in Verfall, so könnten die Arbeiter leicht in einem der beiden anderen, deren Lage glücklicher ist, Zuflucht finden, und ihr Lohn würde weder in dem blühenden Gewerbe zu hoch, noch in dem verfallenden zu niedrig werden. Die Leinweberei steht zwar in England laut einem besonderen Statut jedermann offen; da sie aber in den meisten Gegenden des Landes wenig betrieben wird, so kann sie den Arbeitern anderer verfallender Gewerbe keine allgemeine Zuflucht bieten, und diese haben überall, wo das Lehrlingsgesetz in Geltung ist, keine andere Wahl als entweder dem Kirchspiel zur Last zu fallen, oder sich als Tagelöhner zu verdingen, wozu sie sich vermöge ihrer bisherigen Gewohnheiten weit weniger schicken als zu irgendeinem anderen Gewerbszweige, der mit dem ihrigen einige Ähnlichkeit hat. Darum ziehen sie es denn auch in der Regel vor, dem Kirchspiel zur Last zu fallen.
Alles, was die freie Bewegung der Arbeit von einem Geschäfte zum andern hemmt, hemmt auch die des Kapitals, da die Größe des Kapitals, das in einem Geschäftszweige angelegt werden kann, sehr von der Menge der Arbeit abhängt, die in ihm aufgewendet wird. Doch legen Zunftgesetze dem freien Umlauf des Kapitals von einem Orte zum anderen weniger Hindernisse in den Weg als der Arbeit. Für einen reichen Kaufmann ist es überall leichter, in einer korporierten Stadt ein Handelsprivilegium zu erlangen als für einen armen Handwerker die Erlaubnis, in ihr arbeiten zu dürfen.
Die Hemmung, die Zunftgesetze der freien Bewegung der Arbeit auflegen, ist, glaube ich, allen Teilen Europas gemein; diejenige aber, welche durch die Armengesetze bewirkt wird, ist, soviel ich weiß, nur England eigentümlich. Sie besteht in der Schwierigkeit für einen armen Mann, sich in einem andern Kirchspiel als dem, zu welchem er gehört, niederlassen oder auch nur sein Geschäft treiben zu dürfen. Durch Zunftgesetze wird nur die freie Bewegung der Arbeit der Handwerker und industriellen Arbeiter gehemmt; die Erschwerung der Niederlassung aber hemmt auch die der gemeinen Arbeit. Es ist der Mühe wert, den Ursprung, Fortschritt und gegenwärtigen Zustand dieses Übels, vielleicht des größten der englischen Wirtschaftspolizei, kurz zu berichten.
Als durch die Aufhebung der Klöster die Armen der Unterstützung dieser frommen Häuser beraubt worden waren, wurde nach einigen anderen fruchtlosen Versuchen zu ihren Gunsten durch ein Gesetz aus dem 43. Jahre Elisabeths, Kapitel 2, verordnet, dass jedes Kirchspiel für seine Armen zu sorgen verpflichtet sein, und jährlich Armenaufseher bestellt werden sollten, die in Gemeinschaft mit den Kirchenvorstehern eine diesem Zwecke angemessene Summe durch eine Kirchspielsteuer zu erheben hätten.
Dieses Gesetz legte jedem Kirchspiel die unerlässliche Pflicht auf, für seine Armen zu sorgen. Es entstand dadurch die wichtige Frage, wer denn als Armer eines Kirchspiels zu betrachten sei. Diese Frage wurde nach einigem Schwanken endlich durch Statut aus dem 13. und 14. Regierungsjahre Karls II. entschieden, in dem verordnet war, dass vierzig Tage eines ungestörten Aufenthalts jedem die Ansässigkeit in einem Kirchspiel erwerben sollten; doch sollte innerhalb dieser Zeit zwei Friedensrichtern das Recht zustehen, auf Klage seitens der Kirchenvorsteher oder Armenaufseher, jeden neuen Einwohner in das Kirchspiel, in dem er zuletzt rechtmäßig ansässig gewesen, zu verweisen, wenn er nicht entweder eine Pachtung von zehn Pfund jährlicher Pacht übernehmen oder dem Kirchspiel eine ausreichende Bürgschaft stellen könne, dass er ihm nicht zur Last fallen werde.
Dieses Gesetz soll manche Betrügereien veranlasst haben. Kirchspielbeamte bestachen mitunter ihre eigenen Armen, heimlich in ein anderes Kirchspiel auszuwandern, und hielten sie vierzig Tage lang daselbst verborgen, damit sie die Ansässigkeit gewönnen, um das Kirchspiel, dem sie eigentlich angehörten, von ihnen zu befreien. Darum verordnete ein Statut aus dem ersten Regierungsjahre Jakobs II., dass die vierzig Tage ungestörten Aufenthalts, die zur Erwerbung der Ansässigkeit erforderlich waren, erst von dem Augenblick an gerechnet werden sollten, an dem jemand einem der Vorsteher oder Armenaufseher des Kirchspiels, in dem er künftig wohnen wollte, schriftlich seinen Wohnort und die Stärke seiner Familie angemeldet hätte.
Indes waren die Kirchspielsbeamten gegen ihr eigenes Kirchspiel nicht immer ehrlicher als sie es gegen fremde gewesen waren, und drückten hie und da bei solchen Einnistungen die Augen zu, indem sie zwar die Anmeldung in Empfang nahmen, aber nicht die erforderlichen Schritte taten. Da man annahm, dass jeder Einwohner eines Kirchspiels ein Interesse daran haben müsse, der Belastung durch solche Eindringlinge so viel als möglich vorzubeugen, so wurde im dritten Regierungsjahre Wilhelms III. ferner verordnet, dass die vierzig Aufenthaltstage erst von dem Tage an gerechnet werden sollten, an dem die schriftliche Anmeldung Sonntags in der Kirche unmittelbar nach dem Gottesdienste öffentlich verlesen worden sei.
»Am Ende«, sagt Dr. Burn, »wurde diese Art der Ansässigkeit, die man erst durch einen vierzigtägigen Aufenthalt nach der öffentlichen Verlesung der schriftlichen Anmeldung erwerben konnte, nur sehr selten erlangt, und der Zweck dieser Anordnungen ist nicht sowohl der, jemand die Ansässigkeit zu erleichtern als vielmehr die Ansässigkeit von Leuten, die heimlich in das Kirchspiel kommen, zu hintertreiben; denn sich anmelden heißt nur, das Kirchspiel nötigen, sie wieder wegzuschaffen. Ist aber die Lage jemandes der Art, dass es zweifelhaft bleibt, ob er wirklich zurückgeschickt werden dürfe oder nicht, so wird er durch seine Anmeldung das Kirchspiel nötigen, ihm entweder dadurch, dass es ihn vierzig Tage bleiben lässt, eine unbestrittene Ansässigkeit zu bewilligen, oder dadurch, dass es ihn wegschafft, die Sache vor den Richter zu bringen.«
Dieses Statut machte es also für einen armen Mann fast unmöglich, auf die frühere Weise durch vierzigtägigen Aufenthalt einen festen Wohnsitz zu gewinnen. Damit es aber nicht den Anschein habe, als sollten die gewöhnlichen Leute gänzlich von der Ansiedelung in einem anderen Kirchspiel ausgeschlossen werden, wurden vier andere Arten festgesetzt, wie ohne eine abgegebene oder öffentlich verlesene Anmeldung die Ansässigkeit gewonnen werden könne. Erstens konnte man sie erwerben, wenn man zu den Kirchspielsabgaben zugezogen wurde und sie bezahlte; zweitens, wenn man auf ein Jahr zu einem Kirchspielsamte gewählt wurde und es diese Zeit über versah; drittens, wenn man im Kirchspiel seine Lehrzeit bestand; viertens endlich, wenn man dort auf ein Jahr in Dienst genommen wurde und ein ganzes Jahr lang in diesem Dienste verblieb.
Auf eine der beiden ersteren Arten ist indessen die Ansässigkeit nur durch einen öffentlichen Akt des ganzen Kirchspiels zu erlangen, das dabei wohl auf die Folgen Acht gibt, die daraus hervorgehen, wenn es einen neuen Ankömmling, der keine anderen Unterhaltsmittel als seine Arbeit hat, durch Zuziehung zu den Abgaben oder durch Wahl zu einem Amte bei sich aufnimmt.
Auf eine der beiden letzteren Arten kann hingegen kein Verheirateter Ansässigkeit erwerben. Ein Lehrling ist schwerlich jemals verheiratet, und es ist ausdrücklich bestimmt, dass kein verheirateter Dienstbote durch Anstellung auf ein Jahr Ansässigkeit erwerben solle. Die Hauptwirkung, welche die Einführung einer durch Dienst zu erlangenden Ansässigkeit gehabt hat, hat namentlich darin bestanden, dass die alte Gewohnheit, auf ein Jahr zu mieten, die früher in England so herkömmlich war, dass noch bis auf den heutigen Tag das Gesetz in jedem Falle, wo kein bestimmter Zeitraum ausgemacht worden, annimmt, dass der Dienstbote auf ein Jahr gemietet sei, großenteils außer Übung gekommen ist. Die Arbeitgeber sind nicht immer willens, ihren Dienstboten durch Mieten auf ein Jahr die Ansässigkeit zu verschaffen, und die Dienstboten mögen sich nicht immer so vermieten, weil sie, da stets der letzte Wohnsitz die früheren aufhebt, die ursprüngliche Ansässigkeit in ihrer Heimat, wo ihre Eltern und Verwandten wohnen, dadurch einbüßen könnten.
Ein selbständiger Arbeiter, sei er Tagelöhner oder Handwerker, wird offenbar nicht leicht eine neue Ansässigkeit durch Lehr- oder Dienstjahre erwerben. Wendet sich eine solche Person mit ihrem Gewerbe in ein neues Kirchspiel, so setzt sie sich, wie gesund und fleißig sie auch sein mag, der Gefahr aus, nach der Laune eines Kirchenvorstehers oder Armenaufsehers wieder entfernt zu werden, wenn sie nicht entweder für zehn Pfund im Jahre eine Pachtung übernimmt – was für jemanden, der nur von seiner Arbeit lebt, unmöglich ist – oder eine zwei Friedensrichtern genügend erscheinende Bürgschaft bietet, dass sie dem Kirchspiel nicht zur Last fallen werde. Welche Sicherheit sie fordern wollen, ist freilich ganz ihrem Gutdünken überlassen; aber sie können nicht wohl weniger als dreißig Pfund verlangen, da eine Verordnung vorhanden ist, nach der sogar der Kauf eines Freigutes von weniger als dreißig Pfund Wert kein Ansässigkeitsrecht geben soll, weil es nicht hinreichend sei, das Kirchspiel vor der Armenbelastung zu sichern. Diese Bürgschaft wird aber jemand, der von seiner Arbeit lebt, kaum je geben können, und doch wird oft noch eine viel größere gefordert.
Um jedoch einigermaßen die freie Bewegung der Arbeit, die durch jene verschiedenen Gesetze fast gänzlich aufgehoben war, wiederherzustellen, ist man auf die sogenannten Zertifikate verfallen. Im achten und neunten Regierungsjahre Wilhelms III. wurde festgesetzt, dass, wenn jemand aus dem Kirchspiel, in dem er zuletzt rechtmäßig ansässig war, ein von den Kirchenvorstehern und Armenaufsehern unterschriebenes und von zwei Friedensrichtern bestätigtes Zertifikat mitbringt, jedes andere Kirchspiel ihn aufzunehmen verbunden ist; dass er nicht schon darum, weil er wahrscheinlich später zur Last fallen würde, sondern nur, wenn er wirklich zur Last fällt, entfernt werden darf; und dass dann das Kirchspiel, welches das Zertifikat ausstellte, verpflichtet sein soll, die Kosten des Unterhalts und der Fortschaffung zu tragen. Um aber dem Kirchspiel, wohin ein mit einem Zertifikat ausgestatteter Mann sich wendet, die ausreichendste Bürgschaft zu geben, wurde durch dasselbe Gesetz ferner verordnet, dass der Mann das Niederlassungsrecht nur dann erhalten solle, wenn er eine Pachtung für zehn Pfund jährlich übernehme, oder unentgeltlich ein Jahr lang ein Kirchspielamt verwalte. Er konnte mithin weder durch Anmeldung, noch durch Dienst, Lehrlingschaft oder Zahlung der Kirchspielabgaben dazu gelangen. Auch wurde im zwölften Regierungsjahre der Königin Anna (Stat. I. c. 18.) noch verordnet, dass weder die Dienstboten noch die Lehrlinge solcher auf Grund von Zertifikaten zugelassener Leute in dem Kirchspiel Ansässigkeit erwerben können.
Inwiefern diese Erfindung die freie Bewegung der Arbeit, die durch die früheren Statute fast gänzlich aufgehoben war, wiederhergestellt habe, ersieht man aus der folgenden sehr verständigen Bemerkung des Dr. Burn. »Offenbar«, sagt er, »liegen verschiedene gute Gründe vor, von Personen, die sich an einem Orte niederlassen wollen, Zertifikate zu verlangen, namentlich damit die Inhaber nicht durch Lehrlingsschaft, Dienst, Anmeldung, oder Zahlung der Kirchspielsteuern ansässig werden; damit sie weder Lehrlinge, noch Dienstboten ansässig machen können, damit man ferner, sobald sie dem Kirchspiel zur Last fallen, genau weiß, wohin man sie zu bringen und an wen man sich wegen der Fortschaffungs- und Unterhaltskosten in dieser Zeit zu halten hat; und damit endlich, wenn sie krank werden und nicht fortgeschafft werden können, das Kirchspiel, von dem das Zertifikat ausgestellt ist, den Unterhalt erstattet – was alles ohne ein Zertifikat nicht geschehen kann. Aber diese Gründe sind ebenso viele Gründe für die Kirchspiele, in gewöhnlichen Fällen keine Zertifikate auszustellen; denn es ist nur zu wahrscheinlich, dass sie ihre Inhaber zurückerhalten werden, und dies noch dazu in einer schlechteren Lage.« Die Moral dieser Bemerkung scheint zu sein, dass das Kirchspiel, in dem ein Armer sich niederlassen will, stets Zertifikate fordert, dass aber von dem, welches er zu verlassen gedenkt, nur sehr selten solche bewilligt werden. »Es liegt hierin«, sagt derselbe einsichtsvolle Schriftsteller in seiner Geschichte der Armengesetze, »eine große Härte, indem es in die Macht eines Kirchspielbeamten gestellt ist, einen Menschen gewissermaßen für sein ganzes Leben gefangen zu halten, mag es für ihn auch noch so nachteilig sein, an dem Orte bleiben zu müssen, an dem er das Unglück hatte, sogenannte Ansässigkeit zu erwerben, oder mag er sich die größten Vorteile von einem Aufenthalte am fremden Orte versprechen.«
Obgleich ein Zertifikat kein Zeugnis des guten Betragens enthält und nur bescheinigt, dass sein Inhaber dem oder dem Kirchspiel angehöre, so steht es doch ganz im Belieben der Kirchspielsbeamten, es zu verweigern oder zu gewähren. Es sind, erzählt Dr. Burn, einmal gerichtliche Schritte getan worden, um die Kirchenvorsteher und Armenaufseher zur Ausstellung eines Zertifikats zu nötigen, aber der Gerichtshof der King’s Bench hat den Antrag verworfen.
Der sehr ungleiche Arbeitspreis, den wir häufig in England an gar nicht weit voneinander liegenden Orten finden, hat seinen Grund wahrscheinlich in den Hindernissen, welche das Ansässigkeitsgesetz einem Armen, der ohne Zertifikat mit seinem Gewerbe von einem Kirchspiel in das andere wandern möchte, entgegenstellt. Ein einzelner, gesunder und fleißiger Mann wird zwar hie und da ohne ein Zertifikat geduldet; aber wenn ein Mann mit Weib und Kind es versuchen wollte, würde er sicher in den meisten Kirchspielen entfernt werden, und selbst der einzelne Mann würde, wenn er sich später verheiratete, in der Regel ausgewiesen werden. Daher kann dem Mangel an Arbeitern in dem einen Kirchspiel nicht immer durch den Überfluss in einem anderen abgeholfen werden, wie das in Schottland und wohl in allen anderen Ländern, in denen die Ansässigkeit keine Schwierigkeiten bietet, so unablässig geschieht. Wenn auch in solchen Ländern zuweilen der Lohn in der Nähe einer großen Stadt, oder wo sonst eine außergewöhnliche Nachfrage nach Arbeit besteht, ein wenig steigt, und umgekehrt je nach der größeren Entfernung von solchen Plätzen sinkt, bis er wieder den gewöhnlichen Satz des Landes erreicht, so begegnet man doch niemals so plötzlichen, unerklärlichen Verschiedenheiten im Arbeitslohn benachbarter Orte, wie bisweilen in England, wo es oft für einen Armen schwieriger ist, die künstlichen Schranken eines Kirchspiels zu überschreiten als einen Meeresarm oder hohen Gebirgsrücken, d. h. natürliche Grenzen, die in anderen Ländern zuweilen die Lohnsätze sehr deutlich voneinander scheiden.
Einen Mann, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, aus dem Kirchspiel, in dem er wohnen will, zu entfernen, ist eine offenbare Verletzung natürlicher Freiheit und Gerechtigkeit. Dennoch hat das gemeine Volk Englands, das auf seine Freiheit so eifersüchtig ist, aber gleich dem gemeinen Volke der meisten anderen Länder nie recht weiß, worin sie besteht, diesen Druck, dem es hilflos erliegt, jetzt schon länger als ein Jahrhundert ruhig ertragen. Haben auch zuweilen denkende Männer das Ansässigkeitsgesetz als ein öffentliches Unglück beklagt, so hat es doch niemals einen so allgemeinen Schrei des Unwillens hervorgerufen, wie die generellen Verhaftsbefehle, die ohne Zweifel auch ein Missbrauch sind, aber doch nicht leicht einen so allgemeinen Druck zur Folge hatten. Ich wage zu behaupten, dass es in England kaum einen einzigen armen Mann von vierzig Jahren gibt, der nicht zu irgendeiner Zeit seines Lebens durch dies unselige Ansässigkeitsgesetz sich grausam bedrückt gefühlt hätte.
Ich schließe dieses lange Kapitel mit der Bemerkung, dass es zwar vor alters üblich war, den Lohn festzusetzen und zwar anfänglich durch allgemeine für das ganze Königreich gültige Gesetze und später durch besondere Anordnungen der Friedensrichter in jeder Grafschaft, – dass diese beiden Gewohnheiten aber jetzt gänzlich abgekommen sind. »Nach der Erfahrung von mehr als vierhundert Jahren,« sagt Dr. Burn, »scheint es endlich Zeit zu sein, alle Versuche, unter feste Regeln zu bringen, was seiner Natur nach jeder genauen Begrenzung unfähig scheint, aufzugeben; denn wenn alle Arbeiter in einem Gewerbe gleichen Lohn erhalten, hört der Wetteifer auf, und für Fleiß und Talent wäre kein Raum mehr.«
Dennoch wird zuweilen noch versucht, durch besondere Parlamentsakte den Lohn für bestimmte Gewerbe und Orte festzustellen. So verbietet eine Akte aus dem 8. Regierungsjahre Georgs III. unter schwerer Geldstrafe allen Schneidermeistern in London und fünf Meilen im Umkreise, mehr als zwei Schilling, sieben und einen halben Pence täglich an Arbeitslohn zu zahlen, es sei denn zur Zeit einer allgemeinen Landestrauer, – und ebenso den Gesellen, mehr als diesen Lohn anzunehmen. So oft die Gesetzgebung sich dazu herbei lässt, die Unstimmigkeiten zwischen den Meistern und ihren Arbeitern auszugleichen, ist sie stets von den Meistern beraten. Wenn daher die Bestimmung zu Gunsten der Arbeiter ausfällt, so ist sie stets gerecht und billig; öfters aber, wenn sie zugunsten der Meister ausfällt, ist sie es nicht. So ist das Gesetz, welches in einigen Gewerben die Meister verpflichtet, ihre Arbeiter in Geld und nicht in Waren zu bezahlen, ganz gerecht und billig; denn es legt den Meistern keine wirkliche Last auf, sondern nötigt sie nur, den Geldwert zu bezahlen, den sie in Waren bezahlen zu wollen vorgaben, aber nicht immer wirklich bezahlten. Dieses Gesetz ist zugunsten der Arbeiter; dagegen die Akte aus dem achten Regierungsjahre Georgs III. zugunsten der Meister. Wenn die Meister sich zusammentun, um den Lohn ihrer Arbeiter herabzusetzen, so schließen sie gewöhnlich privatim einen Bund oder eine Übereinkunft, bei Strafe nicht mehr als einen bestimmten Lohn zu geben. Wollten die Arbeiter eine entgegengesetzte Übereinkunft derselben Art schließen, bei Strafe jenen Lohn nicht anzunehmen, so würde sie das Gesetz sehr strenge bestrafen. Verführe es wirklich unparteiisch, so müsste es gegen die Meister ebenso handeln. Aber die Akte aus dem achten Regierungsjahre Georgs III. erteilt gerade der Regel, welche die Meister durch derartige Verbindungen zuweilen einzuführen suchen, gesetzliche Kraft. Die Klage der Arbeiter, dass dadurch der geschickteste und fleißigste Arbeiter mit dem mittelmäßigen auf eine gleiche Stufe gesetzt werde, scheint durchaus wohlbegründet.
In früheren Zeiten war es auch üblich, den Gewinn der Kaufleute und anderer Händler durch Festsetzung des Preises für Lebensmittel und andere Waren zu regeln. Die Brottaxe ist, soviel ich weiß, der letzte Rest dieses alten Brauchs. Wo es eine geschlossene Zunft gibt, da mag es gut sein, den Preis der ersten Lebensbedürfnisse festzusetzen; wo dies aber nicht der Fall ist, wird die Konkurrenz ihn weit besser regeln als irgendeine Taxe. Die durch ein Gesetz aus dem 31. Regierungsjahre Georgs II. eingeführte Methode, eine Brottaxe festzusetzen, konnte in Schottland wegen eines Mangels im Gesetze nicht zur Ausführung gebracht werden, insofern die Vollziehung auf dem Amte eines Marktschreibers ruhte, das in Schottland nicht vorhanden ist. Dieser Mangel wurde erst im dritten Regierungsjahre Georgs III. gehoben. Inzwischen stiftete der Mangel einer Taxe keinen merklichen Schaden, und ihre Einführung hat an den wenigen Orten, an denen sie bestand, keinen merklichen Vorteil gewährt. In den meisten schottischen Städten gibt es jedoch eine Bäckerzunft, die ausschließliche Berechtigungen in Anspruch nimmt, ohne dass diese jedoch strenge gewahrt würden.
Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Lohn- und Gewinnsätzen in den einzelnen Arbeits- und Kapitalanlagen erleidet, wie schon bemerkt wurde, durch den Reichtum oder die Armut, durch einen fortschreitenden, stillstehenden oder zurückgehenden Zustand der Gesellschaft keine großen Veränderungen. Obwohl solche Revolutionen in der öffentlichen Wohlfahrt den Lohn- und Gewinnsatz im Ganzen treffen, so müssen sie ihn am Ende doch in allen verschiedenen Anlagearten gleichmäßig treffen. Das Verhältnis zwischen ihnen muss daher das nämliche bleiben, und kann durch solche Umwälzungen wenigstens nicht für lange Zeit gestört werden.
7
S. das Arbeitergesetz aus dem fünfundzwanzigsten Regierungsjahre Eduards III.