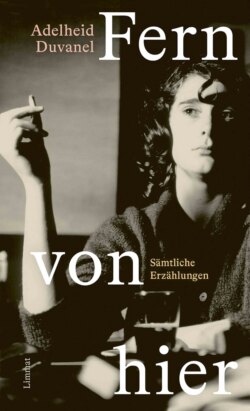Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Enttäuschung
ОглавлениеIch weiß nicht, ob es leidenschaftliche oder zu wenig leidenschaftliche Naturen sind, die nie eine Sonnenbrille, beim Nähen keinen Fingerhut und zum Geschirrwaschen keine Gummihandschuhe tragen; was andere Menschen nötig finden, um Augen, Fingerspitzen oder Hände zu schonen, war Agnes ärgerlich, muss sie als eine lästige Wand zwischen der Wirklichkeit, zwischen dem Leben und ihrem Ich, dem Erfühlen dieses Lebens empfunden haben. Sie war meine Patin; ich war nach ihr getauft worden und verbrachte, nachdem man mich von meiner liederlichen Mutter weggenommen hatte, deren uneheliches Kind ich war, ein halbes Jahr bei ihr; nachdem sie aber schwer erkrankt war, wurde ich in ein erstes, zweites und drittes Heim gesteckt. In jedem fühlte ich mich wie eines von fünfzig oder hundert Schaumkrönchen, die von den Leiterinnen umher- oder weggeblasen werden konnten. Dass es Wellen gab und Tiefe, ahnte ich, und dass es Schiffe gab, die stampfend und Aufruhr bringend über einen hinwegfahren konnten, wusste ich, seit mein Onkel Raymond nach Tante Agnes’ Tod mich aus dem Heim holte; ich war nun dreizehn Jahre alt. Riesengroß stand er vor mir, überragte er mich bei Tisch, wo er laut vorbetete, warf er Schatten, als ob er Läden hinter sich geschlossen hätte, um das Sonnenlicht für immer von mir fernzuhalten. Hinter den Läden klopften die vielen Bäume wie Stiefel ums Haus. Ich hatte keine Freundinnen, auch keine Puppe; ganz allein war ich von Heim zu Heim gewandert, unansehnlich wie ein Gepäckstück in meinen fremden, abgetragenen Kleidern, und dass Onkel Raymond – der Mann meiner verstorbenen Tante Agnes, dieser wortkargen, kränklichen Frau, die aber mit den Augen gewärmt und deren Stimme wie ein Feuerchen geknistert hatte – mich zu sich sperrte, wurde mir von der Leiterin des letzten Heims als Glücksfall geschildert. Ich galt als bockiges, unzugängliches, verträumtes und faules Kind. Es war das erste Mal, dass sie zu mir allein redete, dass ich mich nicht als ein Teilchen einer Kindergruppe fühlte, nicht als eine in der Fabrik verfertigte Puppe, die ebenso langweilig wie alle andern aussah, die wartete und wie im Traum Befehle hörte, die allen galten: Hände waschen, Zähne putzen, Schulaufgaben lösen, beten, zu Bett gehen. Nein, nun war ich ein Einzelstück, sozusagen eine selbstverfertigte Puppe aus einer Boutique; ich erinnere mich, dass ich mir mit einem Brennen im Herzen wünschte, die Leiterin möge beachten, dass das eine meiner Augen heller war als das andere und dass meine Mundwinkel, obwohl ich ein langgezogenes, trauriges Gesicht hatte, sich leicht nach oben bogen. Ich stellte mir auch vor, sie würde mir etwas erzählen oder erklären, was ich schon lange gerne gewusst hätte: Weshalb es Wellen gab und wie es in der grauen Tiefe aussah, von der man glauben konnte, sie sei gestorben, so still schien sie, und ob ich mich als Teil dieser Tiefe betrachten durfte oder ob ich nur aus Schaum mit ein bisschen spitzem Licht bestand; ja, das Licht war spitz und tat weh, aber die Dunkelheit, in der Onkel Raymond mich verstecken wollte, erhoffte ich mir rund und weich.
Mein Onkel hatte wieder geheiratet; die Frau glich Tante Agnes überhaupt nicht; ich sah sofort, dass sie an hellblauen Tagen eine Sonnenbrille aufsetzte, ihre Hände während der Hausarbeit mit Gummihandschuhen schonte und zum Nähen einen Fingerhut trug – wie es sich gehört!, betonte sie. Ich weiß nicht, weshalb mich das erschreckte; ich wurde immer mutloser, wagte nichts zu fragen, gab das Warten auf: Die Wellen und die Tiefe waren weiter entfernt als je, auch Schaum und Licht gab es nicht mehr, und das mächtige Schiff, als das mir Onkel Raymond erschienen war, wurde kleiner und kleiner, bis der Horizont es einsog. Es wohnte dort hinten in der Dunkelheit in einem winzigen Loch, und die neue Tante – Monika hieß sie – lebte zwar im Vordergrund, doch irgendwo in der Luft: Vielleicht auf einer Wolke hatte sie ihre Polstermöbel aufgestellt, ihre polierten Tischchen und Kommödchen, ihre staubfreien, echten Teppiche, den Nagellack und den Lippenstift und die Teetassen und die blonde und die schwarze Perücke.
Wer war ich? Meinen Vater kannte ich nicht, an meine Mutter erinnerte ich mich kaum (einmal hatte sie mich mit einer Kelle geschlagen, und als die Kelle ihr aus der Hand und hinter den Herd gefallen war, nahm sie eine zweite, um mich weiterzuprügeln, bis ich blutete …) und Tante Agnes wurde in meinen Wachträumen eine Art vornehmes Skelett, das mit Vorliebe französische Brocken ins Gespräch eingestreut hatte; ich wusste nur noch: «Oh lala» und flüsterte das manchmal heimlich, um mich mit irgendjemandem verbunden zu fühlen. Sie hatte einen stimmlosen Hund besessen, den Onkel Raymond töten ließ, und war immer sehr aufrecht geschritten und steif in hochlehnigen Stühlen gesessen. Ich weiß nicht, was sie in ihrer Kindheit alles hatte schlucken müssen, dass sie so steif geworden war. Ich stellte mir vor, dass sie niemanden geliebt hatte; auch mich nicht – seltsamerweise tat mir das, obwohl es mich quälte, wohl.
Ich besuchte die Schule im Dorf und saß neben einem Mädchen, das wie meine Banknachbarin im letzten Heim Grete hieß, nur dass es rotes Haar hatte, während jenes braun gewesen war. Während der Schulstunden träumte ich davon, wie ich einen Vorstoß unternehmen würde; was ich mir unter «Vorstoß» vorstellte, hätte ich nicht mit Worten erklären können. Ich wollte aus meiner Starre aufgeschreckt werden, mich fortbewegen, zu jenem Loch im Horizont schwimmen oder fliegen, wohin das große Schiff verschwunden war, wo es so tat, als ob es ein harmloser Wasserkäfer wäre; lächerlich schwach oder gar nicht vorhanden. Oder ich wollte in die Tiefe tauchen, immer tiefer und tiefer; vielleicht erwartete mich dort ein anderes Schiff, das zwischen silbernen Fischleibern äugte und dröhnend lachte, wenn es mich sah; natürlich hätte ich mich verwandelt, wäre ein wunderschönes Mädchen, ein Fräulein aus dem Film, eine Sängerin mit einer Stimme wie ein Wind so klar und fürchterlich geworden.
Onkel Raymond sahen wir nur übers Wochenende und auch dann nicht immer. Er war in einem kleinen Museum als Konservator tätig und ich nahm an, er müsse sehr gescheit sein, ein Genie vielleicht; sogar seine Zähne dünkten mich melancholisch, weil sie breit und gelb und schwer waren. Ich liebte es, wenn er Lederhandschuhe trug; ich hätte gerne hineingebissen bis ins Fleisch und dann seinen Schrei gehört; einen wilden, bösen Vogelruf. Ich wollte und konnte nicht annehmen, dass alles wie tot war: Ich sehnte mich nach Aufruhr, Blitz, Getöse, Leben und Mord. Ich wollte die Ferne in die Nähe zwingen, sie befühlen, drücken, an mich reißen, mich in ihr wälzen – ob Tante Agnes das getan hatte? Und Tante Monika? Ich wusste, dass Tante Monika sich oft in der Stadt mit einem faden, dünnhalsigen Friseur traf, dessen Namen ich vergessen habe; sie telefonierte ihm fast täglich und fuhr jeden Montagnachmittag mit ihrem kleinen, dummen Rosawagen in die Stadt, wo ich sie einmal mit ihm Arm in Arm entdeckte. Sie betrachteten einen Hutladen. Ich hasste sie – aber nicht nur; widerwillig stellte ich fest, wie es mich freute, dass sie Onkel Raymond betrog.
An einem Samstagnachmittag, der unter einem schlaffen Himmel umsonst auf Regen wartete, traf es sich, dass ich mit Onkel Raymond allein zu Hause saß. Seine Frau war an einer Klassenzusammenkunft, wie sie mit einer Einladungskarte beweisen konnte – was mich aber nicht hinderte, ihr zu misstrauen. (Am Tage vorher war ich unfreiwilliger Zeuge einer peinlichen Szene geworden; ich hörte, wie Tante Monika außer sich schrie: «Du bist kein Mann, ich hab’s endlich satt; ich werde schon anderswo auf meine Rechnung kommen, du blöder Kirchgänger, du!», und heulend und türenschlagend im Schlafzimmer verschwand.) Onkel Raymond hielt sich in seinem Studierzimmer auf und ich sollte Schularbeiten machen, trödelte jedoch herum, trank Zitronenwasser, aß Biskuits und blätterte in alten Fotoalben, in welchen ich nur fremde Menschen sah, die mir wie Sektenmitglieder vorkamen, die Farbe als Sünde betrachten; alle trugen sie graue und schwarze Schatten als Kleider und Kopfbedeckungen, als Augen, Nasen und Wangen, und alle waren sie umsorgt von ernsten Hauswänden, lichtlosen Himmeln und trübseligen Baumgruppen. Niederschmetternd war aber für mich die Feststellung, dass Onkel Raymond – dieses in meiner Vorstellung furchterregende Kriegsschiff, das sich durch feindliche Gewässer geschoben und Schreckliches im Schild geführt hatte, sich nun aber vor mir versteckt hielt in der Erwartung, dass ich aufbrechen würde, um es zu suchen – als mageres, bleichsüchtiges Studentlein erschrocken neben einer glotzenden Riesenkuh stand; richtig, ich entsann mich, dass Tante Agnes einmal angetönt hatte, dass er aus kleinbäuerlichen Verhältnissen stammte und einen Bruder hatte, der irgendwo Pächter war. Ich hatte mich also getäuscht: Auch er hatte nie gelebt; es war sinnlos, ihn am Horizont zu suchen, war er doch gewiss immer noch das kümmerliche Studentlein, das, falls ich in seinen Lederhandschuh beißen würde, nur ein hohes, furchtsames «Au» hervorstieße, obwohl es mit den Jahren massig geworden war.
Ich geriet in Wut und fühlte mich betrogen, wurde es mir doch jetzt noch deutlicher als vorher bewusst, dass es die Wellen gab, auf welchen ich schaukelte, und die Winde, die mich hierhin und dorthin bliesen, und die wie erloschene, aber gewiss heiß leuchtende Tiefe, und das Versteck am Horizont, klein wie ein Nadelöhr …
Schnurstracks lief ich in Onkel Raymonds Studierzimmer, ohne anzuklopfen, ohne vorher einen Blick in den Spiegel geworfen zu haben. (Auch so war mir bewusst, dass ich meine Bluse nur nachlässig zugeknöpft hatte; ich hatte mir angewöhnt, in Onkel Raymonds Haus in einer Weise herumzugehen, von der ich annahm, sie sei «sexy»; Vorbild war mir Tante Monika. Oft tat ich so, als wäre ich erschrocken, wenn ich frühmorgens im kurzen Nachthemd über den Korridor lief und er mir begegnete; sein verwirrter Blick bereitete mir Vergnügen, denn obwohl ich davon überzeugt war, hässlich zu sein, wusste ich nun, dass mir endlich kleine Flügel wuchsen; sie sollten mich dorthin tragen, wo die gefährlichen Schiffe lauerten, auf ihren Kapitän oder Feind warteten …) Mitten in sein dunkles, dickes Gesicht erzählte ich ihm nun, dass Tante Monika ihn seit Monaten mit einem Friseur betrüge. Er starrte mich an; seine Augen waren wie erfrorene Blumen, seine Lippen grau. Er wies zur Tür, indem er den Ellbogen nur ganz wenig hob und sagte: «Agnes, du hast mich enttäuscht – wenn du wüsstest, wie du mich enttäuscht hast.»
Ich durfte nicht mehr in jenem Haus bleiben; einige Tage später packte ich meinen Koffer, um auch mein vierzehntes Jahr in einem Heim zu verbringen. Ich galt nun nicht mehr als nur verstockt, sondern auch als lügenhaft und verdorben. Ob Tante Monika ihren Friseur weiterhin besucht, weiß ich nicht. Von Onkel Raymond träume ich seit langer Zeit immer dasselbe: Er öffnet eine Tür und heißt mich eintreten; er ist zwergenhaft, stützt sich auf zwei Krücken, trägt Pantoffeln an den Füßen und blickt mich süß an, doch das Zimmer, in dem er steht, ist mit dornigen Gewächsen gefüllt, die kreuz und quer durch den Raum ragen; an einigen sehe ich Blut. Ich habe einen schweren Sack in der Hand und friere; trotzdem kann ich mich nicht entschließen einzutreten, sondern stehe lange Zeit, vor Erwartung und Grauen wie angenagelt, auf der Schwelle – so lange, bis Onkel Raymonds Gesicht sich vor Zorn rötet und entstellt und er mir mit hasserfüllter Gebärde und wie von Ekel gepackt die Türe weist. Dann drehe ich mich um und steige die Stufen hinunter. Wenn ich dann glaube, erwacht zu sein, sind meine Wangen von Tränen nass und ich bin der Meinung, auf den Tod krank zu sein, und entsinne mich, dass ich meine Bettnachbarin gebeten habe, den Arzt zu holen – der Arzt aber ist Onkel Raymond. Nun steht das Mädchen vor mir, keuchend noch vom Laufen, und erklärt: «Der Arzt will nicht kommen; er sagt, er sei von dir enttäuscht.» Mit einem Stöhnen der Verzweiflung erwache ich, höre das Atmen und leise Schnarchen wie von tausend Tierchen, die in kleinen Schachteln verpackt sind, und manchmal den Wind, der das Haus mit vielen Regenvorhängen umwickelt.