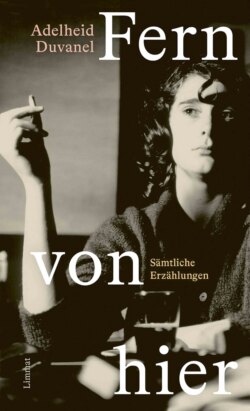Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Prinzessin
ОглавлениеVera wohnte seit einem Jahr in einem winzigen, weißen Haus an der Küste; vor ihr war nur der Himmel – ein kleines, totes Blau am Tag, ein Sammetbeutel voll goldener Kugeln in der Nacht – und das Meer; sie deckten die Vergangenheiten, die Vera mit stundenlangem Gekritzel hervorlocken wollte, zu wie Schatten von Riesen.
Veras kleine Tochter trat ins Haus, setzte sich, nachdem sie drei oder vier Butterbote verzehrt hatte, an den Tisch und verfertigte eine ihrer unzähligen Zeichnungen: Am Himmel rollten zwei Sonnen, im Gras stapften eine dickbäuchige, kahle Prinzessin und ein Zwerg.
Vera hatte Kindern gegenüber immer Unbehagen empfunden; bevor sie selber Mutter wurde, konnte sie die kleinen Geschöpfe nicht an sich drücken wie andere Frauen, sowenig wie sie es über sich brachte, ein Tier zu kraulen; das fremde, ungewohnt riechende Fleisch flößte ihr Abscheu ein. Sie verstand es noch heute nicht, mit Kindern zu scherzen; sie fand sie frech und unberechenbar, und ihr Übermut erschreckte sie. Sie fühlte sich ihnen unterlegen wie damals, als sie als sechsjähriges Mädchen zum ersten Mal ins Schulzimmer getreten war und die vielen schrecklichen Wesen gesehen hatte, die so laut und herausfordernd und grausam waren und deren Freuden und Leiden sie nicht teilen konnte. Sie war das einzige Kind ihrer Mutter gewesen und liebte nur ihre eigenen Freuden und Leiden; sie waren bedeutsam; vertraut und fein wie das Glück und die Schmerzen der Gräfinnen in den Romanen ihrer Mutter. Das Lachen der Schulkameradinnen fand sie roh, ihr Weinen peinlich, ihre Hände und Füße hässlich. Das Mädchen, das neben ihr in der Bank gesessen war, hatte an der rechten Hand nur vier Finger besessen; jede Berührung dieses Kindes hatte ihr Gänsehaut verursacht.
Sie erinnerte sich nur ungern an ihre Freundschaft mit Martha, die sich ihr aus dem einzigen Grund aufgedrängt hatte, weil sie beide – im Gegensatz zu den übrigen Kindern – katholisch waren. Marthas Kichern, ihre plumpen Wangen, ihre wie polierten Augäpfel, ihre Albernheit, das Schreiben von «wichtigen Mitteilungen» auf Papierfetzen, die sie ihr unter der Bank zugeschoben hatte, ihre Geständnisse, ihr Flüstern im Pausenhof, in der Kirche, hinter dem Haus – alles hatte Vera angewidert, doch sie hatte getan, als ob sie wäre wie Martha, um ihren Stolz und ihre Einsamkeit zu schützen; instinktiv hatte sie erkannt, dass man Edelsteine am sichersten in billigen, unansehnlichen Behältern aufbewahrt.
Vera hatte Martha viel später einmal unvermutet getroffen; Martha war verlobt, überhitzt wie ein Lampion, bevor aus ihm die Flammen schlagen und das Papier wie nichtige Worte durcheinanderwirbelt und verschwindet, als wäre es nie da gewesen. Vera hatte damals jeweils am Abend mit Ekel ihre eigenen, langen, weißen Glieder, die mit braunen Punkten übersät waren, betrachtet und gedacht: «Wer mag die schon.» Dann aber hatte sie einen ehemaligen Fremdenlegionär geheiratet, einen schmalen, dunkelhäutigen Burschen, dessen Gesicht aussah, als ob Mehl über Paprika gestäubt wäre; entschärft, verwischt. Nach drei Jahren wurde die Ehe geschieden, und ein Jahr später heiratete sie einen großgewachsenen Engländer mit glatten, runden Gliedern wie aus Teig und einwärts gerichteten Füßen, der ziemlich vermögend war, Frösche sammelte und sich am liebsten unter Wasser aufhielt; seine Augen hinter der Taucherbrille erinnerten sie an zwei Tropfen Lebertran. Diese Ehe dauerte nur zwei Jahre.
Ihre Ehen waren für sie beklemmende Träume, die sie vergessen hatte. Sie hatte nie geliebt; für den fremd bleibenden Legionär, den Vater ihres Kindes, hatte sie eine etwas verrückte Leidenschaft empfunden, die erst nach seinem Verschwinden – dann aber schnell – erloschen war, was sie enttäuscht hatte; sie hatte erwartet, sie würde des Nachts leidend seinen Namen flüstern. (Nur in jener Nacht, als der Gatte das Weite gesucht hatte, hatte sie, obwohl sie von dem skandalösen Ereignis noch nichts wissen konnte, im Traum seine Fotografie vom Nachttisch heruntergeschlagen und das Glas zertrümmert.) Der nach Hausfrauenart pedantische Engländer samt Tabakpfeife und tantenhafter Furcht vor Katzen war ihr nur lästig gewesen. Deshalb bestürzte sie die Liebe zu ihrer Tochter; sie hatte in ihrem Leben nie Angst gekannt, nur Ekel und Widerwillen und Gleichgültigkeit und eine Trauer, die sie – wie einen großen, dunklen, fernen Falter – mit Dankbarkeit bewunderte. Nun hatte sie Angst um sich und um ihr Kind; sie fürchtete, sich selber oder das Kind zu verlieren.
Es war Abend. Das Töchterlein, das nach Veras Mutter Saskia getauft worden war, lag auf seiner Matratze in der hintern Ecke des einzigen Raumes, dort, wo helle und dunkle Wolken wie gute und böse Engel hinter dem Fenster vorbeiflogen; Hand in Hand oder Rücken an Rücken. Das Fenster hatte ein Stück des Ölbaumes abgeschnitten und eingerahmt. Saskias dunkle Lippen besaßen einen zarten, lilafarbenen Glanz wie die Lippen von Mulatten und öffneten sich leicht im Schlaf, die Wimpern glichen feinen, samtbraunen Blumenblättern. Scheu betrachtete Vera die nun vollendete Zeichnung, die das Mädchen selber an der Wand neben dem Fenster befestigt hatte, und mit einer seltsamen, schmerzlichen Freude erkannte sie, dass sie darauf die Farben, die sie soeben so eigenartig glücklich gestimmt hatten, wiederfand; als ob das Kind, fasziniert von seiner äußeren Erscheinung, versucht hätte, sie dem Papier mit den knapp erzählten Wahrheiten aufzuprägen: Braun und lila waren die beiden Sonnen, und lila und braun war die mächtige Prinzessin, der nun langes, starkes Haar zum Kopf herauswuchs wie ein Gewirr von Seilen. Nur der Zwerg war weiß geblieben, durchsichtig; er schien unter der Last der Farben über ihm zusammenzubrechen. Plötzlich glaubte Vera, in ihm sich selber und in der aufgeblähten Prinzessin, die wie ein mit zwei strahlenden Kronen versehenes Untier in der Mitte thronte, ihre Tochter zu erkennen – oder war es Martha, die hier Atem holte, um ihr ein letztes Mal Widerwärtiges ins Ohr zu zischeln? Ekel würgte sie, wie sie ihn, seit sie hier einsam wohnte – umgeben von sauberem Sand, roten Felsen, glänzendem Wasser und einem Himmel, der so reinlich war wie das geplättelte Badezimmer ihrer verstorbenen Mutter – nicht mehr gekannt hatte. Dann aber sah sie ihre Tochter im Traum lächeln; sie beugte das Knie und küsste das Kind auf die von der Sonne verbrannte Wange, auf welcher ein wenig Sand klebte.