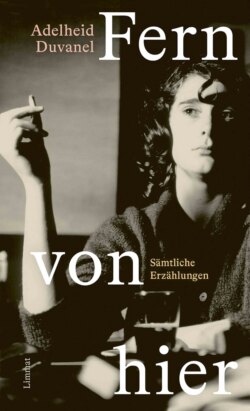Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sabel
ОглавлениеIn wenigen Tagen würde Sabel – eigentlich hieß sie Isabelle wie die Mutter – mit den Eltern und vier jüngeren Geschwistern in eine Notwohnung eingewiesen werden; in eine der Baracken am Fluss, wo auch das dunkelhäutige Mädchen lebte, dessen Namen sie nicht kannte. Das Haus, in dem sie wohnten, wurde abgerissen.
Sabel hatte stets entzündete, geschwollene Augenlider; man hatte den Eindruck, sie könne die hellen Augen auch von unten her schließen. Sie stellte sich vor, dass sie kein Kind wäre, sondern eine in ein Kind verwandelte Erwachsene. Während Kinder wie die Dunkelhäutige sich schützen konnten, weil sie niedlich und drollig wirkten und bei Erwachsenen Zärtlichkeit hervorriefen, war Sabel – so fand sie – ein kleines Scheusal, nicht weniger hässlich als die Großmutter der Mulattin, deren roter Rücken im Sommer faltig über das hinten weit ausgeschnittene Badkleid hinunterhing. Der Gedanke, die drei großen Zimmer mit der vergilbten Tapete, den hohen Fenstern und den knarrenden Türen für immer verlassen zu müssen, in welchen sie nun ein Jahr lang gelebt hatten, verursachte Sabel Schwindel und Angst, auch war es keine Beruhigung, die Schwarze nun ganz in der Nähe zu haben; sie hatte noch nie mit ihr gesprochen und fürchtete sich, sie wirklich kennenzulernen, denn sie hatte ein blitzendes, unbarmherziges Lachen. Gerne wäre Sabel stumm zur Welt gekommen; am liebsten saß sie auf einem Stuhl und dachte sich Handlungen aus, in deren Verlauf das dunkle Mädchen von ihr vor dem Tode errettet und dann auf unklare Weise angebetet wurde, indem sie ihm überallhin folgte, alles tat, was es befahl, sogar stahl und schließlich seinetwegen starb.
Sabel lebte wie in einem Zelt, das immerzu mit neuen Bildern, Szenen und Zeichen bemalt wurde; das Tuch aber wurde kleiner und kleiner geschnitten vom Ticken der Uhr, die im Esszimmer auf der Kommode stand. Bald würde sie das Zelt nicht mehr brauchen, das ihr Horizont war, das ihr die Sicht in die Ebenen, in die Weite jenseits verwehrte, um sie zu schützen. Vorläufig hatte sie noch Bilder und Zeichen nötig, brauchte sie das Mulattenmädchen mit den großen Lippen und den Augen, die so schwarz waren, dass sie ohne Blick zu sein schienen; Sabel stellte sich manchmal vor, das Kind sei blind und sie führe es, läse ihm vor und lasse sich anschreien, weil sie nur mühsam buchstabieren konnte.
Sabel war eine schlechte Schülerin, aber sie war der Meinung, nur sie allein wisse, dass der Schnee am frühen Morgen blau war, dass im Frühling die Äste der Bäume wie mit einer Zuckerlasur bestrichen waren und die Sommerabende als milder, süß duftender Rauch überallhin quollen. Sie liebte den Baum hinter dem Haus; im Herbst stand er auf einem Bein im Regen; seine vielen bunten Flügelchen hatte der Wind davongeblasen und der Baum hatte doch so sehr gehofft, einmal wegfliegen zu können.
Sabel durchquerte den Vorgarten; sie schleppte den Schulsack wie einen Koffer, während andere Kinder ihn am Rücken trugen. Einige Schwalben schnellten schreiend die Straße entlang; ihre Schatten glitten über die Hauswände. Der Vater hatte sie letztes Jahr fotografiert, als sie sich auf dem Draht versammelt hatten; Sabel liebte die Fotos und hatte sie über ihrem Bett aufgehängt, doch die Mutter hatte sie wieder heruntergerissen, zerknüllt und in den Ofen geworfen.
Sabel kam meist zu spät zur Schule, da sie am Morgen nicht aufstehen mochte, sondern durch ihre weißen Wimpern wie durch einen Vorhang das Theater beobachtete, das ihre Geschwister mit viel Geschrei aufführten, indem sie die Kleider durcheinanderwarfen, Wasser spritzten und Milch verschütteten. Die Mutter hatte keine Lust, sich um ihre faule Älteste zu kümmern; selten kriegte Sabel Schläge, meist wurde sie übersehen – sie war ja auch zu still und so bleich, dass sie sich kaum von den weißen Leintüchern abhob und man den Eindruck hatte, es sei in Ordnung, dass sie im Bett blieb. Manchmal zischte die Mutter: «Du bist wie der Vater.» Der Vater aber war um diese Zeit schon zur Arbeit in die Fabrik gefahren. Sabel würde später nicht arbeiten; lieber würde sie verhungern.
Der Wald besaß eine kahle, kranke Stelle, die nun rot leuchtete; man nannte jenen nackten Knochen die «Fluh» – Sonntagsspaziergänge führten dorthin.
Heute fühlte sich Sabel unsicherer als sonst; sie hatte den Eindruck, sie bestünde aus unordentlich übereinandergelegten Bauklötzen und könnte plötzlich auseinanderfallen; aus Schwäche lehnte sie sich gegen einen kleinen Lastwagen, der geduckt im kalten Sonnenlicht stand, und streichelte ihn.
Das Schulhaus zeigte vorerst nur sein großes Dach; die Straße führte zu ihm hinauf wie zu einer Gottheit; es sperrte die Träume aus, doch sie glitten wieder hinein und füllten es mit unruhigen Schatten. Ein heftiger Wind stieß Sabel vorwärts; anscheinend lag ihm daran, sie zur Schule zu führen, doch plötzlich erlahmte er und fuhr wie ein alter Herr leise und vornehm im Rollstuhl davon. Sabel sah, dass es hinter dem Wald regnete; bald würde auch das Schulhaus eingetaucht sein in Wasser und Dunkelheit, und die Fenster würden vom Regen zerkratzt. Sie bemühte sich, schneller zu gehen; weich wie Elefantenfüße traten ihre Stiefel am Boden auf, in welchen erbärmlich dünne Beine staken.
Sabel hatte in ihrem kurzen Leben viele Umzüge durchgestanden, sich an neue Gerüche und fremden Lärm gewöhnen müssen. Dieses Mal musste sie das Schulhaus nicht wechseln. Sie sah einige Kinder aus einer Seitenstraße rennen; die schöne Mulattin war dabei, hatte die Hand erhoben, lachte und schrie. Sie war etwas jünger als Sabel, acht oder neun; ihre Stimme war angenehm rau wie die Stimme eines Buben.
Ein Schlag gegen das Ohr ließ Sabel taumeln; in vielen Farben schillernd wie ein großes Windrad wirbelte die Straße mit den Häusern, den Gartenzäunen und dem Himmel rundum und sie flatterte mit, drehte sich rasend schnell, sauste über eine steil abfallende Wand und fiel in Dunkelheit und Stille.
Jemand hob sie auf, drückte ihr ein Taschentuch gegen das Ohr und redete auf sie ein, doch sie war mit dicker Watte umwickelt und wusste, dass sie nicht gehen und nicht sprechen konnte. Von weither hörte sie eine aufgeregte Frauenstimme: «Ein dunkelhäutiges Mädchen war’s, ich hab’s gesehen; einen Stein hat sie dem Kind gegen das Ohr geworfen. Oh, das viele Blut …» Zufrieden, ja froh stellte sich Sabel vor, wie das Blut aus ihrem Ohr floss, sich davonmachte aus ihrem Körper und alle Wärme mitnahm, alles Leben, alle Gedanken – leer würde sie zurückbleiben, eine hässliche Hülle, die niemand brauchen konnte.
Nun würde die Dunkelhäutige sich nicht schützen können; man würde sie zur Rechenschaft ziehen, Sabel aber in ein Bett legen, umsorgen, bemitleiden, vielleicht lieben und versuchen, sie wieder aufzufüllen mit Wärme und Leben. Sie spürte, dass man sie in ein Auto trug; ihr Kopf mit dem kurzen, blassen Haar ruhte an der Brust eines fremden Mannes, auch die Frau mit der schrillen Stimme war dabei; während sie das Ereignis wieder und wieder kommentierte, fühlte Sabel sich geschaukelt von einem Meer aus Glück und Zärtlichkeit; das dunkle Mädchen hatte sie aus purem Übermut hineingestoßen in dieses weiche Wasser, aus Lust das Blut aus ihrem Ohr spritzen lassen, gesehen, wie sie auf der harten, schmutzigen Straße lag, und gelacht dazu, dann war es feige davongelaufen. Es würde ihm schlecht ergehen deshalb, man würde es ausschelten und strafen, doch Sabel würde es stärker lieben als bisher, denn sie gehörte ja nun zu ihm, zu seiner lauten Welt in jenen finstern Baracken am braunen, faul riechenden Fluss.
Je länger das Auto fuhr, desto deutlicher wurde alles, auch der Schmerz; hatte man ihr ein Stück vom Kopf weggerissen? Es war, als ob man mit einer kantigen Schaufel in ihrem Hirn graben würde; jemand hatte ihr das Ohr ausgerissen und wollte ein neues pflanzen … Sie fühlte Übelkeit in sich aufsteigen und fürchtete, sie müsse über den hellen Regenmantel des Mannes erbrechen. Leise begann sie zu weinen; nun war sie ein Kind, klein, schwach und schutzbedürftig trotz ihrer Hässlichkeit.