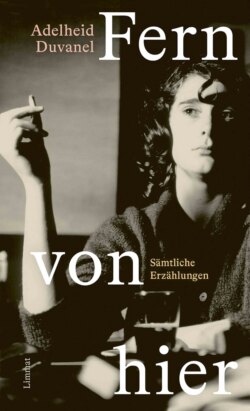Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Seit Martins Tod
ОглавлениеWenn Fränzi sich nach trockenem Holz und Pinienzapfen bückte, ließ sie sich vom Wind überrollen. Sie suchte das Meer, das an stillen Tagen wie eine Mauer in der Ferne stand und einen Berg trug; jetzt verbarg es sich hinter einem kleinen Nebel. Zerzauste Schafe zitterten, wenn die wie Nonnen gekleideten Bäuerinnen breitbeinig und böse krächzend über die steinigen Felder liefen, und die Mutter sagte: «Der Wind quält.»
Auch in den Nächten knatterte der Wind pausenlos über unsichtbare Straßen; die Vorhänge vor den geschlossenen Fenstern bewegten sich und das hastige Klopfen des Weckers neben der Kerze schien Fränzis Herz nachzuäffen. Die Mutter schlief nicht; Fränzi sah ihre komische, kurze und spitze Nase, die die schmalen Lippen überdachte, doppelt: an der Wand als graue Tuschmalerei und über der Bettdecke pfirsichfarben. Viele Kerzen und viel Petrol brauchte man in solchen Nächten, in denen neben dem Hut am Haken mit dem darübergeworfenen Kopftuch ein stumpf erstauntes, zungenzeigendes Froschgesicht an der Wand erschien, das davonschwamm, wenn der Morgen kam.
Manchmal flüsterte Fränzi: «Mama, wann fahren wir nach Hause?», dann hob die Mutter den Kopf von ihrem Buch und sagte: «Schlaf.»
Aber es war schwierig, den Schalter für den Schlaf zu finden, wenn man draußen das rhythmische Rauschen und Summen hörte – als ob der Wind mit einem riesigen Wasserfall spielen würde. Manchmal krachte die Tür, und Fränzi stellte sich schaudernd vor, wie der Wind im Kamin in der Küche miaute. Wenn der Schlaf die Hand auf ihr vor Angst kaltes Gesicht legte, sah sie zwischen seinen Fingern auf dem Nachttisch Disteln in einer Flasche, die vor einem grauen Distelbaum standen, der die Wand hinaufgewachsen war und sich an der Decke über Fränzi und die Mutter beugte; vielleicht war es auch ein Sternbaum – die Nacht war voll glitzernder Sternbäume, an deren Äste der Wind turnte als Affe ohne Pelz; er besaß eine narbige Lederhaut und schwamm von Baum zu Baum. Er hatte das Brüderchen geholt, das im Meer ertrunken war, und trug die Leiche als Gürtel um seinen Bauch. Vom Brüderchen standen Fotografien im Esszimmer; es hatte einen großen Kopf mit braunem Haar und lachte gern. Sein Lachen schien immer noch in den Wänden des Hauses, das vor dem Tod des kleinen Martin nur ein Ferienhaus gewesen war, verborgen zu sein; wenn Fränzi lauschte, hörte sie es leise klingen – wie aus weiter Ferne; ob die Wände in die Ferne gerückt waren?
Wie die Orgel in eine Kirche, so gehörte Martins Lachen zu diesem Haus. Jahrelang hatte die Mutter mit ihren beiden Kindern den Sommer hier verbracht. Nun war aber der Sommer längst vorbei; der Herbst und der Winter versuchten, vor Martins Tod zu stehen und ihn zu verstecken, doch es gelang ihnen nicht; zuerst kam der März und wusch mit seinem Regen ein Stück von ihnen weg, und nun war der April da mit seinem Wind, der sie umstieß. Die Erinnerung an Martins Tod war so deutlich und schmerzlich grell wie im Sommer; es gab keine Sekunde, in der Fränzi nicht wusste, dass er gestorben war.
Sie waren letztes Jahr früher als sonst hier angekommen; der lange Regen war vorbei, aber das Haus innen noch feucht. Die Mutter öffnete Türen und Fenster, stellte die Matratzen hinaus und ließ die Leintücher an der Leine flattern. Fränzi wusste es noch genau; sie und Martin sammelten Schnecken und betrachteten einen Wiedehopf, der mit seinem Weibchen spielte. Der Morgen und der Abend waren am andern Tag kalt, doch am Nachmittag brannte die Sonne und der Wind war sanft und lustig. Die Mutter erlaubte ihnen, im Meer zu schwimmen, während sie das Haus putzte, und auch am nächsten Tag wanderten sie eine halbe Stunde bis zum Strand und vergnügten sich im noch kühlen Wasser, während die Mutter Briefe schrieb. Da geschah der Unfall; Martin lieh sich von einem andern Jungen die Taucherbrille aus und ertrank, ohne dass jemand es sofort bemerkte. Fränzi erstellte mit kleinen Ästen eine Hecke um ihre Sandburg; niemand war am Strand als die Mutter des andern Jungen; sie schlief rot und dick und ölig – später weinte sie. Ihr Sohn, ein leicht idiotisches Kind von zehn Jahren, das die zwölfjährige Fränzi um Haupteslänge überragte, fand den toten Martin und verkündete das Ereignis später immer wieder stolz.
Seit dem Unfall war Fränzi nicht mehr am Strand gewesen, und ihre Mutter hatte das Haus seit der Beerdigung nicht mehr verlassen; jeden Tag ging das Mädchen eine Viertelstunde weit ins Dorf, um einzukaufen. Nackt und frierend schienen die weißen Häuser im Wind zu stehen, der Sand gegen die Scheiben warf und die verblichenen, klappernden Storen hinauf- und hinunterzerrte. Ein lahmes Kind bewegte sich manchmal auf Händen und Füßen über die holprige Straße und trug eine Tasche im Mund; wenn der Wind es umwarf, rappelte es sich wieder hoch, drehte sich auf sonderbare Weise einmal um sich selbst, schlenkerte die dünnen, krummen Beine und hoppelte weiter. Es hatte ein hübsches Gesicht und braune, kräftige Hände. Wenn Fränzi an der Kirche vorbeiging, erinnerte sie sich, wie Martin auf das Kreuz gezeigt und gefragt hatte: «Weshalb ist da ein Flugzeug auf dem Dach?» Er war noch so klein und unwissend, aber Fränzi wurde von ihrer Mutter jeden Tag vier Stunden lang in Aufsatz, Mathematik und Fremdsprachen unterrichtet. (Sie wusste, dass manche Leute an einen lieben Gott glaubten, der sich aus dem Himmel beugte und eifersüchtig und nörgelnd ihr Tun beobachtete; alles, was mit diesem lieben Gott zusammenhing, ging sie, die Mutter und Martin nichts an.) Seit Martins Tod fiel ihr das Lernen schwer; es war, als habe jemand einen Sack voll kleiner, scharfer Messer über sie ausgeleert, die alles auftrennten, was die Mutter ihr in den Schulstunden beigebracht hatte: Die Wörter zerfielen in Silben, die Silben in Buchstaben, die Buchstaben in Striche und Halbkreise.
Manchmal sah sie im Traum Martin wie das lahme Kind auf Händen und Füßen auf einem steinigen Weg; ihr Herzschlag setzte aus, doch plötzlich richtete er sich auf und kam zu ihr gerannt; sie sah sein liebes, lachendes Gesicht ganz nah, blickte in seine Augen wie in weit geöffnete Blumenkelche und drückte seinen kleinen Körper an sich, doch dann schien jemand ihr Herz mit zwei Nadeln auseinanderzuziehen; der Schmerz ließ sie erwachen und sie wusste, dass Martin tot war und weinte lautlos, fast ohne die geöffneten Lippen zu verzerren.
Im Himmel leuchtete die Sonne wie ein runder Gott, den der Priester über dem Altar zeigte. Winde rasten vorbei und läuteten im Wasser, das die Mutter in einem irdenen Krug von der Zisterne zur Küche trug. Im tiefen Brunnen schwamm seit vielen Tagen eine tote Eidechse; die kleine Leiche ruderte mit dem Schwanz und den Füßen, sooft der Eimer ins Wasser tauchte; das wirkte ungehörig. Stieß man mit dem Eimer nach ihr, schwamm sie davon.
Fränzi hasste die tote Eidechse, die so tat, als lebte sie noch, und die sie nur einmal gesehen hatte, da die Mutter ihr nicht erlaubte, Wasser zu holen; das Heraufziehen des Eimers und Tragen des Kruges hätte die Kräfte des schmächtigen Kindes überfordert. Selbst das Heben des hölzernen Deckels gelang Fränzi kaum; der Wind versuchte ihn ihr aus der Hand zu reißen. Die Mutter war zum ersten Mal seit der Beerdigung des Brüderchens ins Dorf gegangen, um einen Brief an ihre Schwester einzuwerfen; sie gedachte, mit Fränzi in einer Woche nach Hause zu fahren – dann war es ein Jahr her seit Martins Tod. Vorher aber wollte Fränzi versuchen, mit dem Eimer die Eidechse hochzuheben; die Mutter hatte es schon einige Male probiert, doch immer war das tote Tier ihr entwischt.
Nachdem Fränzi den Deckel weggehoben hatte, ließ sie langsam den Eimer hinunter; der Wind strich über das schwarze Wasser und zerteilte ein blaues Fenster, aus dem sich ein Mädchen beugte, dem fuchsrote Zöpfe über die Schulter hingen; Fränzi hatte erstaunt sich selber erkannt und sich an ihrem Spiegelbild gefreut; es war, als ob Goldmarie ihr zugenickt hätte. Andere Märchen fielen ihr ein, in welchen tiefe Brunnen eine Rolle spielten: Rotkäppchen oder die sieben Geißlein. – Die Eidechse bewegte sich. Vorsichtig versuchte Fränzi, ihr mit dem Eimer zu folgen, doch sie wich gegen den Rand hin aus; eine Weile war sie im Dunkel verschwunden, dann trieb sie wieder gegen die Mitte. Fränzi schwenkte mit dem Eimer, der sich rasch füllte, gegen die Mitte und kletterte auf den Brunnenrand, das Seil mit der Faust krampfhaft haltend – weit beugte sie sich hinunter. Ein gellender Schrei ließ sie zusammenzucken; sie sah ihre Mutter mit schreckgeweiteten Augen auf sich zueilen und glitt langsam auf den Boden, wobei sie nicht merkte, dass ihr das Seil aus den Händen fiel und in den Brunnen klatschte. Zitternd ließ sie sich – zum ersten Mal seit des Brüderchens Tod – umarmen und schluchzte: «Die eklige Eidechse – Mama, nimm die Eidechse weg; mir graut vor ihr.»