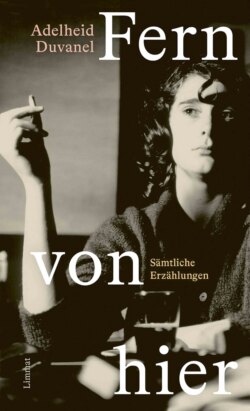Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Brillenmuseum
ОглавлениеWie sich doch die psychiatrische Klinik dieser Stadt vergrößert; es wird ständig gebaut. Die Klinik wirbt mit Plakaten: «Kommen Sie zu uns! Werden Sie Patient! 1000 Psychiater erwarten Sie!» Ich wollte einmal über diese Klinik eine Erzählung schreiben. Ich wollte zum Beispiel den Satz: «Die Patientin warf ihrem Arzt einen fetten Traum vor» verwenden. Die Ärzte hätten es aber nicht geschätzt, mit gierigen Tieren verglichen zu werden, mit entthronten Löwen, denen nicht der Löwenanteil zusteht, sondern die froh sein müssen über jeden Happen Traum, den ihnen die Patienten hinwerfen. Wenn die Patienten dies nicht täten, müssten die Psychiater hungern an ihrer Seele und an ihrem Geist. Sie ziehen den Patienten eine Haut nach der andern ab und verzehren diese Häute. Ich wollte über eine Patientin schreiben, die den größten Teil ihrer Häute für sich behält; die Ärzte dürfen an ihren Häuten zwar riechen und lecken, aber nur selten und wenig davon fressen. Oft lassen die Ärzte einen Patienten mit nur noch einer Haut austreten; sie erklären ihn für gesund, doch nach einigen Wochen ist er wieder in der Klinik. In Wirklichkeit können sie niemanden für immer gesund machen; diese Tatsache wollte ich in meinem Text nicht verschweigen. Die Ärzte testen an ihren Patienten Pillen; manche dieser Medikamente bewirken Unruhe, Halbblindsein, Nicht-mehr-schreiben-Können. Die Patienten knüpfen ihren zerrissenen Geduldsfaden immer wieder neu. Wenn der Faden zu kurz geworden ist, wenn er sie nicht mehr zusammenhält, bleiben sie für immer in der Klinik als alt und schal gewordener Fraß, dem kein Psychiater mehr Interesse entgegenbringt.
Die Psychiater sind ganz versessen auf Erlebnisse ihrer Patienten. Ich glaube, als Patient braucht man viel mehr Platz denn als Nicht-Patient, um sich «in seiner Seele zu ergehen», wie man es geschwollen ausdrücken könnte. Ist man wieder «Nicht-Patient», schrumpft die Seelenfläche. Seitdem die Kranken diese neuen Pillen schlucken, bleiben aber das Wachstum der Seelenfläche und die Erlebnisse meist aus; die Seelenfläche sackt ein, und die Pillen ersticken die Phantasie.
Psychiater interessieren sich nicht nur für Erlebnisse, sondern auch für Unfälle. Sie sind Polizisten, die in Erscheinung treten, wenn sich ein Unfall ereignet hat: Sie stellen Pannendreiecke auf, markieren, fragen die Zeugen aus, notieren. Mehr können sie nicht tun; es liegt nicht in ihrer Macht, Verletzte zu heilen oder Tote zum Leben zu erwecken.
Man kann so tun, als ob nichts wäre. Die junge Patientin Olga ist trainiert darauf. Aber eines Nachts träumt sie: In ihrem Zimmer im ersten Stock des Elternhauses auf den Holzdielen unter der reich verzierten Barockdecke stehen Kisten voller Hefte und Bücher. Im Kamin liegt bündelweise Papier, in den Ecken stehen Kartotheken, auf dem Tisch türmen sich lose Blätter. Olga sichtet, ordnet, schreibt und telefoniert. Sie hat ein Museum eingerichtet, das nie jemand besucht; es ist ein kleines Museum für Brillengestelle im Erdgeschoss. Sie glaubt an die wichtige Funktion dieser Gestelle und der dazugehörenden Gläser, die Gesichter veredeln, verdummen, verschönern oder verwüsten. Wenn jemand sein brillenloses Dasein gegen ein Dasein mit Brille eintauschen muss, kann diese Person eine ernstzunehmende Identitätskrise erleiden. Frauen lassen sich ungern mit ihren Brillen fotografieren, Sekretärinnen tragen aber oft mit Selbstbewusstsein große Hornbrillen. Was wäre Schubert ohne seine Brille? Es ist Olga gelungen, das Gesicht von Proust mittels einer Brille auf ungeahnte Art zu verändern.
Nett sind altertümliche Krankenkassenbrillen; die Gesichter erscheinen durch sie hilflos. Und wie viel verdankt ein guter Schütze seiner Schießbrille.
Auch Sonnenbrillen und Schneebrillen sind nützlich. Man beachte die Erzählung von Edgar Allan Poe: «Die Augengläser»; da verliebt sich ein junger, brillenloser Mann mit schwachen Augen in eine alte Frau, die er für ein junges Mädchen hält. Oder man stelle sich die Frage, ob El Greco nicht ganz anders gemalt hätte, wenn er Brillenträger gewesen wäre. Das Hauptinteresse von Olga gilt aber einer einzigen Brille, die es noch nicht gibt; sie macht unzählige Entwürfe, umrandet die Augen ihres weit entfernten Vaters auf einer großen Fotografie ganz zart, zeichnet für ihn Brillen, die sie immer wieder mit einem weichen Gummi ausradiert. Sie skizziert ovale, runde, eckige, dünn- oder dickrandige Brillen. Sie hofft fest, dass es ihr gelingen wird, das Gesicht des Vaters menschlicher erscheinen zu lassen. Je mehr sie zeichnet, je verzweifelter sie sich müht, desto grauenhafter wird der Ausdruck der väterlichen Augen – ja, des ganzen Gesichts. Die Augen glitzern, starren sie an, blinzeln, als blende sie das Licht der Ständerlampe, unter der die Fotografie liegt.
Nach einem halben Jahr Klinikaufenthalt kehrt Olga nach Hause zurück. Ihr Psychiater hat sich nicht in ihren Vater verwandelt. Kaum zu Hause, beschäftigt sie sich wieder mit dem Thema «Brillen», so dass sie, wenn sie unten über den großen Platz geht, zugleich oben in ihrem Schlafzimmer, dem Arbeitszimmer ihres Traums, am Fenster steht. Sie beobachtet, wie sie sich vor einem Café auf einen der weißen Plastikstühle, Jugendstilimitation, setzt, ein Cola trinkt und raucht. Bei schönem Wetter sitzen vor allem Touristen draußen unter dem Himmel, der die Türme der Kathedrale weit von sich weist. Olga sieht, wie sie mit dem Zigarettenstummel weiße Kreuze in die Asche im dreieckigen Aschenbecher gräbt. Sie ist als Gast dieses Cafés ausgestellt, aber von Zwängen frei, als säße sie auf einer hohen Leiter. Es gibt keine vier Ecken, wo Gottvater hockt. Olga schreibt einen Brief, den sie nicht an ihren Vater senden wird: «Da mir das Schreiben immer leichter fiel als das Reden, will ich mir treu bleiben. Es ist meines Erachtens besser, wir ändern die Rollen nicht, da wir zu ungeübt sind, um miteinander zu reden. Wann haben wir je miteinander geredet?» Um Olga zu charakterisieren, muss ich vielleicht noch erwähnen, dass sie nie die Bücher liest, die man gelesen haben muss, und nie die Filme besucht, über die man noch nach Jahren redet. Sie weiß nicht, welches Gesicht zu welcher Gelegenheit passt. Sie weiß nicht, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die Verbrechen begehen aus dem unbewussten Wunsch heraus, von der Polizei in Gewahrsam genommen zu werden. Sie weiß aber, dass die Kirchen und die politischen Parteien um Gläubige werben. Vielleicht auch das Militär. Trotzdem ziehen Jugendliche, vaterlose Horden, durch die Straßen der Stadt, zertrümmern Schaufenster, plündern und legen Brände. Kinder, junge Frauen und junge Männer kleben keine Plakate an die Wände, um für sich zu werben. Sie beschriften aber die Mauern der Stadt mit Sätzen wie: «Wir wollen leben! Auch Beton welkt!» Ein Jugendlicher hat an die Wand des Elternhauses von Olga mit einer Farbspraydose, blutrot, das Wort «Vorsicht!» hingespritzt. An Sonntagen begeben sich Bürger in das Stadtinnere, um die Schäden zu betrachten. Das sind schöne Spaziergänge, die einen Kinobesuch ersetzen.