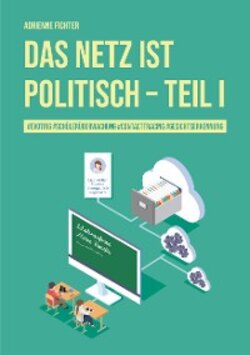Читать книгу Das Netz ist politisch – Teil I - Adrienne Fichter - Страница 22
Live-Chats zur Verfassung
ОглавлениеDas Verfassungsprojekt startet erfolgreich. Zuerst sind sich alle Parteien über das Verfahren[6] einig: Am 6. November 2010 sollen 950 zufällig ausgewählte Bürgerinnen eine Einladung aus Reykjavik erhalten. Ihr Auftrag: Ideen und Eckpunkte zu sammeln. Das Resultat mündet in einen 700-seitigen Bericht. Nun soll ein Kondensat dieses Crowdsourcings her.
Wieder sollen Bürger und nicht Politikerinnen anpacken. In der zweiten Runde sind es aber deutlich weniger. 25 Bürger kommen im Verfassungsrat, dem Stjórnlagaráð[7], zusammen. Hunderte kandidieren für den Rat. «Es war absolut ‹in›, sich für den Verfassungsrat zu bewerben», erinnert sich Smári McCarthy. Und jede kannte jeden Kandidaten über drei bis vier Ecken.
Mit schrägen Kampagnen erklären die Kandidatinnen, weshalb ausgerechnet sie für dieses staatspolitische Amt am besten geeignet seien.
Kaum gewählt, wagt der Rat bereits das nächste netzpolitische Experiment. Er überträgt seine Sitzungen live auf Youtube. Jeder Baustein des Entwurfs[8] kann kommentiert werden, wiederum natürlich im Internet. Stolz erklärt[9] das Stjórnlagaráð-Ratsmitglied Thorvaldur Gylfason: «Die ganze Öffentlichkeit kann live zuschauen, wie die neue Verfassung entsteht.»
Ein derartiges Crowdsourcing-Experiment in Sachen Demokratie hat die Welt zuvor noch nie gesehen. Medien wie der «Guardian»[10], die «New York Times»[11] und die «Süddeutsche»[12] berichten über die digitalen Wikinger.
Im Oktober 2012 ist es dann so weit. Das Volk entscheidet, per Referendum, über den Vorschlag des Verfassungsrats. Über 70 Prozent nehmen den Entwurf an. Der Urnengang hat zwar nur Umfragecharakter (mehr lässt nämlich der alte Dänemark-Klon gar nicht zu), aber bietet Stoff für Streit. Denn beim Referendum steht nicht nur der Entwurf des Verfassungsrats zur Debatte, sondern eine ganze Reihe weiterer Fragen[13]. Heikle Fragen. Machtfragen.