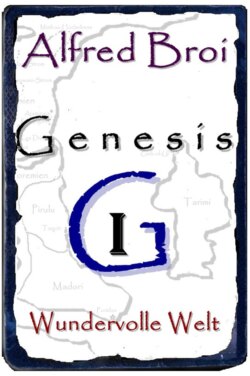Читать книгу Genesis I - Alfred Broi - Страница 14
Оглавление7
Santara war der vierte Planet des Sternensystems Infitaru, in dessen Zentrum der Sonnenstern Lexis sein urgewaltiges Licht versprühte.
Als einziger Planet des Systems war Santara mit einem Umfang von knapp vierzigtausend Meilen bewohnt und bestand zu rund vierzig Prozent aus Landmasse und zu sechzig Prozent aus Wasser.
Während die knapp acht Milliarden Menschen in ihren unterschiedlichen Rassen ausschließlich auf dem Festland und den fast eintausend Inseln lebten, waren nur etwa dreißig Prozent der gewaltig vielfältigen Flora und Fauna des Planeten dort angesiedelt, der Rest befand sich in den unergründlichen Tiefen der riesigen Meere.
Ursache für diese Unergründlichkeit waren die technischen Grenzen, denen sich der Mensch unterhalb der Meeresoberflächen ausgesetzt sah.
Natürlich hatte er längst Fahrzeuge entwickelt, mit denen er unter Wasser agieren konnte, doch waren diese Fahrzeuge teuer, langsam und nur bis zu einer bestimmten Tiefe nutzbar.
Die gewaltige Pracht an pflanzlichen und tierischen Lebensformen hatten sie erst zu einem lächerlich geringen Prozentsatz erforscht, sodass die Welt der Meere trotz des sehr hohen Technologiestandards des gesamten Planeten noch immer als weithin unentdecktes Territorium galt.
Jedoch war man sich allerorts mehr als einig, dass in den schier unendlichen Tiefen der Meere unfassbar gewaltige Mengen an Energien und Bodenschätze zu finden sein mussten, wie sie sich wohl niemand wirklich vorzustellen vermochte.
Solange die Energiereserven und der Lebensraum auf dem Festland ausreichten, um alle Menschen damit zu versorgen, blieb die Welt der Meere nahezu unangetastet.
Doch schon seit einiger Zeit waren Stimmen laut geworden, die das Ende der natürlichen Festlandsressourcen voraussagten.
Entsprechend war Handlungsbedarf gegeben, um den Lebensstandard der Menschen auf dem Planeten langfristig zu sichern.
Die Politiker waren sich wie immer ihrer Verantwortung bewusst, doch dauerten ihre Entscheidungsprozesse einfach zu lang und außerdem verfügten sie nicht einmal im Entferntesten über genügend Kapital, um diese gewaltigste aller Aufgaben in Angriff zu nehmen.
Entsprechend blieb es den Wirtschaftskonzernen des Planeten vorbehalten, hier in Forschung zu investieren.
Doch natürlich galt es hier nicht nur ein Wettrennen zu gewinnen, bei dem man schier unermesslichen Profit würde machen können, die Ausbeutung der Meeresressourcen musste in einem ökologisch vertretbaren Rahmen erfolgen.
Deshalb beschloss auch die Konzernführung der Imrix-Corporation den Weg unter die Meeresoberfläche anzutreten, um zu verhindern, dass der dort vorhandene Lebensraum rücksichtslos und unwiderruflich ausgebeutet werden würde.
Doch Imrix war ein Luftfahrtkonzern, die Anforderungen für eine Fortbewegung im Meer aber völlig anders, als ein Flug durch die Luft.
Aber Imrix wäre niemals das führende Unternehmen des Planeten geworden, wenn es nicht bereit gewesen wäre, technische Neuerungen durch aufwändige Forschung zu erringen.
Und so wurden die besten Techniker, die sich nur finden ließen - unter ihnen auch Jorik - mit der Lösung des Problems beauftragt.
Die Aufgabenstellung war dabei schier unmöglich, denn es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, den Lebensraum unter Wasser schnell und erschöpfend zu erforschen.
Bei den gewaltigen Ausmaßen der Meere war es daher unerlässlich, ein Transportmittel zu entwickeln, das unterhalb der Meeresoberfläche beachtliche Geschwindigkeiten würde erreichen müssen. Die Vorgabe der Konzernführung lag bei einer Geschwindigkeit von mindestens dreihundert Meilen in der Stunde, was bei den anwesenden Technikern – auch bei Jorik – nur für ein müdes Kopfschütteln gesorgt hatte, denn eine derartige Geschwindigkeit war bisher nicht einmal annähernd auf der Wasseroberfläche erreicht worden und niemand hatte in diesem Moment auch nur die geringste Ahnung, wie so etwas jemals unterhalb davon erreicht werden sollte.
Aber die Konzernvorgaben gingen noch einen Schritt weiter. Das Transportmittel sollte nicht nur mit einer höllischen Geschwindigkeit durch das Wasser schießen, es sollte ebenfalls in der Lage sein, auch die tiefsten Stellen des galpagischen Meeres und somit die tiefsten Stellen des Planeten überhaupt mit über dreiundzwanzigtausend Metern zu erreichen.
Am Ende der Konferenz waren sich alle einig. Dieses Vorhaben war einfach unmöglich in die Tat umzusetzen.
Auch Jorik sah es so, aber im Gegensatz zu seinen Kollegen akzeptierte er eine Sache erst als undurchführbar, wenn er selbst daran gescheitert war.
Also machte er sich mit seinem Team, indem sich neben Shim noch sieben weitere junge Ingenieure befanden, auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Und ihnen wurde sehr schnell klar, dass sie hier die Grenzen der normalen Physik doch gewaltig strecken und vielfach neu würden abstecken müssen, denn das war nicht die Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen, das war die Suche nach einer bestimmten Nadel in einem Scheiß-riesigen Haufen Nadeln – und sie hatten anfangs das Gefühl hierbei auch noch völlig blind zu sein.
Dann aber hatten sie ihren ersten Erfolg, indem sie durch eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung dem Metall Ephat eine völlig neue Struktur geben konnten. Das war die Geburtsstunde von Epharith, dem mit Abstand leichtesten und dabei härtesten Material, das die Menschheit je gesehen hatte.
Mit ihm war es möglich, dem Transportfahrzeug ein geringes Eigengewicht zu geben und trotzdem zu garantieren, dass es den urgewaltigen Druckverhältnissen in über dreiundzwanzigtausend Metern Tiefe würde standhalten können.
Damit war eines der großen Probleme gelöst und es blieb nur noch die Sache mit der Geschwindigkeit.
Doch auch hier wurde die Gruppe um Jorik schnell fündig. Mit Hilfe des neuen Materials ließen sich Turbinen bauen, die trotz ihrer Größe sehr leicht waren. Einige weitere technische Innovationen sorgten letztlich dafür, dass es tatsächlich gelang, Turbinen herzustellen, die sogar Geschwindigkeiten weit über vierhundert Meilen in der Stunde unter der Wasseroberfläche zu erreichen in der Lage waren.
Damit schienen sie am Ziel angelangt und es hatte nicht viel gefehlt und sie hätten den Gang an die Öffentlichkeit getan.
Doch Jorik bremste das Team noch einmal ab.
Die Meere erreichten nicht selten eine Ausdehnung von über sechstausend Meilen von Küste zu Küste.
Selbst bei einer Geschwindigkeit von fünfhundert Meilen in der Stunde würde man unter Wasser mindestens sechs Stunden brauchen um im ungünstigsten Falle an eine Stelle mitten zwischen zwei Küstenstreifen zu gelangen.
Da muss es noch eine bessere Lösung geben, hatte er gesagt und ab ging es zurück an die Zeichentische.
Einer seiner jüngsten Mitarbeiter machte dann eine frustrierte Bemerkung, als klar war, dass sich zwar über vierhundert Meilen in der Stunde unter Wasser, nicht aber fünfhundert oder sogar deutlich mehr Geschwindigkeit erreichen lassen würde, indem er fragte, warum man nicht einfach ein Flugzeug nehme und es als Unterwasserfahrzeug umbaute.
Da machte es plötzlich Klick bei Jorik und die ersten Entwürfe für ein Flugboot waren geboren.
Und die Idee allein setzte bei der Gruppe neue Energien frei.
Ein Flugzeug mit einer neuartigen Konstruktion aus Epharit, mit dem sich in der Luft bequem zwölfhundert Meilen in der Stunde erreichen ließ, dass letztlich aber auch die Möglichkeit besaß, unter Wasser mit bis zu fünfhundert Meilen in der Stunde auf unter dreiundzwanzigtausend Metern Wassertiefe voran zu kommen.
Ein fantastischer Gedanke, der nur an zwei winzigen Kleinigkeiten zu scheitern drohte:
Zum Einen mussten Triebwerke entwickelt werden, die sowohl in der Luft, als auch im Wasser für genügend Vortrieb sorgen würden.
Zum anderen musste eine Möglichkeit geschaffen werden, dass das Flugboot, zwar bei geringer Geschwindigkeit, so doch aber bei rund einhundert Meilen in der Stunde so ins Wasser eintauchen konnte, dass es nicht sofort erbärmlich zerfetzt wurde und vor allem seine Insassen das Eintauchen überleben konnten.
Denn die Dichte von Wasser war wesentlich höher als die der Luft und somit ein abrupter Geschwindigkeitsabfall unumgänglich, der nicht nur die Grenzen des Materials ausreizen würden, sondern auch die Gesundheit der Besatzung.
Doch Jorik und seine Männer gaben nicht auf. Und es zeigte sich schnell, dass sie mit Epharith einen wahrhaft genialen Werkstoff erfunden hatten, der dem Aufprall auf die Wasseroberfläche problemlos standhalten würde.
Auch das Problem mit den Turbinen ließ sich dank Joriks Einfällen bald lösen und sie konnten ein Treibwerk entwickeln, dass in der Luft gewöhnlichen Brennstoff benötigte, unter Wasser aber in der Lage war, lediglich Wasser derart druckvoll anzusaugen, um durch den anschließenden Ausstoß genügend Vortrieb zu entwickeln.
Blieb letztlich nur noch eine Sache: Die Gesundheit der Besatzung beim Aufschlag auf die Wasseroberfläche.
Aber es war völlig egal, aus welchen Richtungen sie dieses Problem auch angingen, sie hatten niemals auch nur den Hauch eines Erfolges. Die Kraft, die auf sie wirken würde, selbst wenn sie nur mit sechzig Meilen in der Stunde und mit dem kleinstmöglichen Winkel versuchen würden, in das Meer einzutauchen, würde einen derartigen Rückschlag erzeugen, das sie sich alle Knochen brechen und sämtliche inneren Organe zerfetzt würden.
Nein, so würde das niemals funktionieren. Wenn es ihnen nicht gelänge, den Aufprall völlig zu verhindern oder doch merklich abzumildern, dann würde das Prinzip des Flugbootes scheitern.
Doch wie verhinderte man diesen Aufprall?
Ganz einfach, fiel es Jorik wie Schuppen aus den Augen. Indem man einen Puffer zwischen Flugboot und Wasseroberfläche setzte, der den direkten Kontakt verhinderte und die gewaltigen Energien, die dabei entstanden, auffing.
Dies war die Geburtsstunde der Schallinduktion. Kurz vor dem Auftreffen auf die Wasseroberfläche erzeugten entsprechende Maschinen rund um das Flugboot eine räumlich begrenzte Schallwelle, die sich wie eine Blase um das Boot schloss.
Diese Schallwelle war so stark, dass sie in der Lage war, die Wassermenge, die das eigentliche Boot verdrängte, schon einige Meter vor dem Bootsrumpf zu verdrängen. Dabei verformte sie sich sehr stark, verhinderte aber den direkten Kontakt zwischen Boot und Wasser.
Das Flugboot konnte also in dieser Blase ungehindert in das Wasser eintreten, ohne die Gesundheit der Besatzung zu gefährden.
Eine permanente Reise in dieser Blase unter Wasser war jedoch nicht möglich, da die Turbinen so nach kurzer Zeit keine Grundlage mehr besaßen, um zu funktionieren, da sich letztlich ein Vakuum in der Blase bildete.
Aber dies war auch nicht nötig, denn man konnte die Intensität der Schallwelle nach und nach so sanft verringern, dass die Besatzung den Übergang auf den direkten Kontakt zwischen Boot und Wasser zumindest körperlich kaum wahrnahm.
Und damit waren Jorik und seine Männer tatsächlich nach fast vier Zyklen am Ziel ihres Weges angelangt.
Als sie den Konzernführern von ihren Entwicklungen erzählten, konnten diese kaum glauben, was sie hörten. Alle ihre Vorgaben wurden bei weitem übertroffen.
Das Flugboot war in der Lage tausendzweihundert Meilen in der Stunde zu fliegen und dabei eine Nutzlast von zwanzig Tonnen zu befördern. Es erreichte somit auch den weitesten denkbaren Punkt auf den Ozeanen in zweieinhalb Stunden und konnte dann dort unmittelbar in das Meer eintauchen, um mit einer Geschwindigkeit von fast fünfhundert Meilen in der Stunde auch die tiefsten Stellen im galpagischen Meer zu erreichen.
Imrix war hochzufrieden und gab natürlich grünes Licht für die praktischen Tests.
Und diese liefen von Beginn an absolut fantastisch. Alles, was in der Theorie erdacht wurde, konnte beinahe eins zu eins in die Praxis umgesetzt werden, alle vorangegangenen Tests verliefen ohne wirkliche Probleme oder Zwischenfälle, sodass die Kitaja nur einen Zyklus nach dem ersten Test fertiggestellt werden konnte und sich jetzt im letzten und entscheidenden Teil ihres Testflugs befand.