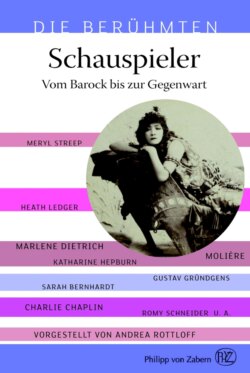Читать книгу Schauspieler - Andrea Rottloff - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Allroundkünstler
David Garrick
Name: David Garrick
Lebensdaten: 19. Februar 1717 in Hereford – 20. Januar 1779 in London
Tätigkeiten: Schauspieler, Theatermanager, Dramatiker, Produzent
Besonderheit: reformierte das englische Theater von Grund auf
Kaum ein Mann seit Shakespeare hat das englische Theater in so vielen Aspekten grundlegend verändert wie David Garrick. Ob es nun der Schauspielstil war, die Bühnendekoration, Kostüme, Spezialeffekte, Beleuchtung oder aber der Probenbetrieb, die Besetzung und Auswahl der zu spielenden Stücke – in allen Sparten setzte Garrick sich von seinen Vorgängern ab.
Wer war das?
David Garrick wurde als eines von fünf Kindern eines Offiziers französischer Abstammung 1717 in Hereford geboren. Seine Vorfahren waren protestantische Hugenotten aus Bordeaux und Weinhändler, die vor den konfessionellen Repressionen in Frankreich auf abenteuerlichen und gefährlichen Wegen nach England geflohen waren. Der so zweisprachig aufgewachsene Garrick pflegte auch später immer gute Kontakte nach Frankreich – selbst in einer Zeit um die Mitte des 18. Jhs., als französische Bekanntschaften in der englischen Gesellschaft nicht mehr gern gesehen waren und Anlass zu gewaltsamen Tumulten gaben. Schon als kleiner Junge machte Garrick durch sein Talent, Leute zu unterhalten, auf sich aufmerksam und konnte so auch die Familienkasse aufbessern, wenn ihn wohlwollende Gönner unter ihre Fittiche nahmen. Er erhielt an der örtlichen Grammar School eine fundierte klassische Bildung, die ihm später am Theater gut zupasskommen sollte. Nach dem Wunsch seiner Eltern sollte er eigentlich Anwalt werden, war aber von Kindheit an theaterbegeistert und spielte in zahlreichen Schul- und Laienaufführungen. Eine kleine Erbschaft ermöglichte ihm, diesen Weg weiter zu verfolgen, nachdem er einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend in Armut verbracht hatte.
Er heiratete, nach verschiedenen unglücklich verlaufenen Affären, erst spät eine aus Wien stammende Tänzerin namens Eva-Maria, mit der er sich zu Beginn ihrer Beziehung auf Französisch unterhalten musste, denn sie konnte kein Englisch. Die beiden blieben kinderlos, waren einander aber bis zum Tod Garricks treu verbunden – schon damals eine Seltenheit in der Theaterwelt. Seine Frau überlebte ihn um über vier Jahrzehnte und erreichte ein Alter von fast 100 Jahren.
Letzte Chance: Die Bühne
Ständig musste Garrick sich um seine Zukunft sorgen, denn selbst als erwachsener Mann hatte er kein regelmäßiges Einkommen, das ihn bis ins Alter versorgt hätte. Frühe Berufswünsche wie Soldat (Offizierspatente mussten damals für viel Geld erworben werden), Pastor oder Jurist scheiterten am Geldmangel und ein Rückbesinnen auf den großväterlichen Weinhandel führte auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Das lag allerdings daran, dass David, der die Londoner Dependance aufbauen sollte, während sein Bruder am Heimatort Lichfield tätig war, mehr Zeit in den Theatern verbrachte als mit seinen beruflichen Verpflichtungen. Schließlich waren seine aus einer Erbschaft stammenden bescheidenen Mittel fast erschöpft und er entschloss sich – noch ohne Wissen seiner Familie – hauptberuflich auf die Bühne zu wechseln. Das war in verschiedener Hinsicht ungewöhnlich: Zum einen waren die Garricks trotz ihrer Armut stolz darauf, einer „besseren“ Schicht anzugehören, die David mit einem Bühnendebüt aufgegeben hätte. Zum anderen hatte er nie das Bühnenhandwerk richtig erlernt wie seine Kollegen, die alle als Lehrlinge und Laufburschen angefangen und sich über Jahre mit kleinen Nebenrollen nach oben gespielt hatten. Garrick aber trat als erwachsener Mann auf die Bühne, spielte Shakespeares Richard III. und war als „fertiger Schauspieler“ einfach da. Das Londoner Publikum konnte nicht glauben, was es sah und dieses mörderische Debüt wurde zu einem phänomenalen Erfolg. Das konnte nur gelingen, weil Garrick ein angeborenes Talent für die Bühne besaß! Sofort wurden Theaterbetreiber auf ihn aufmerksam und engagierten ihn – trotz seiner geringen Körpergröße von etwa 1,62 m, die viele für nicht ausreichend für einen Bühnenschauspieler gehalten hatten.
Was hat ihn berühmt gemacht?
Garrick war in allen Rollenfächern erfolgreich, von Shakespeare-Tragödien über Komödien bis hin zu den überaus beliebten Stücken, in denen er „in drag“ auftrat, also als Frau verkleidet. Er reformierte den Schauspielstil, weg vom deklamatorischen „Bombast“ des Barock hin zu einer „realistischeren“ Spielweise. Nun darf man sich darunter nicht „Realismus“ im heutigen Sinne vorstellen, denn Garrick übertrieb maßlos mit Gesten und Bewegungen. Sein Stil würde heute als „over-acting“ gelten, war aber damals eine unerhörte Revolution. Zudem legte er Wert auf ordentliche Probenarbeit und Vorbereitung, denn viele seiner Zeitgenossen hätten ohne Souffleur ihre Auftritte nicht überstanden. Garrick aber war berüchtigt dafür, seine Schauspieler mit endlosen Proben zu peinigen – so lange, bis alles „saß“. Aber nicht nur von den Schauspielern, auch vom Publikum verlangte er Disziplin, was allerdings einige handgreifliche Krawalle in seinem Theater nicht immer verhindern konnte. Immerhin gelang es ihm, das ständige Kommen und Gehen während der Vorstellung abzustellen, indem er am Gebäudeeingang liegende Kassenhäuschen einrichtete.
Bereits sein erstes Engagement führte ihn an das Theater, das er später fast 30 Jahre lang leiten sollte: das Drury Lane in London. Wie schon zu Shakespeares Zeiten funktionierten Theater im 18. Jh. über Teilhaberschaften, das heißt, dass Schauspieler oder Manager einen prozentualen Anteil am Haus und meist auch den Einnahmen erwarben. Mitte des 18. Jhs. geriet das Drury Lane jedoch aufgrund mehrerer Erbschaften und Spekulationen an Nicht-Theaterleute und das veranlasste Garrick zusammen mit einem Teilhaber dazu, das Haus zurückzukaufen und es seitdem allein nach seinen Vorstellungen zu leiten – der Teilhaber hatte sich verpflichten müssen, keinen Einfluss zu nehmen. Drury Lane wurde so zu einem der bedeutendsten Theater in Europa.
Nicht überall, wo Shakespeare draufsteht, ist auch Shakespeare drin
Nach der langen Pause durch die Theaterschließungen der puritanischen Zeit (17. Jh.) waren selbst die Stücke William Shakespeares in Vergessenheit geraten – oder zumindest weitgehend, nur ihr legendärer Ruf hatte sich gehalten. Schon bald nachdem die Theater Mitte des 17. Jhs. wieder geöffnet waren, machten sich Autoren daran, die Werke Shakespeares umzuarbeiten und dem neuen Zeitgeschmack anzupassen – „langweilige“ Szenen wurden gekürzt, „anzügliche“ Themen zensiert, der Text „verbessert“ und tragische Stücke mit Happy End versehen. Wenn also im 18. Jh. jemand ein Shakespeare-Stück sah, hatte das nicht mehr viel mit dem Original zu tun.
Auch David Garrick schreckte nicht davor zurück, den Barden von Stratford bei Bedarf umzuschreiben, doch als fanatischer Büchersammler war er einer der wenigen, der die Originalstücke aus den Folio-Editionen überhaupt noch kannte. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er, wo immer es möglich war, auf den Originaltext zurückgriff – selbst wenn er uns heute etwa im Hamlet so unverzichtbare Szenen wie die Ansprache an die Schauspieler oder die Friedhofsszene herausschnitt. Auch die Enden veränderte er und verschaffte so König Lear gar ein Happy End. Das Duell am Schluss von Hamlet bezeichnete er als „rubbish“ (Müll, Blödsinn), stattdessen griff in seiner Version Hamlet plötzlich Claudius an und wurde von Laertes niedergestochen, während die Königin hinter der Bühne starb. Laertes regierte von da an mit Horatio zusammen Dänemark.
Das große Jubiläum
1769 organisierte Garrick ein großes Shakespeare-Jubiläum im Geburtsort des Barden – sicherlich das anspruchsvollste Projekt seiner Karriere. Leider waren die Planungen jedoch etwas zu größenwahnsinnig geraten und die Vorbereitungen verzögerten sich um einen Monat bis in den September hinein – in eine Zeit, als bereits der regnerische englische Herbst begann und einen Großteil der Festivitäten im Schlamm versinken ließ. Garrick stand den Feierlichkeiten als Steward (in etwa Hofmarschall) vor und erhielt von den Veranstaltern in Stratford eine Gedenkmedaille und einen als Zauberstab interpretierten Heroldsstab. Das aber war zu viel für die skeptische lokale Bevölkerung, Shakespeare hin oder her: Sie vermuteten nun, dass Garrick mit den dunklen Mächten im Bunde stehen könne und Hexenkünste zur Umsetzung seiner gigantischen Pläne zu Hilfe nahm. Dass zudem auf einmal hunderte von seltsam kostümierten Figuren den Ort bevölkerten, ließen diesen Verdacht fast bis zur Gewissheit wachsen.
Trotz seiner „Verbesserungsversuche“ an Shakespeares Werken galt Garrick bereits bei seinen Zeitgenossen nur als mittelmäßiger Autor. Zwar wurden einige seiner Stücke aufgeführt, doch lag sein Talent eindeutig im Spiel und nicht im Schreiben. Er muss das erkannt haben, denn er förderte uneigennützig andere Autoren, darunter auch die englische Dramatikerin Hannah More. Am wichtigsten war jedoch, dass es ihm gelang, die von je her verrufene Stellung der Schauspieler zu verbessern. Durch seine Arbeit wurde „Schauspielen“ zu einer respektablen Tätigkeit und er selbst verkehrte in den höchsten Kreisen, was nicht nur an seinem inzwischen erworbenen immensen Vermögen lag. Dadurch war er auch in der Lage, seinen jüngeren Bruder George zu unterstützen, der „Mädchen für alles“ am Theater wurde. Berühmt ist dessen Satz „Hat David mich gebraucht?“, mit dem er von jeder auch noch so kurzen Abwesenheit zurückkam. Als George nur 48 Stunden nach seinem Bruder starb, sagte man dementsprechend „David hat ihn gebraucht“. Nach seinem Tod wurde David Garrick die hohe Ehre eines Begräbnisses in der „Poet’s Corner“ der Westminster Abbey zuteil – nach ihm wurde erst wieder 1905 Henry Irving und 1989 Laurence Olivier diese Ehre zugestanden.
Über 200-mal wurde Garrick von den besten Künstlern seiner Zeit porträtiert – und gelegentlich erlaubte er sich mit den Malern üble Scherze: Er verharrte so lange in einer Position, bis die Künstler diese zu ihrer Zufriedenheit festgehalten zu haben glaubten. Dann veränderte er ebendiese Pose im Detail, ohne es zu erkennen zu geben, und der jeweilige Maler verzweifelte ob seiner scheinbar ungenügenden Fähigkeiten.
David Garrick ist einer der ersten Schauspieler, über dessen Wirken umfangreiche schriftliche Dokumentationen erhalten sind, sei es handschriftlich oder gedruckt – man bedenke im Gegensatz dazu die Zeit Shakespeares, aus der vergleichsweise wenig erhalten ist. Abgesehen von seinen eigenen Tagebüchern und Notizen, gibt es erste professionelle Kritiken und Zeitungsartikel sowie Berichte aus dem Publikum, die entweder von seinen Freunden und Gönnern, oder aber von ausländischen Reisenden verfasst wurden. Einer von ihnen war der deutsche Schriftsteller und Mathematiker Georg Christoph Lichtenberg, der während seines Englandaufenthalts 1774/75 mehrere Aufführungen mit Garrick besuchte und seine Eindrücke in seinem Reisetagebuch festhielt. So können wir ziemlich genau sagen, wie Garrick etwa den Hamlet spielte – und dass Lichtenberg dessen veränderte Version des Stückes sah. Besonders beeindruckten ihn die Szenen mit dem Geist von Hamlets Vater, die sich als Beispiel der „Gespenstergeschichten“, im 18. und frühen 19. Jh. großer Beliebtheit erfreuten.
Was bleibt?
Am Beispiel von David Garrick lassen sich die Möglichkeiten aufzeigen, die jemand besitzt, der „für die Bühne geboren“ ist. Alles Studieren und Trainieren hilft nichts, wenn das entscheidende Fünkchen fehlt, das „Erhabene“ („the sublime“) in einer Darstellung. Dieses „Erhabene“ war ein Punkt heftiger Diskussionen im 18. Jh. und alle waren einhellig der Meinung, dass Garrick „es hatte“, während es einigen seiner Vorgänger oder Zeitgenossen wie Thomas Betterton oder James Quin abging. Nur so konnte Garricks Ruhm sich bis auf den heutigen Tag halten.