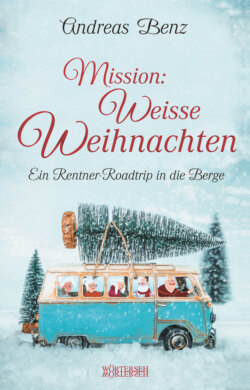Читать книгу Mission: Weisse Weihnachten - Andreas Benz - Страница 14
7
ОглавлениеDer Speisesaal des Altersheims füllte sich langsam mit mehr oder weniger hungrigen Seniorinnen und Senioren. Der grosse Saal war in zwei ganz unterschiedliche Bereiche unterteilt. In dem einen Teil waren die Wände mit dunklem Holz getäfert, und die rund vier Meter hohe Decke wurde von Balken aus demselben Holz getragen. Auch die Leuchter, an denen aus Spargründen nur die Hälfte der Glühbirnen brannten, waren aus dunklem Holz mit Verzierungen aus Schmiedeeisen. Die andere Hälfte des Saals hatte weisse Wände und an der Decke aufwendige Stuckaturen. Hier gab es grosse Fenster, die bis auf den Boden reichten und früher wohl in einen gepflegten Park führten. Ohne Frage, dieser Raum hatte vor einigen Dekaden sicher tolle Feste und Empfänge gesehen, doch heute wirkte alles etwas schmuddelig. Wollte man nett sein, konnte es auch als starke Patina bezeichnet werden.
Der hölzerne Teil diente zu Fabrikantenzeiten wohl als Herrenzimmer oder vielleicht auch als Bibliothek. Wahrscheinlich gab es eine Verbindungstür zum grossen und hellen Wohnraum. Doch als die Villa zum Altersheim umfunktioniert wurde, hatte man die Zwischenwand kurzerhand herausgebrochen, um einen grossen Speisesaal zu bekommen. Es war offensichtlich, dass es den am Umbau Beteiligten egal war, wie hässlich nun alles aussah. Wahrscheinlich war man der Meinung, die Alten würden eh nicht mehr gut sehen und könnten sowieso froh sein, an einem solch schönen Ort wohnen zu dürfen. Obwohl der weisse Teil des Raums der edlere war, waren die Plätze dort nicht sehr begehrt. Das lag weniger am Ambiente als vielmehr an der Tatsache, dass die grossen Fenster schon lange nicht mehr dicht waren und es ständig zog. Und Durchzug, das wusste jeder, der im »Abendrot« wohnte, war pures Gift.
Das Personal war fast fertig mit dem Eindecken der grossen Tische. Natürlich hatten jede Seniorin und jeder Senior ihren Stammplatz – da gab es nichts zu rütteln. Und wie in fast allen Einrichtungen dieser Art wurde auch im »Abendrot« schon um halb sechs das Abendessen serviert. Das wäre besser für die Verdauung, hiess es, doch der wahre Grund war wohl eher, dass das Personal möglichst früh nach Hause wollte. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden nun in Rollstühlen an ihre Tische geschoben, andere benutzten Gehhilfen. Dazwischen einige noch rüstige Alte, die sich schon mal setzten und sich die Serviette umbanden.
Hans, der selbstverständlich auch grössten Wert auf Pünktlichkeit legte, gehörte meist zu den Ersten, die den Speisesaal betraten. Wie immer setzte er sich auch heute auf seinen Platz an den Tisch mit der Nummer elf, der ebenfalls wie immer für fünf Personen gedeckt war. Und wie immer griff sich Hans den Wasserkrug, in dem die verdauungsfreundlichen Feigenschnitze schwammen, und goss alle fünf Gläser voll. Jetzt kam Luky herein, der Paul in seinem Rollstuhl an dessen Tisch schob, ihm einen guten Appetit wünschte und sich dann zu Hans auf seinen Platz setzte.
»Mitten am Nachmittag Abendessen. Ich halte das nicht aus«, sagte Luky, der sich noch immer nicht an die vorgeschriebenen Essenszeiten gewöhnt hatte. Um diese Zeit hatte er normalerweise noch gearbeitet oder höchstens sein erstes Feierabendbier getrunken.
»Alles in Ordnung?«, wollte Hans wissen.
Luky nickte nur, nahm ein Stück Brot und tröpfelte Maggi-Würze darauf. Hans schaute, wie die braunen Tropfen im trockenen Brot versickerten.
»Zu viel Salz ist schlecht für deinen Blutdruck«, meinte er.
Luky biss ins Brot, kaute und sagte mit vollem Mund: »Der Blutdruck ist gerade mein kleinstes Problem, lieber Hans.«
Hinter ihnen hörten sie jemanden laut fluchen und dann ein gekrächztes »Jetzt geh mal aus dem Weg, du alte Krähe!«. Zweifellos: Frida war im Anmarsch. Schwer atmend und hustend bahnte sie sich ihren Weg und liess sich dann auf ihren Stuhl fallen. Sie hatte gerötete Augen und schniefte laut. Hans schaute sie besorgt an.
»Frida, was ist denn los?«
Eine Angestellte kam an ihrem Tisch vorbei.
Frida stoppte sie mit einem charmanten »Hierher!«, zeigte dann auf eines der fünf Gedecke und meinte: »Räumen Sie das ab, Frau Gerber kommt heute nicht.«
Hans warf Luky einen beunruhigten Blick zu, und im selben Moment erklang der übliche Gong als offizielles Zeichen für den Beginn des Abendessens. Als wäre der Gong auch ihr Zeichen, erschien Inge von Hellbach oben auf der Treppe, die von der noblen, weissen Seite des Hauses in den Speisesaal hinunterführte. Niemand wusste, wie alt Inge war, geschweige denn, woher sie kam und warum sie hier im Altersheim lebte. In einem viel zu eleganten Kleid schwebte die grosse, schlanke Frau die Stufen hinunter, als ginge sie über eine Broadway-Showtreppe. Doch auf den zweiten Blick wurde klar: Das Kleid stammte aus einer lange vergangenen, erfolgreicheren Epoche ihres Lebens. Ihr Auftritt wirkte absolut grotesk in dem schäbigen Ambiente des Altersheims. Doch wie jeden Abend drehten die meisten Heimbewohner ihre Köpfe in Inges Richtung und schauten gebannt ihrem Auftritt zu. Die Seniorin hatte ihr Publikum und schien jede Sekunde zu geniessen.
Wie aus dem Nichts erschien dann unten an der Treppe die Kunz und wedelte etwas Luft von Inge her in ihre Richtung.
»Rieche ich da etwa Alkohol!?«, fragte sie eine Spur zu laut.
»Auf keinen Fall«, erwiderte Inge in perfektem Bühnendeutsch und wischte sich eine Strähne ihrer langen, blonden Haare aus dem Gesicht. Ob es ihre echten Haare oder eine Perücke war, wusste niemand. »Das ist mein Parfüm – auf dem Flakon steht fünfundachtzig Prozent Alkohol, wenn Sie das meinen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, schwebte sie in Richtung Tisch Nummer elf davon. Luky sprang auf und stellte galant den alten Holzstuhl für sie bereit. Inge setzte sich und liess ihren Blick durch den Speisesaal schweifen, als suchte sie den Sommelier. Mit einem Seitenblick versicherte sie sich, dass die Kunz verschwunden war, zog einen Flachmann aus ihrem üppigen Dekolleté, schraubte den silbernen Deckel ab und gönnte sich einen grossen Schluck. Auch Inge bemerkte, dass es Frida nicht gut ging.
»Wie siehst du denn aus?«, fragte sie.
»Ja!«, insistierte Hans, »sag endlich, was ist mit Maria?«
Inge, Hans und Luky blickten besorgt auf Frida, die einen weiteren Hustenanfall nur dadurch unterdrücken konnte, dass sie den Hahn der Sauerstoffflasche etwas mehr aufdrehte. Langsam griff sie dann nach dem vor ihr stehenden Wasserglas und hob es hoch.
»Auf Maria!« Und mit einem Blick durch den Speisesaal fuhr sie fort: »Die Glückliche hat das hier alles bald hinter sich.«
Inge sah Frida erschrocken an und musste gleich einen weiteren Schluck des hochprozentigen Notvorrats zu sich nehmen. Frida drehte den Sauerstoffhahn noch etwas mehr auf.
»Ja, letale Diagnose, noch ein paar Wochen, und dann kann sie die Harfe fassen.«
Betretenes Schweigen machte sich am Tisch breit. Niemand wollte oder konnte etwas sagen. Obwohl eine solche Nachricht in einem Altersheim ja grundsätzlich nichts Ungewöhnliches ist, war es für Luky, Hans und Inge ein grosser Schock. Ausgerechnet die gutmütige Maria, die immer allen alles recht machen wollte und sich selber immer hintanstellte. Frida nahm einen Schluck Feigenwasser und verzog angeekelt das Gesicht. Inge kontrollierte kurz, ob die Luft rein war, und gab je einen grosszügigen Schuss Alkohol in die Gläser ihrer Freunde, die dann dankbar etwas von dem jetzt einigermassen trinkbaren Feigenwasser tranken.
»Da krampfst du dein ganzes Leben lang, und zum Schluss hockst du allein in dieser ›Altersresidenz‹, säufst Feigenwasser und pisst in die Windeln«, schloss Frida und leerte ihr Glas auf ex.
Eine Angestellte kam an ihren Tisch und stellte eine Schüssel mit Essen hin. Hans hob den Deckel, schaute hinein und verzog das Gesicht.
»Aber nicht schon wieder diese verkochten Mehlkartoffeln.«
Die Angestellte zuckte mit der Schulter und antwortete gleichgültig: »Sie müssen sie ja nicht essen, essen ist hier freiwillig.«
Hans schaute von der Schüssel mit der gelben Pampe hoch und brummte: »Ja, das ist aber auch das Einzige, was hier freiwillig ist.«
Inge kümmerte sich nicht um ihn und fragte Frida: »Und die Ärzte können nichts machen?«
Frida schüttelte den Kopf.
»Nein, die nicht, aber wir können was machen.«
Luky schaute sie zweifelnd an.
»Aber …«, begann er.
»Nichts aber«, fuhr ihm Frida über den Mund. »Maria ist zweifellos der beste Mensch, den ich je getroffen habe, noch zu bescheiden, ihren letzten Wunsch jemandem deutlich mitzuteilen.«
Inge schaute Frida erstaunt an.
»Ja was denn nun? Sie hat einen letzten Wunsch geäussert? Oder doch nicht? Wie meinst du das?«
»Nicht so klar halt, ihr kennt sie ja … Aber ich weiss, sie träumt davon, noch einmal Weihnachten in den Bergen zu feiern, da war sie immer am glücklichsten«, sagte Frida.
Luky schöpfte sich ein paar der dampfenden, klebrigen Kartoffeln auf seinen Teller und leerte einen grossen Löffel braune Sauce darüber, die er mit ein paar Spritzern Maggi nachwürzte.
»Aber sie kann doch in ihrem Zustand nicht allein in die Berge fahren«, meinte er kopfschüttelnd.
»Genau«, nickte Frida und schaute einen nach dem anderen eindringlich an.
Hans versuchte verzweifelt, das Stück Fleisch in seinem Teller zu zerschneiden. Entweder war das Messer total stumpf oder das Fleisch unendlich zäh. Dann spürte er Fridas stechenden Blick.
»Was schaust du uns an?«, wollte er wissen. »Du meinst doch nicht etwa, wir sollten …?«
»Wer denn sonst?! Sie hat ja ausser uns niemanden«, antwortete Frida, zog den Sauerstoffschlauch aus ihrer Nase und begann zu essen.
Inge rückte nachdenklich die Manschetten ihrer alten Seidenbluse zurecht.
»Letzte Wünsche sind heilig«, meinte sie, »ich hoffe, ich kann mit meinem letzten Wunsch auch mal auf euch zählen.« Sie griff nach ihrem Flachmann und nahm einen weiteren Schluck. »Aber jetzt brauchen wir erst mal einen Plan, wie Maria ihre letzte Weihnacht tatsächlich in den Bergen feiern kann.« Inge schaute nun Hans an, der lustlos in seinen Kartoffeln stocherte. »Mein lieber Hans«, fuhr sie fort, »und wenn einer von uns in der Lage ist, für so was einen Plan zu machen, dann du. Schliesslich musstest du doch früher auch Schülerreisen organisieren, oder?«
Alle blickten auf Hans, der etwas verlegen wurde.
Frida schluckte einen Bissen hinunter und relativierte: »Ja, aber das war hundert Jahre vor der missglückten zweiten Karriere als Krimiautor. Nicht wahr, Sherlock Holmes?«
Hans warf ihr einen bösen Blick zu und erwiderte: »Ja, planen kann ich gut.«
Doch Frida konnte es nicht lassen und stichelte weiter: »Darum sitzt du jetzt auch hier in diesem Loch.«
Hans ignorierte sie und schaute Inge fragend an.
»Dann mach dich mal an die Arbeit«, sagte sie und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.
Doch Hans verstand nicht ganz, was sie damit meinte.
»Aber wie stellst du dir das vor?«, fragte er. »Maria liegt im Sterben. Für Frida wäre die dünne Bergluft wahrscheinlich tödlich, und für Luky brauchen wir einen Schlafwagen.«
»Und für dich ein Toitoi auf Rädern«, gab Luky schlagfertig zurück.
»Nur Inge ist noch einigermassen fit …«, redete Hans weiter und stand mit schmerzverzerrtem Gesicht von seinem Stuhl auf. »Entschuldigt, ich muss mal dringend«, presste er hervor und ging, so schnell er konnte, in Richtung Toilette.
»… wenn sie nüchtern ist«, beendete Frida nachdenklich den von Hans begonnenen Satz und bemerkte, dass Luky in der Zwischenzeit auf seinem Stuhl eingenickt war.