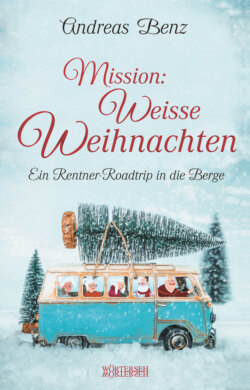Читать книгу Mission: Weisse Weihnachten - Andreas Benz - Страница 16
9
ОглавлениеEs war fünf nach acht, alle Bewohner des Altersheims warteten schon geschlagene fünf Minuten auf die allmorgendliche Ansprache von Daniela Kunz im Speisesaal. Das war für die Heimleiterin – da waren sich alle einig – sicher der schönste Moment in ihrem Arbeitstag. Da konnte sie ihre ganze Macht demonstrieren und wie ein Feldweibel Kommandos geben. Alle sassen an ihrem Tisch, jeder auf seinem Platz. Nur zwei Stühle waren nicht besetzt, was die Kunz zum Warten zwang. Sie zeigte ihre Ungeduld, indem sie nervös mit den Fingern auf ihr Klemmbrett trommelte.
Da kamen Frida und Maria, die ihren einen Arm bei Frida eingehängt hatte, endlich gemeinsam den Flur hinunter. Frida zog mit der anderen Hand ihren Wagen mit dem Sauerstoff hinter sich her, die Zufuhr hatte sie vorsorglich auf volle Leistung gestellt.
Maria war das Zuspätkommen extrem peinlich, und sie flüsterte Frida zu: »Wissen es schon alle?«
Frida nickte. Sie erreichten den Speisesaal, und alle Köpfe drehten sich wie auf Kommando in ihre Richtung. Dann begann an den meisten Tischen ein Getuschel.
Daniela Kunz schaute genervt zu den beiden und blaffte: »Wir warten!«
Maria und Frida erreichten ihren Tisch und setzten sich. Inge, Hans und Luky waren sichtlich froh, Maria zu sehen, und lächelten ihr zu.
Die Kunz räusperte sich, bevor sie endlich mit ihrer Ansprache beginnen konnte.
»Nachdem wir jetzt doch noch vollzählig sind, kommen wir zum Tagesprogramm: Heute Nachmittag ist es wieder so weit. Der grosse Familienbesuchstag mit unserem selbst gemachten Weihnachtsgebäck und dem – alkoholfreien – Glühwein startet pünktlich um vierzehn Uhr. Wir sind sicher, dass auch dieses Jahr wieder ganz viel Besuch kommen wird.«
Frida schüttelte angewidert den Kopf und steckte sich den Zeigfinger in ihren offenen Mund, zum Zeichen, was sie von dem Geschwafel hielt.
»Doch leider«, fuhr die Heimleiterin fort, »gibt es heute Mittag kein Dessert, weil gestern Nacht wieder jemand hier im Haus geraucht hat.«
Alle Augen richteten sich auf Luky, und ein Murren ging durch den Saal. Auch Daniela Kunz schaute Luky an, und ihr Blick verriet, dass ab sofort Krieg zwischen ihnen herrschen würde. Luky schnappte sich mit der einen Hand wütend die Kaffeekanne und schenkte sich ein, während er die andere unter dem Tisch mit ausgestrecktem Mittelfinger der Heimleiterin entgegenstreckte. Dass sie sich in ihrem Alter solche Kollektivstrafen gefallen lassen mussten, ging nicht in seinen Kopf.
Ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren, wünschte die Kunz allen einen guten Appetit und einen schönen Nachmittag mit den Familien. Doch beim Hinausgehen konnte sie es nicht lassen, am Tisch elf vorbeizugehen und demonstrativ ihren Kopf zu schütteln. Die fünf Alten ignorierten den Hausdrachen einfach und wandten sich Maria zu.
»Schön, dich zu sehen, wie geht es dir?«, fragte Inge und schaute sie besorgt an.
»Ja … es geht schon … danke«, antwortete Maria mit leiser Stimme.
Hans legte seine Hand auf ihren Arm.
»Können wir etwas für dich tun? Irgendetwas? Hast du denn Schmerzen?«
»Nein, nicht gross, danke. Doktor Steiner hat mir alles gegeben, was ich brauche.«
Luky strich Butter auf sein Brötchen.
»Willst du nicht eine zweite Meinung einholen?«, fragte er Maria.
»Wenns zu Ende geht, brauchst du keine Zweitmeinung mehr«, antwortete sie.
Bis zum Schluss des Frühstücks wurde an ihrem Tisch nicht mehr viel gesprochen. Niemand fand die richtigen Worte, und jeder musste mit der neuen Situation erst selber fertigwerden.
Nach dem deprimierenden Frühstück begleitete Frida Maria wieder zurück auf ihr Zimmer. Das Frühstück hatte Maria müde gemacht, und sie wollte möglichst schnell wieder allein sein.
Inge ging währenddessen schnurstracks ins Büro der Heimleitung. Nachdem sie die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte, wollte sie nochmals versuchen, Daniela Kunz die Idee auszureden, jemanden in ihrem Zimmer einzuquartieren. Doch die Kunz gab ihr unmissverständlich zu verstehen, dass der Entscheid gefällt sei und sie gefälligst mit dem Umräumen ihres Zimmers beginnen solle – sonst würde sie Herrn Huber, den Hauswart und Busfahrer des Heims, damit beauftragen.
Hans und Luky hatten sich, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie Marias letzter Wunsch zu erfüllen war, im »Lese- und Medienraum« verabredet. Die Kunz nannte die dunkle Ecke hinter dem Speisesaal, in der ein paar ausgelesene Taschenbücher herumlagen, gern so. Den Zusatz »Medienraum« hatte sich das fensterlose Zimmer mit einem alten IBM-Computer verdient, der in jedem Museum einen Ehrenplatz bekommen hätte. Und doch erfreute sich dieser Raum bei den Alten grosser Beliebtheit.
Jetzt sassen Hans und Luky an dem alten Rechner und waren in ihre Recherche vertieft. Auf dem Bildschirm waren verschiedene Chalets zu sehen, die für die Weihnachtstage zu mieten waren. Doch die Preise waren absolut ausserirdisch. Hans machte sich Notizen in sein kleines, schwarzes Notizbuch, und Luky scrollte weiter durch die Seiten. Im letzten Moment bemerkte er, wie die Kunz um die Ecke kam, und schwenkte sofort den Bildschirm aus ihrem Blickfeld – das Biest hatte einen Instinkt wie ein Dobermann.
»Kein Schweinekram, sonst fliegt die Kiste raus!«, sagte Daniela Kunz und blieb stehen. Lukys Reaktion war ihr natürlich nicht verborgen geblieben.
Hans tippte nervös auf der Tastatur herum, doch Luky, der den Fehdehandschuh längst aufgenommen hatte, zeigte mit einem schmutzigen Lächeln auf den Bildschirm und meinte mit anerkennendem Blick: »Ja, da hats wirklich mächtig viel Holz vor der Hütte. Mein lieber Herr Gesangsverein.«
Die Kunz liess sich nicht provozieren und erwiderte kühl: »Ich lasse Sie keine Sekunde aus den Augen, Herr Landolt, ich habe Sie gewarnt. In einer Stunde beginnt der Besuchstag, dann erwarte ich Sie beide im Speisesaal. Keine Widerrede.«
Sie machte auf dem Absatz kehrt und rauschte davon.
Während die beiden Männer weiter nach einer Lösung suchten, wie sie mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln helfen konnten, Marias Wunsch zu erfüllen, begann sich der Parkplatz vor dem Altersheim langsam mit den Autos der Gäste zu füllen. Das ganze Jahr hindurch waren nie so viele Besucher da wie zum Adventsapéro, und selbst Seniorinnen und Senioren, die sonst das ganze Jahr kaum Besuch hatten, wurden an diesem Tag von Verwandten und Freunden nicht vergessen. Das schlechte Gewissen schien sich um die Weihnachtszeit etwas lauter zu melden als sonst. Man konnte ohne Übertreibung sagen: Wer an diesem Tag keinen Besuch bekam, der war wirklich allein.
Genauso wie Maria, Inge, Frida, Luky und Hans, die nun gemeinsam an ihrem Tisch im nicht sehr liebevoll dekorierten Speisesaal das Treiben beobachteten. Kinder rannten kreuz und quer umher. Geschenke wurden ausgepackt. Es wurde gegessen und getrunken, gelacht und geredet. Auf jedem Tisch standen Pappteller mit Weihnachtsgebäck und Becher mit alkoholfreiem Glühwein. Daniela Kunz ging mit aufgesetztem Lächeln durch den Saal, sagte überall Hallo und wechselte hie und da ein paar übertrieben freundliche Worte mit den Gästen. Und kam nun immer näher zu Tisch elf.
Maria stand auf.
»Ich gehe jetzt lieber in mein Zimmer.«
Allein ging sie an den anderen Tischen vorbei. Ihre Freunde sahen ihr selbst von hinten an, wie traurig es sie machte, all die glücklichen Familien zu sehen. Inge kippte jedem etwas Hochprozentiges aus ihrem Flachmann in den alkoholfreien Glühwein und nahm dann einen Schluck aus ihrem Becher. Frida rammte Hans, so nett sie das konnte, den Ellbogen in die Seite.
»Und?«, fragte sie.
Hans rutschte etwas verlegen auf dem Stuhl hin und her, bevor er antwortete: »Ich hoffe, du hast ihr keine falschen Hoffnungen gemacht …«
Luky hob seine Hand und sagte: »Ja, ich hab es mir nochmals überlegt, ich bleibe besser hier. Ich bin euch doch mit meiner Krankheit nur ein Klotz am Bein … und der Arzt meinte …«
Frida schlug mit der Faust so heftig auf den Tisch, dass der Glühwein vor ihr überschwappte.
»Hört auf!«, sagte sie etwas zu laut.
Von den Familientischen wanderten einige verwunderte Blicke in ihre Richtung.
Hans spielte verlegen mit einem Zimtstern, der vor ihm lag.
»Ohne regelmässige Physio für meine Hüfte komme ich am Morgen kaum aus dem Bett. Ganz zu schweigen von meiner Prostata. Es wäre schön gewesen, nochmals hier rauszukommen und in die Berge zu fahren, aber …«
Frida schaute jetzt wütend Inge an.
»Und du? Getraust dich nicht zu weit weg von deinem Alkoholversteck?«
»Nein. Aber die Kunz will mir doch tatsächlich jemanden ins Zimmer legen. Ich kann das nicht zulassen, ich würde durchdrehen, verstehst du? Ich kann jetzt nicht weg.«
Frida begann zu keuchen, ihr Kopf wurde gefährlich rot. Schnell drehte sie den Sauerstoffhahn voll auf, trotzdem folgte ein schlimmer Hustenanfall.
»Dazu kommt«, meinte Hans und legte sein Notizbüchlein auf den Tisch, »Luky und ich haben ein Budget gemacht.«
Frida warf einen kurzen Blick auf die Zahlen.
»Über fünftausend? Spinnst du?! Wir wollen das Chalet mieten, nicht kaufen!«
Luky kam Hans zu Hilfe: »Es ist Weihnachten, da kostet jede Absteige in den Bergen ein Vermögen. Die nehmen keine Rücksicht auf Senioren mit Ergänzungsleistungen und vierhundertzwanzig Franken Taschengeld.«
Luky schloss sein Statement mit einem Biss in einen Spitzbuben. Doch seinem Gesichtsausdruck nach war das keine gute Idee. Er legte den Rest auf den Tisch und spülte das Gebäck mit noch widerlicherem Glühwein hinunter.
Hans bemerkte, dass Frida nun kurz vor einem ihrer gefürchteten Wutanfälle stand, und sagte: »Also, ich habe knapp siebenhundert Franken, was könnt ihr dazugeben?«
Die anderen Köpfe senkten sich, niemand sagte etwas.
Da kam eine der Pflegerinnen an ihren Tisch gerannt und raunte Frida aufgeregt zu: »Frau Pizetta, kommen Sie schnell, Frau Gerber gehts ganz schlecht!«
Frida stand auf, klappte das Notizbuch, das noch immer vor ihr lag, zu und warf es Hans in den Schoss.
»Geld hin oder her, wir brauchen einen Plan, und zwar verdammt schnell. Heute Abend um zehn im Waschhaus!«
Dann ging sie, so schnell sie konnte, den Sauerstoffwagen wie einen Golftrolley hinter sich herziehend, der Pflegerin hinterher. Hans, Luky und Inge schauten sich betreten an, und Inge leerte den Rest ihres Flachmanns in einem Zug.
Sie schämte sich. Was war nur aus ihr geworden? Früher hatte sie doch vor nichts und niemandem Angst gehabt, nahm jede Herausforderung, die ihr das Leben bot, mit einem siegesgewissen Lächeln an. Natürlich gabs auch einige Niederlagen, aber die machten sie nur stärker. Spontan kam ihr die Melodie von »You Haven’t Seen the Last of Me« in den Sinn, einem Song von Cher, der das Wiederaufstehen nach Niederlagen zum Thema hat. Ein Lied, das Inge sehr mochte und das sie oft sang, wenn es ihr nicht gut ging. Sie spürte, dass auch Hans und Luky ähnliche Gedanken plagten.
»Gibt es so was wie Altersfeigheit?«, fragte sie in die Runde.
»Je älter du bist«, sagte Hans mit leicht belegter Stimme, »desto weniger Zeit bleibt dir, einen gemachten Fehler wieder zu korrigieren, und darum riskiert man im Alter wahrscheinlich einfach weniger.«
Luky nickte. »Was mich so ärgert an mir ist die Tatsache, dass wir alle hier eigentlich nichts zu verlieren haben. Das soziale Netz ist doch längst zu unserer Hängematte geworden, aus der wir uns kaum mehr zu erheben wagen.«
Frida erreichte keuchend Marias Zimmer. Ohne zu klopfen, öffnete sie leise die Tür und ging hinein. Maria war weiss wie ein Leintuch. Sie lag angezogen auf ihrem Bett, ihr Atem ging ruhig, aber sehr flach. Langsam öffnete sie die Augen. Ihr Blick traf denjenigen von Frida, die sich auf die Bettkante setzte und besorgt nach Marias Hand griff.
»Darf ich …«, begann Maria leise zu sprechen, schluckte trocken und begann erneut, »… darf ich ein wenig Tee haben?«
Frida nickte und war froh, etwas für ihre Freundin tun zu können. Sie reichte ihr die Tasse, die die Pflegerin auf den kleinen Nachttisch gestellt hatte. Maria setzte sich langsam auf, und Frida schob ihr ein Kissen hinter den Rücken. Mit kleinen Schlucken trank Maria den dampfenden Kamillentee.
»Gehts etwas besser?«, wollte Frida wissen.
»Ja. Es war sicher alles etwas viel.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Frida, nahm die halbleere Tasse und stellte sie auf das Nachttischchen zurück.
Maria nestelte umständlich an ihrem Nacken herum.
»Kann ich helfen?«, fragte Frida.
»Ja, bitte. Kannst du den Verschluss meines Kettchens öffnen?«
»Sicher, zeig her.«
Damit der Verschluss näher bei ihr zu liegen kam, zupfte Frida an der feinen Goldkette, die Maria stets um ihren Hals trug, und fummelte an dem feinen Schloss herum. Nachdem sie es geöffnet hatte, reichte sie das Kettchen, an dem ein kleines goldenes Herz baumelte, Maria.
Doch ihre Freundin schüttelte den Kopf und sagte bestimmt: »Ich möchte, dass du die Kette behältst. Sie ist das einzig Wertvolle, das ich besitze.«
Frida spürte einen Kloss im Hals, der sie kaum reden liess.
»Nein, das kann ich nicht annehmen, Maria, das ist …«
»Bitte nimm sie«, fiel ihr Maria ins Wort. »Wem soll ich sie sonst schenken?«
Frida war gerührt und gleichzeitig auch unendlich traurig. Wortlos umarmte sie Maria, die zum Kleiderschrank zeigte.
»Nimm dir, was du möchtest, und frag auch noch die anderen. Den Rest soll die Brockenstube abholen.«
»Aber das hat doch alles Zeit«, entgegnete Frida, sichtlich überfordert mit der Situation.
»Nein«, sagte Maria, »ich will alles erledigt haben, bevor ich gehe, das macht es mir etwas leichter … hoffe ich.«
Frida zeigte auf das Fotoalbum, das auf dem kleinen Tisch lag.
»Und was ist mit Steffi?«
Maria schnäuzte sich die Nase.
»Für Steffi bin ich doch schon lange gestorben.«