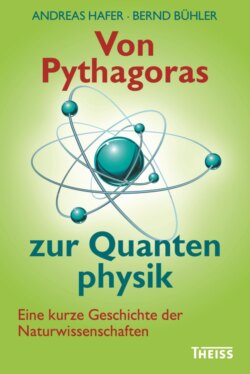Читать книгу Von Pythagoras zur Quantenphysik - Andreas Hafer - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Verlust der antiken Wissenskultur in Europa
ОглавлениеEs kam zu einem langsamen Niedergang der griechisch-römischen Wissenschaft. Das hatte natürlich etwas zu tun mit der schleichenden politischen Krise des „Römischen Reiches“ seit dem 2. Jh. Sie führte allmählich dazu, dass die Macht der Zentrale schwächer wurde und die Randgebiete dem äußeren Druck immer weniger standhalten konnten. Das Römische Reich löste sich langsam auf.
Im östlichen Teil des ehemaligen Reiches gingen die Veränderungen fast unmerklich vonstatten. Im Westen und Norden, dem Gebiet des späteren katholischen Europa, waren die Brüche deutlicher, weil hier Eroberer aus dem Norden, die ihre eigenen Traditionen mitbrachten, die politische Macht übernahmen. Hier wurden schneller und grundlegender die alten wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen umgeformt oder zerstört. Allmählich entstand eine Gesellschaft, die im Wesentlichen nicht mehr durch Handel geprägt und nicht mehr auf städtische Zentren bezogen war, sondern nun nahezu ausschließlich auf Landwirtschaft beruhte.
Die Ursachen sind vielfältig, sollen uns aber hier nicht weiter interessieren. In unserem Zusammenhang erscheint interessanter, warum die Wissenskultur überhaupt verschwand, denn man könnte sich ja vorstellen, dass dieses Wissen unter neuen politischen Bedingungen weiter bestanden hätte.
Grundsätzlich dürfte dieses „Verschwinden“ mit der prekären Überlieferungssituation der Texte selbst zu tun gehabt haben, wie schon bei Aristarch erwähnt. Texte gingen einfach verloren. Noch wesentlicher dürfte aber Anderes gewesen sein.
Wir haben gesehen, dass der Niedergang schon in der hellenistischen Epoche begann, das Problem der antiken Wissenschaft also nicht erst mit dem Ende des Römischen Reiches aufkam, sondern sich nur beschleunigte. Was aber könnte das Problem gewesen sein? Eines der Kennzeichen und gleichzeitig auch eine der Schwächen der griechisch-hellenistischen Wissenschaft bestand darin, dass sie nicht praktisch wurde. Die römische Kultur hatte durchaus Sinn für technische Praxis, aber weniger für „reine“ Wissenschaft oder innovative technologische Lösungen. So erkannte man auch nicht das Potenzial, das in der Wissenschaft steckte. Das lag an dem Mainstream der Wissenschaft selbst, die nach Aristoteles mit Technik nichts zu tun haben wollte. Es lag aber auch daran, dass die römische Wirtschaft auf der Arbeit von Sklaven beruhte. Arbeit hatte fast keinen Wert und es bestand kein Anreiz, sie durch mechanische Hilfen zu ersetzen, zumal die Sklaven als „Werkzeuge“, als die man sie ansah, gut funktionierten. Die Verankerung der Wissenschaft in der Gesellschaft fehlte.
Schließlich wurde die politische Krise begleitet von einer zunehmenden geistigen Krise. Das zeigte sich am wachsenden Interesse an neuen Religionsbewegungen, die sich seit dem 1. Jh. n. Chr. überall im Reich bildeten, und von denen das Christentum die erfolgreichste war.
Zwischen dem 2. und 5. Jh. entstanden die Grundlagen der christlichen Theologie. Intellektuelle jener Zeit von Tertullian (um 160– nach 220) bis zu Augustinus (354–430) schufen ein einheitliches Lehrsystem. Dieses beruhte auf den überlieferten christlichen Quellen, es entstand aber auch in Übereinstimmung mit einer allgemeinen philosophischen Atmosphäre der Spätantike. Man suchte nach neuen Gewissheiten, neuen sinnstiftenden Lehren, und diese waren eher auf das Jenseits ausgerichtet als darauf, die materielle Welt zu erkennen. Die Idee, die der Welt zugrunde lag, war nun das christliche Heilsversprechen, das Lebensziel die Erlösung nach dem Tode. Entsprechend stand die christliche Lehre dem, was wir Naturphilosophie nennen, mehr als skeptisch gegenüber, sie hielt sie schlicht für überflüssig.
Das heißt nicht, dass dieses naturphilosophische Wissen völlig aufhörte zu existieren. Es wurde nur weitgehend bedeutungslos für die Wahrnehmung und Interpretation der Welt und damit war es wirkungslos. Es verschwand in den Elfenbeintürmen einzelner Geistlicher, in Klöstern, in Klosterbibliotheken, im Osten wie im Westen – und ging dort häufig auch verloren. Bisweilen benutzte man die alten Pergamente, auf denen antike Naturforschung aufgeschrieben war, als Einbände für neue christliche Bücher oder kratzte die Schriften ab, um die Pergamente neu zu beschreiben.
Im Osten wurde das Christentum relativ schnell als Staatsreligion übernommen und der weltlichen Herrschaft der Kaiser untergeordnet, die sich als direkte Nachfolger der römischen Kaiser verstanden. Im Westen war die Lage komplizierter, weil die neuen Herrscher weder eine einheitliche Religion mitbrachten, noch ausgebildete Verwaltungsstrukturen, die die alten römischen ersetzen konnten. So waren die neuen Herrschaftsträger auf die Kirche angewiesen und übernahmen den katholischen Glauben, um einerseits ihre Macht zu organisieren und um sich andererseits eine göttliche Legitimation zu geben. Aufgrund dieser starken Position der katholischen Kirche konnten die weltlichen Herren auch nie die vollständige Kontrolle über die Kirche erringen, es war eine Beziehung auf Augenhöhe. Diese Differenz zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft war ein Grund für die ganz besondere Entwicklung im katholischen Europa.
Sie führte auch zu einer Art kultureller Arbeitsteilung. Die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, zumindest in der Oberschicht der römischen Antike eine kulturelle Selbstverständlichkeit, ging verloren. Nun konnten fast nur noch die Geistlichen schreiben und lesen. Entsprechend wurde Wissen studiert, erweitert und weitergegeben in erster Linie in Klöstern und diese lagen in aller Regel weit entfernt von Städten, Dörfern und den befestigten Sitzen der weltlichen Herren. Es waren gewissermaßen Inseln der Bildung.