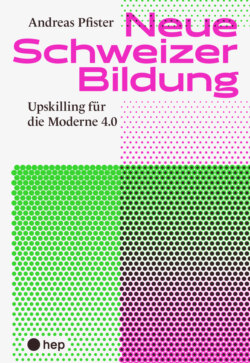Читать книгу Neue Schweizer Bildung (E-Book) - Andreas Pfister - Страница 21
Betriebe erhalten ein Lehrgeld.
ОглавлениеEs muss für die Betriebe wirtschaftlich bleiben, Berufslernende auszubilden. Hier bietet sich der alte Gedanke von einem Lehrgeld an. Der Staat kann die Betriebe für die BM-Ausbildung finanziell unterstützen. Wenn die Betriebe weniger an der Ausbildung verdienen, ist es nur folgerichtig, dass der Staat einen Teil der Ausbildungskosten übernimmt. Schliesslich bleibt Bildung eine Staatsaufgabe. Ein solches Lehrgeld, das über die Steuern eingenommen wird, sorgt für mehr Gerechtigkeit zwischen den Betrieben: Jene, die nicht ausbilden, bezahlen für jene, die diese Verantwortung wahrnehmen.
Noch ist die Anzahl BM-Lernender zu tief. Knapp ein Viertel der EFZ-Absolvent*innen besitzt 2017 einen BM-Abschluss. 13 Prozent haben die BM1 gemacht, 10 Prozent die BM2.
Nur zwei Drittel der BM-Absolvierenden treten in eine Hochschule ein. Diese Quote liegt deutlich unter dem Anteil der Gymnasiast*innen, die an eine Universität übertreten. Die Gründe dafür liegen in der hybriden Natur der Berufsmaturität. Sie berechtigt zum Studium, gleichzeitig steht den BM-Absolvierenden die Arbeitswelt offen. Nur ein Drittel der BM-Lernenden nennt ein Studium als Grund, die BM zu absolvieren. Zwei Drittel sehen darin generell bessere Karrieremöglichkeiten. Beim Übergang von der BM auf die Tertiärstufe wiederholt sich, was für viele Jugendliche mit ein Grund für die Lehre war: Der Arbeitsmarkt lockt mit sofortigen Verdienstmöglichkeiten. Im Gegensatz zu Maturand*innen müssen sich BM-Lernende bewusst gegen Erwerbstätigkeit und Verdienst entscheiden. Das ist ein schwieriger Gratifikationsaufschub, besonders in diesem Alter. Er muss getragen werden von einer Bildungskultur, die man bisher dem akademischen Weg zuschreibt. Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen: Es sind nicht nur, sondern immerhin zwei Drittel der BM-Lernenden, die sich für ein Fachhochschulstudium entscheiden – und damit gegen die Möglichkeit, sofort zu verdienen. Das verdient Respekt.
Gegenwärtig wird viel erwartet von der Berufsmaturität und die hier vorgeschlagene Bildungsoffensive erwartet noch mehr. Kann die Berufsmaturität diese Erwartungen erfüllen? Kann sie die Schweizer Bildung als Zugpferd ins digitale Zeitalter führen? Oder ist die Arbeit in der Moderne 4.0 so anspruchsvoll, dass eine Berufslehre schlicht nicht mehr funktioniert? Muss man zur Schule statt in den Betrieb?
Avenir Suisse publizierte 2001 eine programmatische Schrift mit dem Titel «Die Zukunft der Lehre».[17] Avenir Suisse setzt vor allem deshalb auf die Lehre, weil sie in der Schweizer Bildungskultur stark verwurzelt ist. Die Trends der Gegenwart – Globalisierung, technische Neuerungen, höhere Anforderungen, der Zuwachs wissensintensiver Bereiche – fordern die Lehre heraus. Trotzdem sieht Avenir Suisse eine grosse Zukunft für die Lehre. Sie ist kein Auslaufmodell – in erster Linie dank der Berufsmaturität. Doch es braucht Modernisierungsschritte, insbesondere eine Stärkung der Allgemeinbildung innerhalb des dualen Systems. Zudem wird eine Straffung und Vereinfachung der Lehrberufe vorgeschlagen – ein Vorschlag, der immer noch kontrovers diskutiert wird.
Die Berufslehre geniesst eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.[18] Sie modernisiert sich laufend. Mit ihrer Verbindung von Theorie und Praxis ist sie bestens aufgestellt im technologischen Wandel. Das macht sie zur idealen Bildungsform, um den Mittelpunkt einer neuen Bildungsreform zu bilden.