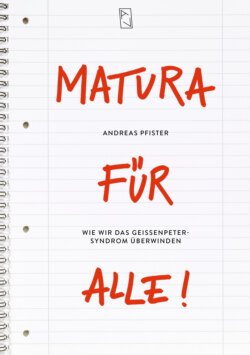Читать книгу Matura für alle - Andreas Pfister - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 05 | BILDUNGSFERNE |
Der Begriff «bildungsfern»1 sei eine Beleidigung, heisst es.2 Doch es erschwert die Verständlichkeit, wenn man immer von Jugendlichen aus «sozio-ökonomisch unterprivilegierten Milieus» oder von «Migrationshintergrund» reden muss. Solche begrifflichen Nebelpetarden liegen im Interesse der Elite. «Elite» soll man übrigens auch nicht sagen. Es gebe sie nämlich nicht, versichert dieselbige. An der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide sagt es sich besonders leicht, dass es eine solche nicht gibt. Sprachliche Tabus sind gut gemeint, doch de facto helfen sie mit, die Unterschiede zu verwischen. Es gibt ein Oben und ein Unten, eine Nähe und eine Ferne. Weshalb soll man das nicht benennen? Gesellschaftliche Hierarchien kann man bekämpfen, verspotten, ablehnen – wie es zum Beispiel die 68er-Generation getan hat. Doch wie will man sich für die Bildungsfernen einsetzen? Wenn es sie denn gar nicht gibt?
BEDEUTUNG SOZIALER KLASSEN
Das Abstreiten von sozialen Klassen und ihrer hierarchischen Ordnung ist ein beliebtes rhetorisches Mittel ebenjener Klasse, die an der Spitze steht. Tatsächlich ist das Klassenbewusstsein unterschiedlich ausgeprägt. Es ist zumal in der Schweiz in den Hintergrund gerückt. Das hat mit der Ausweitung des Mittelstands zu tun. Vor einem halben Jahrhundert machten weniger als 5 Prozent der Bevölkerung das Gymnasium. Entsprechend galt es als Eliteschule. Heute sind es rund 20 Prozent. Da kann man nicht mehr von einer Elite im engeren Sinn sprechen, dafür sind es zu viele. Hinzu kommen die Berufs- und Fachmaturität, die Fachhochschulen, die höheren Fachschulen und andere weiterbildende Institutionen. Die Grenzen sind fliessender geworden.
Dass darüber gestritten wird, ob es überhaupt noch Klassen im historischen Sinn gebe und welche Bedeutung diese heute haben, zeigt, dass die Debatte schon bei der Definitionsmacht ansetzt. Wie kann man den Bildungsfernen besser den Boden unter den Füssen wegziehen, als wenn man bestreitet, dass sie bildungsfern sind! «Ich bin nicht besser als du. Du verdienst zwar weniger, doch du bist genau so viel wert.» Wie soll man sich gegen eine solche Charme-Offensive zur Wehr setzen? Es ist ja nicht so, dass hinter solch netten Worten falsche Absichten stehen. Man empfindet die Müllmänner tatsächlich als Helden. Und unsere Sympathie gehört aufrichtig den Büezern.3 Es ist weder Lüge noch Heuchelei, wenn wir von der Gleichwertigkeit der Arbeit auf einer Baustelle reden. Die traurige Pointe liegt darin, dass es gar keine Rolle spielt, wie wir das meinen. Der Effekt ist derselbe. Ob wir zynisch die Arbeiter von der höheren Bildung wegloben oder aus ehrlich empfundener Sympathie, oder ob wir selbst zu ihnen gehören – es mündet alles in jene diskursive Struktur, welche die faktische Hierarchie der Klassen zementiert. Hat man jemals Hochqualifizierte auf die Gleichwertigkeit ihrer Arbeit pochen hören? Wer weiss, dass seine Arbeit besser bezahlt wird, braucht keine verbale Bestätigung seiner Gleichwertigkeit und auch keine Image-Kampagnen.
Der einst revolutionäre Diskurs von der Gleichwertigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Er bestimmt das Sprechen über Bildung und Arbeit. Das macht es schwierig für Bildungsferne, sich zu wehren. Wen sollen sie denn angreifen? Es sind alle so nett.4
KLASSENWECHSEL
Die Sensibilität für Klassenunterschiede ist zweifellos höher für jene, welche in ihrem Leben die soziale Klasse gewechselt haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass es heute die Bildungsaufsteiger aus den neunziger Jahren sind, die sich besonders resolut für die Bildung ihrer Kinder einsetzen. Was man sich erkämpft hat, will man weitergeben. Das betrifft nicht, wie oft unterstellt wird, in erster Linie den Status. Es ist die Welt des Geistes und der Bildung selbst, die man den Kindern eröffnen möchte.
Auf den Begriff der Bildungsferne zu verzichten, kann Privilegierten nur recht sein. Doch es zählen Taten, nicht Worte. Fakten, nicht Sonntagspredigten. Und die Fakten sind eindeutig: Trotz aller Lobeshymnen auf die Berufslehre nimmt der Run aufs Gymnasium von Jahr zu Jahr zu. Es möchten viel mehr Kinder hin, als gegenwärtig aufgenommen werden.
Wenn hier also weiterhin der Begriff Bildungsferne verwendet wird, dann nicht aus fehlendem Respekt. Im Gegenteil: Respekt vor den Arbeitern und dem Handwerk drückt sich aus in einer klaren Sprache. Immerhin geht es um bildungsferne Kinder. Die werden zum Opfer einer unheiligen Allianz zwischen Bildungsnahen und Bildungsfernen. Wenn die Kinder beide Seiten gegen sich haben, sowohl die Selektion als auch die Bildungsskepsis, dann sind sie chancenlos. Denn auf diese Weise kann man Bildungsferne besonders wirkungsvoll verdrängen: Man appelliert an ihre eigenen Werte. Man schürt ihre latente Bildungsfeindlichkeit, man bestätigt sie im Glauben, dass sie Bildung gar nicht brauchen. Man klopft ihnen gönnerhaft auf die Schulter und versichert ihnen ihren Wert als Mensch, den sie auch ohne Bildung haben. Man lobt den Wert ihrer Arbeit, ohne sie entsprechend zu bezahlen. So schlägt man Bildungsferne mit ihren eigenen Waffen.
Wer Bildungsferne so einzunehmen versteht, den werden sie lieben und an der Urne auch wählen. So funktioniert Populismus. Anstatt eine echte Chance zum sozialen Aufstieg zu schaffen, bestätigt man den sozial Schwachen, dass sie schon recht sind, wie sie sind. Dass sie überhaupt nicht aufsteigen müssen. Dass höhere Bildung gar nicht erstrebenswert sei. Oder allenfalls später nachgeholt werden könne. Dass die da oben sowieso nur arrogante Säcke seien voller Bildungsdünkel. Mit diesem Diskurs lassen sich wunderbar die bestehenden sozialen Verhältnisse zementieren. Und zwar so, dass diejenigen, die sich unten befinden, die soziale Pyramide willfährig und stolz mittragen. Denn sie sind ja nicht unten.
FERNE DER BILDUNGSNAHEN
Die Bildungsreformer sind nicht die Ersten, die mit missionarischem Eifer ausziehen, nur um bitter enttäuscht zu werden von der Verstocktheit der Ungläubigen. Die Bildungsfernen pfeifen auf die angebliche Chance. Die ganze Begrifflichkeit ist für sie verkehrt. Sie sind überhaupt nicht fern, von was auch? Ihnen fehlt nichts. Die so genannte Chance ist für sie ein Irrweg, die angebliche Aufstiegsmöglichkeit bloss eine Entfremdung und Entfernung vom Zentrum, in dem sie sich längst befinden: in der Natur, in Verbindung mit dem Boden, dem Wetter, dem Körper. Dem echten Leben halt. Weshalb sollten sie weg von da? Um abgehoben in irgendeinem Elfenbeinturm die Verbindung zu verlieren zu allem? Eine Ferne sehen die so genannten Bildungsfernen nicht bei sich, sondern wenn schon bei den Studierten. Die haben sich entfernt – nicht sie. Die Bildungsfernen stellen die Hierarchie auf den Kopf: Sie nennen den Professor Brotfresser. Die Bürolisten haben zwei linke Hände, die Lehrer am Morgen recht und am Nachmittag frei. Die Studierten kann man zu nichts gebrauchen, wenn sie von der Uni kommen. Die Beamten in Brüssel haben keine Ahnung. Die Städter wissen nicht, wie eine Kuh aussieht. Und jetzt sollten sie ihre Kinder an diese absurde Welt angeblich höherer Bildung verlieren? So weit kommt’s noch!
Wie fern Bildung in solchen Milieus tatsächlich ist, wird oft unterschätzt. Man meint, die Chance müsste eigentlich genügen. Die Bildungsfernen bräuchten sie ja nur zu ergreifen. Es gibt eine Kluft zwischen theoretisch gerechtem Bildungssystem und faktisch ungerechter Reproduktion gesellschaftlicher Klassen.5 Dass man studieren könnte, weiss man als Bildungsferner theoretisch schon. Aber man will eben nicht. Und damit bleibt die soziale Aufstiegschance ungenutzt.