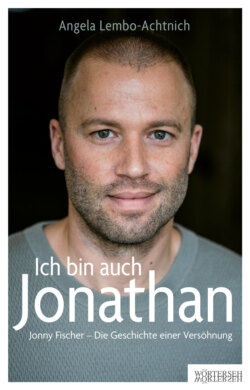Читать книгу Ich bin auch Jonathan - Angela Lembo-Achtnich - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zu Besuch bei Mutter Helen Fischer
◼ 2019
ОглавлениеHelen Fischer hat den Tisch für Kaffee und Kuchen gedeckt, hat Kerzen angezündet und alte Familienfotos bereitgelegt. Jonnys Mutter lebt allein. Sie freut sich über jeden Besuch. Auch über meinen – obschon sie ahnt, dass ich als Biografin ihres Sohnes auch unangenehme Fragen stellen werde. Das sei schon recht, sagt sie, die Menschen würden sich bestimmt fragen, welche Rolle sie als Mutter gespielt habe.
Auch sie hatte sich nach Erichs Tod 2016 intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Sie hatte ihr Leben Revue passieren lassen. Was hatten ihre Kinder durchgemacht? Welche Rolle hatte Erich dabei gespielt? Welche sie als Mutter? Und sie war auch der hypothetischen Frage nachgegangen: Wäre es für ihre Kinder besser gewesen, wenn sie anders gehandelt hätte? Wie wäre es herausgekommen? Nächtelang lag Helen damals wach. Sie fand zwar keine Antworten, gelangte aber zur Erkenntnis, dass sie die Zeit nicht zurückdrehen konnte. Helen entschied sich also, nicht mehr darüber nachzudenken. »Ich kann die Fakten nicht ändern, aber ich kann meine Sicht der Dinge schildern«, sagt sie und nimmt einen Schluck Wasser. Dann beginnt sie zu erzählen:
»Erich fand nie wirklich den Zugang zu Jonny. Die Spannungen zwischen den beiden wurden immer grösser. Sie gingen aufeinander los wie zwei Hähne im Kampf. Ab und zu bekam ich es mit. Wenn sie in der Stube oder in der Küche stritten. Ich ging nicht dazwischen. Ich stellte mich nicht schützend vor mein Kind. Und ich nahm Jonny nicht in den Arm. Weil ich die Hände schon voll hatte mit anderem, was zu tun war. Ausserdem wusste ich nicht, was richtig war. Ich wusste es nicht. Und ich traute mir nicht. Ich bin auch ein aufbrausender Mensch, und hätte ich in dieses Konzert von Vater und Sohn eingestimmt, hätte es wahrscheinlich keine heilende Wirkung gehabt, im Gegenteil.
›Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren‹, so heisst es in der Bibel. Doch gegen dieses vierte Gebot verstiess Jonny, wenn er sich gegen den Vater auflehnte. Darum verliess ich bei den Auseinandersetzungen meistens den Raum und betete: ›Mein Eingreifen würde nichts nützen, bitte, Herr, du hast uns den Auftrag gegeben, diese Kinder zu bekommen. Das ist jetzt deine Angelegenheit.‹
Innerlich zerriss es mich fast. Denn ich wusste, wohin das führen würde. Ich hatte als Lehrerin Kinder in der Schule gehabt, denen die Liebe des Vaters gefehlt hatte. Sie hatten auch später keinen Boden, kein Vertrauen darin, geliebt zu werden und aufgehoben zu sein. All das wusste ich, und ich starb tausend Tode in diesem Wissen. Aber ich konnte Jonny nicht geben, was ihm vom Vater fehlte. Ich konnte nur meines geben. Nur das.
Seine Geschwister behaupteten oft, Jonny sei mein Lieblingskind. Ich widersprach nie. Ich konnte ihnen ja nicht sagen, ich müsse ihn mit meiner Liebe speziell schützen. Ich versuchte, für Jonny da zu sein. Ich empfing ihn, wenn er aus der Schule heimkam, umarmte ihn und sagte: ›Es ist wunderbar, dass du nach Hause kommst. Wie geht es dir?‹ So machte ich das. Mehr konnte ich nicht tun. Ich war über alle Massen ausgelastet mit dem Haus, den Kindern und später mit der eigenen Kirche. Aber Jonny wusste, dass ich hinter ihm stand. Das wusste er immer. Ich hoffe es zumindest. Ich muss ihn einmal fragen, ob und wo er sich von mir verlassen fühlte. Aber: Jesus hat sich am Kreuz auch verlassen gefühlt. Das müssen wir wissen.«
Was ist Elternliebe? Eine Umarmung bei der Heimkehr, ein gutes Wort, die Frage nach dem Wohlergehen? Genügen diese Gesten der Zuneigung, um einem Kind das Urvertrauen zu schenken, das es als Grundlage braucht, um Vertrauen in sich selbst, in andere, in die Welt entwickeln zu können? Der Kinderpsychologe Allan Guggenbühl verneint: »Die Basis einer gesunden Beziehung ist versöhnliche Liebe, das Wissen, dass der andere einen trotz allen Schwächen akzeptiert«, sagt er auf telefonische Anfrage. In den ersten Lebensjahren sei dieses Gefühl von Akzeptanz und versöhnlicher Liebe besonders wichtig. »Bedingungslose Liebe bildet das Fundament, das einen Menschen trägt, wenn später im Leben grässliche Dinge geschehen. Fehlt dieses, so hat der Mensch keinen Halt. Kein Vertrauen in sich und darauf, dass alles gut kommt.«
Jonathan fehlte ein solches Fundament. Er fühlte sich wie das schwarze Schaf der Familie, weil er sich schon sehr früh quergestellt hatte. Er hatte die Überzeugungen der Eltern hinterfragt. Er hatte gegen Gottes Gebote verstossen und mehrmals täglich gesündigt. Er hatte sich nicht an die Bedingungen gehalten, von denen die elterliche Liebe im Hause Fischer abhing. Er fühlte sich ungeliebt. Schlimmer noch, in seinen Augen war es seinen Eltern egal, ob es ihn gab oder nicht. »Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit«, sagt Guggenbühl. Das sei ein bekanntes Phänomen in streng religiösen Umgebungen, und: »Extreme Ideologien können zu einer Entmenschlichung führen: Man ist nur noch Diener dieser Ideologie, die klar trennt zwischen Gut und Böse. Menschliche Aspekte wie Freude, Liebe, Angst oder Verzweiflung sind egal.«