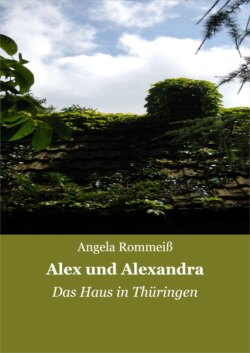Читать книгу Alex und Alexandra - Angela Rommeiß - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie alte Frau lag im Sterben.
Sie wusste es, und ihre Tochter, die neben dem Klinikbett auf einem Stuhl saß, wusste es auch.
Die Frau hielt die Hand ihrer Mutter und blickte ihr in das blasse, zerfurchte Gesicht. Dieses Gesicht, das sie so sehr liebte und das ihr von klein auf vertraut war wie ihre eigene Hand. So vertraut waren ihr diese feinen Gesichtszüge, dass ihr entgangen war, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hatten, mehr und mehr Falten bekamen und alt wurden.
Als kleines Mädchen hatte ihr ein Blick in dieses Gesicht genügt, und die Welt verlor ihren Schrecken. Sei es, dass sie sich verlaufen hatte im Getümmel des Marktes, oder schaute sie nach ihr aus, wenn sie bei einer Schulaufführung in den Zuschauerraum blickte - alles war gut, wenn sie Muttis Gesicht in der Menge entdeckte.
Die Tochter erinnerte sich an die Nächte ihrer Kindheit, in denen sie, von Albträumen geplagt, ins Bett ihrer Mutter kroch, um sich trösten zu lassen. Dicht an ihren Körper gedrückt, sodass sie ihren Herzschlag spürte, fühlte sie sich sicher vor Räubern und Gespenstern. Von unerklärlichen Ängsten geplagt hatte sie die Mutter gefragt: „Gell, Mutti, du stirbst nicht?“
Und die Mutter hatte leise geantwortet: „Doch, ich sterbe auch mal. Aber das ist noch lange hin.“
Mit schwerem Herzen hatte das Kind gefragt: „Wie lange denn?“
Die Mutter hatte ihr die Wange gestreichelt und mit dunkler, ruhiger Stimme geflüstert: „Ganz lange, ein ganzes Leben. Mach dir keine Sorgen, schlaf jetzt.“
Aber wie sollte man sich denn keine Sorgen machen, wenn man wusste, dass die Mutti einmal sterben würde? Wie sollte man denn da schlafen?
Die Tochter erinnerte sich noch genau an dieses Gefühl längst vergangener Kindertage. Seltsamerweise hatte sie sich nie um den eigenen Tod Sorgen gemacht, aber der drohende Verlust der Mutter erschien ihr unerträglich.
Die Jahre und die Kinderängste vergingen, und nun war es also doch soweit. Das ganze Leben, von dem ihre Mutter gesprochen hatte, war vorüber.
Die Frau seufzte. „Ach, Mutti“, dachte sie. „Ich hätte mich in den letzten Jahren mehr um dich kümmern sollen. Du hast doch nur mich. Aber ich habe dich viel zu selten besucht, dich nicht oft genug angerufen. Vielleicht hätte ich eher bemerkt, dass da etwas nicht stimmt, dass ein Krebsgeschwür in dir wuchert. Ich habe doch als Altenpflegerin einen Blick für so etwas, ich hätte es bestimmt gemerkt, wenn ich nur öfter zu dir gekommen wäre!
Aber hätte ich das wirklich? Wahrscheinlich nicht. Fremde Leute schaut man anders an als die eigene Mutter, die man noch lange nicht als alte Frau empfindet. Du wusstest es ja, hast es nur niemandem gesagt. Dabei bist du doch noch nicht alt. Heutzutage ist sechzig nicht alt, die Leute werden fünfundachtzig und älter. Ach, Mutti.“
Auf einmal vermisste sie das Blinken und Surren der Geräte auf der Intensivstation, obwohl sie anfangs doch froh gewesen war, dass sie endlich Ruhe hatten. Aber die geschäftige Geräuschkulisse und das emsige Tun des Pflegepersonals hatten den Eindruck vermittelt, dass man noch etwas tun konnte, dass es nicht endgültig war...
Ein sanfter Druck der alten Hand, die sie umklammert hatte, ließ die Frau aufschauen. Schnell zwinkerte sie die Tränen weg, die ihr immer wieder den Blick verschleierten. Mit wachen Augen schaute die Mutter ihre Tochter an.
Die Augen waren immer das Schönste an ihr gewesen, diese großen, dunkelbraunen Augen. Sie waren auch fast das einzige, was sie ihrer Tochter vererbt hatte. Jedenfalls das einzige Äußerliche, denn im Charakter ähnelten sie sich sehr. Während aber die Mutter eine große, kräftige Frau war, war ihre Tochter eher zierlich und von kleinem Wuchs. Sie war sich neben ihrer Mutter immer winzig vorgekommen.
„Meine kleine Elfe“, hatte die Mutter sie oft genannt, oder „meine kleine Anna“. Dabei hieß sie gar nicht Anna, sondern Alexandra. Aber Anna war ihr Kosename gewesen, seit sie denken konnte, und nur ihre Mutter nannte sie so.
Wie sie da so klein und zusammengesunken im Krankenbett lag, sah die Mutter sich selbst gar nicht mehr ähnlich. Der Krebs hatte die Kraft und die Stärke aus dieser einst so lebensfrohen, resoluten Frau gesogen, sie sah aus wie eine leere Hülle ihres früheren Körpers.
„Alexandra, versprich mir etwas!“, flüsterte sie mühsam, ihre Stimme krächzte. Schnell griff die Tochter nach dem Wasserglas und hielt es ihrer Mutter an die spröden Lippen. Die alte Frau schluckte und seufzte. Dann sprach sie klarer.
„Ich möchte, dass du dich um das Haus kümmerst. Meine Schwester hat es dir damals vermacht. Seitdem steht es leer. Ein Haus sollte nicht leer stehen, es stirbt dann.“
Alexandra war verblüfft. Wovon sprach ihre Mutter da? Sicherlich war sie verwirrt und phantasierte. Die Tochter streichelte die Hand der Kranken und antwortete sanft: „Ich habe doch kein Haus geerbt, Mutti. Und du… du hast doch gar keine Schwester.“
Die Mutter seufzte schwer. „Doch doch, ich hatte eine Schwester. Ich habe dir nie von ihr erzählt, weil... aber das ist jetzt auch egal. Sie ist ja gestorben, die Anna. War noch so jung!“
Eine Träne rann aus ihrem Auge und tropfte auf das weiße Krankenhausnachthemd. Alexandra tätschelte die Hand ihrer Mutter und dachte: „Sie phantasiert. Ganz sicher tut sie das.“
Aber die Kranke sprach weiter, und es klang nicht so, als phantasiere sie.
„Es ist mein Elternhaus. Nein, ich wollte nicht dort wohnen, das stimmt schon, und verkauft habe ich es auch nicht. Ich hätte mich darum kümmern sollen, aber ich konnte irgendwie nicht. Eigentlich hast auch du es geerbt und nicht ich. Vielleicht nicht offiziell, aber... Anna hat es mir oft gesagt: Alexandra soll alles bekommen, was ich habe. Und dann soll sie selber sehen ...“ Die Mutter richtete sich plötzlich auf und bat eindringlich: „Verkauf es nicht, Anna! Du musst es behalten, bitte!“
„Ja, ja natürlich, Mutti!“ antwortete Alexandra hilflos. Wie sollte sie ihrer Mutter denn auf dem Sterbebett ein Versprechen verweigern, sei es auch noch so irrwitzig? Dieses Gespräch strengte die Kranke zu sehr an, sie sollte sich ausruhen.
Als sie das Versprechen hatte, beruhigte sich die Mutter wieder ein wenig. Nach einer Weile sagte sie leise: „Es ist so viel Zeit vergangen seit damals. So viel Zeit… Man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden. Aber nicht alle. Nicht alle, nein…“ Sie sprach langsam und leise, mit langen Pausen zwischen den Sätzen. Ihre Tochter ließ sie reden und hielt ihre Hand.
„Da gibt es noch etwas, das du wissen solltest...“
Alexandra horchte auf. Da war es wieder, dieses unausgesprochene Geheimnis. Sie wusste nicht, wann es begonnen hatte, aber schon seit sie in die Pubertät gekommen war, hatte ihre Mutter immer mal wieder solche Andeutungen gemacht. Sie hatte es ihr am Gesicht angesehen, dass es etwas Wichtiges war, aber immer hatte die Mutter einen Rückzieher gemacht und ihr nichts gesagt. Alexandra war sich einigermaßen sicher, dass es darum ging, wer ihr Vater war. Sie hatte ihn nie kennengelernt, niemand hatte das. Und wen man nicht kennt, den vermisst man auch nicht. Alexandra zumindest hatte ihn nie vermisst, ihr hatte die Mutter genügt. Sie hatte nur sie, keine sonstigen Verwandten. Keine Onkel und Tanten, keine Großeltern, keine Geschwister. Dass sie vielleicht doch eine Tante gehabt hatte, musste sie erst einmal verdauen. Das war also der Grund dafür gewesen, dass ihre Mutter sie immer Anna genannt hatte! Anscheinend hatte Alexandra ihre Mutter an ihre Schwester erinnern, vielleicht sah sie ihr sogar ähnlich. Sie beugte sich vor, um die schwache Stimme ihrer Mutter besser zu hören.
„Es ist... es ist schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll.“ Die Kranke stöhnte gequält.
Alexandra streichelte ihrer Mutter die Wange, so wie sie selbst so oft von ihr getröstet worden war. „Sag es einfach, Mutti. Es wird dich erleichtern, und ich halte es schon aus. Ich halte ‘ne Menge aus, das weißt du doch. Ich bin wie du!“
Die Mutter schaute ihre Tochter an, als sähe sie sie das erste Mal. Dann lächelte sie und nickte. Sie schien sich innerlich zu straffen und wirkte auf einmal sehr zufrieden.
„Ja. Ja, du hast Recht. Du bist wie ich, und deshalb ist es auch nicht wichtig. Es ist ganz egal!“
„Was ist egal?“, fragt Alexandra verwirrt, aber ihre Mutter hatte schon die Augen geschlossen und schien wieder einzuschlummern. Sie stand unter starken Schmerzmitteln. Leicht frustriert lehnte sich die Frau wieder zurück. Dieses Geheimnis sollte wohl ein Geheimnis bleiben.
Draußen begann der Tag zu dämmern. Ein Vogel fing an, sein Morgenlied zu trällern, ein zweiter fiel ein. Krankenschwestern gingen auf leisen Sohlen draußen auf dem Gang an ihrem Zimmer vorbei, schnaufend öffneten und schlossen sich die großen Glastüren am Ende des Ganges. Nebenan rauschte eine Toilettenspülung.
Die durchwachten Nächte machten sich bemerkbar, Alexandra fielen die Augen zu, ihr Kopf sank zur Seite. Die Unwirklichkeit der Situation verschwamm in ihrem Kopf: Sie schlief in ihrem Bett, der Wecker hatte geklingelt, gleich würde sie aufstehen müssen! Nur noch ein paar Minuten...
Alexandra schreckte auf. Ein Traum! Es war nur ein böser Traum gewesen! Die Sekunde der Erleichterung verflog so schnell, wie sie gekommen war. Nein, es war kein Traum – ihre Mutter würde heute sterben. Warum konnte es denn kein böser Traum gewesen sein? Wieder spürte Alexandra, wie sich ihre Kehle zuschnürte, wie ihr die Tränen heiß in die Augen stiegen.
Nach einem besorgten Blick auf ihre Mutter stand sie auf und ging zum Fenster. Draußen erwachte die Großstadt zum Leben. Eigentlich schlief sie nie, immer gab es Lichter, fuhren Autos und Busse, zuckten Blaulichter, hasteten Menschen durch die Straßen. Berlin war eine lebendige Stadt. Unten auf der Straße bewegten sich die ersten Besucher. Was wohl die Leute so früh hier wollten? Waren es Väter, die ihre Neugeborenen das erste Mal sehen wollten? Kamen besorgte Eltern, um ein krankes Kind zu besuchen und zu trösten? Kamen Leute mit Beschwerden hier in die Charité und sicherten sich einen Platz in den überfüllten Warteräumen? Vielleicht waren es auch Angestellte – Krankenschwestern, Ärzte, Putzfrauen – die zu ihrer Schicht erschienen? Egal – sie alle würden dieses Krankenhaus früher oder später wieder verlassen, so wie sie selbst auch.
Aber ihre Mutter nicht.
Sie nicht.
Alexandra war noch nicht bereit, ihre Mutter zu verlieren. Sie war ihr fester Halt im Leben, ihre Vergangenheit. Wer sollte die Erinnerungen ihrer Kindheit mit ihr teilen, mit wem sollte sie über Episoden ihres Lebens reden, mit wem über lustige Begebenheiten lachen? Niemand kannte sie so gut wie ihre Mutter, niemand würde sie je so gut verstehen. Die Probleme, die sie mit Stefan hatte, die Sorgen mit der pubertierenden Tochter – immer verstand die Mutter ohne lange Erklärungen sofort ihre Sorgen, beruhigt sie, relativierte die Probleme und gab ihr mit ein paar wenigen, guten Ratschlägen ihr Selbstbewusstsein und innere Ruhe wieder. Wie sollte sie darauf verzichten? Mit wem konnte sie nun reden?
Alexandra wurde von einer Welle des Selbstmitleids übermannt, für das sie sich selbst verachtete. Aber es half nichts, die Tränen strömten jetzt ungehemmt. Schluchzend sank sie auf ihrem Stuhl zusammen.
Kurze Zeit später erwachte die Mutter erneut. Wieder war sie völlig klar und sprach leise, aber deutlich.
„Alexandra, mein Schatz! Nein, weine nicht. Jeder hat seine Zeit, und meine ist um. Es ist nicht schlimm, ich bin müde. Ich hatte ein gutes Leben, und das verdanke ich dir. Du hast mein Leben reich gemacht. Wenn ich dich nicht gehabt hätte... Es ist so schön, dass ich dich haben durfte. Sie wollten es erst nicht erlauben, aber ich durfte dich haben...“
Alexandra konnte sich keinen Reim darauf machen, was ihre Mutter da redete. Aber sie sagte nichts, sondern hörte nur zu.
Die alte Frau sprach weiter, jetzt eindringlicher: „Kind, das Leben ist kostbar. Es vergeht viel zu schnell, deshalb vergeude es nicht. Gib dich nicht mit Dingen ab, die dich unglücklich machen, fühle dich nicht verantwortlich für jedermann. Man muss Dinge, die einem schaden, einfach hinter sich lassen und nicht mehr daran denken. Manchmal auch Menschen. Kümmere dich um dich selbst und um dein Kind, das ist das einzige, was zählt. Hörst du, vergeude keinen Tag!“ Ihr fest die Hand drückend, beschwor die alte Frau ihre Tochter nachdrücklich mit heiserer, vom nahenden Tod gezeichneten Stimme: „Vergeude keinen Tag deines Lebens, mein Schatz! Hörst du, keinen einzigen Tag!“
Alexandra konnte nur nicken, sie hatte eine Gänsehaut bekommen.
Der Kopf der Mutter sank wieder in die Kissen, ihre Augen schlossen sich erneut, und dieses Mal öffnete sie sie nicht wieder. Sie schlief ein, und während draußen die Vögel die ersten Frühlingslieder sangen, tat das Herz von Adele Sebach seinen letzten Schlag.