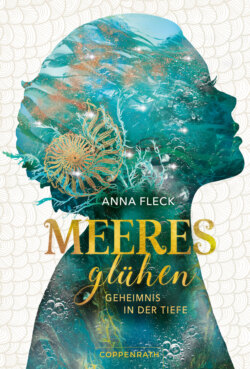Читать книгу Meeresglühen (Bd. 1) - Anna Fleck - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеSchon die erste Welle fegte mich fast von den Füßen und tränkte mich mit eiskaltem Salzwasser. Ich schnappte nach Luft, rammte meine Füße in den sandigen Untergrund und stemmte mich gegen den Druck des Wassers. Noch konnte ich stehen, das war gut. Schritt für Schritt kämpfte ich mich voran. Um mich herum sprühte die Gischt und nahm mir die Sicht, aber als erneut eine Welle anbrandete und etwa auf meiner Höhe brach, sah ich mein Ziel wieder: Der Surfer war weiter in Richtung Ufer getrieben und klammerte sich verzweifelt an sein Brett. Oder hing er irgendwie darauf fest?
»Hey! Hierher!«, brüllte ich ihm zu und bereute es sofort, denn ich bekam einen Schwall Meerwasser in den Mund. Hustend und spuckend versuchte ich weiterzukommen, aber jetzt wurde es langsam tiefer. Ich spürte, wie die Unterströmung an meinen Beinen riss.
Das schaffst du nicht, warnte meine innere Stimme. Du musst zurück, sofort, oder sie fischen nachher zwei Leichen aus dem Meer!
Ein Versuch noch!, schrie ich ihr zu.
Ich stieß mich vom Boden ab. Ein Schwimmzug, zwei, drei. Die Gischt machte mich halb blind. Vier, fünf. Plötzlich vor mir: eine graue Wand. Ein enormer Brecher, der sich immer höher auftürmte. Aber auch der Surfer, der mitsamt seinem Brett emporgerissen und auf mich zugetrieben wurde, näher, näher … Die Welle brach mit ungeheurer Wucht direkt über mir. Ich hatte gerade noch Zeit zum Luftholen, da wurde ich auch schon unter Wasser gedrückt und herumgewirbelt. Wild ruderte ich mit den Armen – und bekam etwas zu fassen: die Leine des Surfbretts. Das war vermutlich meine Rettung, denn das Brett hatte einen fantastischen Auftrieb. Im nächsten Moment durchstießen wir die Wasseroberfläche und ich rang keuchend nach Atem. Ein kurzer Blick auf den Surfer genügte mir – nein, er bewegte sich wirklich nicht mehr. Panik erfasste mich.
Beeil dich, Ella!
Ich krallte mich an das Heck des Bretts und schlug mit den Beinen, so kräftig, wie ich nur konnte. Tatsächlich, das Ufer kam langsam näher, auch wenn uns jede Welle erneut ein Stück zurückzog. Gott sei Dank war Flut, auflaufendes Wasser, wie mein langsam wieder einsetzender Verstand nun registrierte. Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Schließlich fühlte ich Boden unter den Füßen; das Brett im Schlepptau, taumelte ich durch das hüfthohe Wasser dem Strand entgegen.
Dort begrüßte mich ein grauer, nasser Schatten und rammte meine Beine, sodass ich fast das Gleichgewicht verlor.
»Snowflake, du blödes Vieh!«, schrie ich. »Zurück ans Ufer, aber sofort! Du kannst mir nicht helfen!«
Nicht zu fassen. Sonst wasserscheu wie eine Katze, aber wenn man es gar nicht gebrauchen konnte … Zum Glück gehorchte er und preschte mir voraus, offenbar beruhigt, dass sein Frauchen heil zurückgekommen war. Ich zog das Brett mit seinem Passagier so weit aus der Brandung, wie es mir mit meinen zitternden Beinen möglich war, dann sackte ich erst einmal zusammen.
Aber mein Wunderhund ließ mir keine Ruhe, knuffte mich, jaulte und bellte, so aufgeregt und froh war er.
»Ab, Snowflake!« Ich schob ihn mühsam von mir und stemmte mich auf die Knie. Was war mit dem Surfer? Lebte er noch? Reglos lag er auf seinem Brett. Hektisch versuchte ich ihn herunterzuzerren, bis ich bemerkte, dass er daran festgeschnallt war. Wie sollte man denn so surfen? Egal. Irgendwie befreite ich ihn von den Gurten und drehte ihn auf den Rücken.
Es war ein junger Typ in meinem Alter. Schwarze, kurze Haare umrahmten sein Gesicht. Ein Gesicht mit auffallend schönen männlichen Zügen – aber totenblass. Ein Schauer durchfuhr mich. Hatte ich es nicht rechtzeitig geschafft? Fieberhaft tastete ich nach seinem Puls, erst am Hals, dann am Handgelenk, aber meine Finger zitterten, und seine Haut war so kalt, dass ich keinen klaren Eindruck bekam. Kurz entschlossen riss ich sein Hemd auf – ein dunkler Stoff, ganz sicher kein Neopren – und presste mein Ohr auf seine Brust.
Super, Ella, wirklich professionell, von wegen Arzttochter!, nörgelte es in meinem Kopf.
Ich schloss die Augen. Es gelang mir, Wellenrauschen, das Pfeifen des Windes und Snowflakes Gehechel auszublenden. Und dann hörte ich ihn: seinen Herzschlag. Schwach, aber stetig. Erleichtert setzte ich mich auf. Und bemerkte etwas Seltsames: ein schwaches goldenes Glühen auf der nassen Brust des Surfers. Hatten sich dort Leuchtalgen oder so etwas verfangen? Ich wischte mit der Hand über seine Haut, das Glühen blieb. Aber viel wichtiger war ja: Atmete er noch? Keine Chance, das auf die Schnelle und bei Wind zweifelsfrei festzustellen. Mund-zu-Mund konnte nicht falsch sein, oder?
Los jetzt, feuerte mich meine innere Stimme an. Du kannst das, Mama hat’s dir gezeigt.
Ich hielt dem Typen also die Nase zu, öffnete seinen Mund, presste meine Lippen auf seine und atmete tief aus. Verdammt, war das richtig so? Wenn ich es nun vermasselte? Unsicher hob ich den Kopf – und bekam einen Schwall Salzwasser ins Gesicht. Mein Beatmungsopfer hustete und spuckte krampfhaft. Gerade noch rechtzeitig wälzte ich ihn auf die Seite, bevor er den halben Ozean erbrach.
Er keuchte und würgte eine gefühlte Ewigkeit, dann folgte ein tiefer, zitternder Atemzug. Eine Weile hockte ich einfach nur neben ihm. Ich fühlte mich vollkommen erschlagen. Das Adrenalin ließ nach, und ich begann, heftig zu frieren. Jetzt erst merkte ich, wie kalt das Wasser gewesen war, wie stark der Wind pfiff und wie wenig Wärme meinem Körper in den durchnässten Sachen blieb. Wenn schon mir die Unterkühlung drohte, war es für den Geretteten ganz sicher lebensbedrohlich. Wir brauchten Hilfe. Und zwar schnell.
Ich kam taumelnd auf die Füße und blickte um mich. Noch immer trieb sich keine Menschenseele in der Bucht herum. Mein Handy blieb natürlich auch tot. Und Snowflake hatte so gar nichts von einem Rettungshund an sich. Das nächstgelegene Haus mit Telefon war das der Bernhardts, aber es würde eine Ewigkeit dauern, bis ein Rettungswagen die Bucht erreichte. Runter zum Strand konnte er sowieso nicht fahren, der Weg war zu schmal. Was sollte ich nur tun? Der Surfer musste ins Warme, so schnell wie möglich. Dann fiel mein Blick auf Stewarts alten Bootsschuppen. Und ich hatte die rettende Idee.
Na ja, vor allem hatte ich unverschämtes Glück. Denn im Sommer bewahrten die Wassersport-Fans aus dem Dorf ihre Surfbretter und Kajaks in dem Schuppen auf. Zu dieser Ausrüstung gehörte auch ein selbst gebauter Karren, mit dem der ganze Kram am Ende der Saison wieder abtransportiert wurde – eigentlich kaum mehr als ein Brett mit Rädern. Der perfekte Krankentransporter.
Mittlerweile hatte die Haut des Surfers einen bläulichen Ton angenommen, der mir wirklich Angst machte. Eilig streifte ich ihm meinen trockenen Anorak über und hievte ihn auf den Wagen. Und dann schob und zerrte ich mit aller Kraft, die mir noch blieb. Das schwierigste Stück war der Anfang, durch den Sand. Dachte ich. Dann kam der steile Weg die Klippen hinauf – und der hatte es echt in sich. Ein paar Mal verlor ich den Halt, rutschte mit den Füßen weg und konnte gerade noch verhindern, dass mir der Karren aus den Händen glitt. Jedenfalls war mir ganz schnell nicht mehr kalt. Snowflake rannte laut bellend um uns herum, als ob er mich anfeuern wollte. Endlich hatte ich die Kuppe erreicht, ab jetzt war der Weg zum Glück eben, sogar leicht abschüssig. Und das Haus der Bernhardts lag schon in Sichtweite.
»Miss Bernhardt! Miss Bernhardt!« Mein Geschrei scheuchte die zwei alten Damen auf, die gerade friedlich im Vorgarten ihre Rosen beschnitten.
»Du meine Güte!«, rief Hildy, die jüngere, und rückte ihre Brille zurecht. »Ist das nicht die kleine Ella?«
Beinahe hätte ich gelacht, schließlich überragte ich die Schwestern inzwischen um einen ganzen Kopf. Aber die beiden begriffen sofort die Lage und verloren keine Sekunde.
»Schnell ins Haus, setz den Kessel auf, wir brauchen heißes Wasser!«, kommandierte Helen, die ältere Schwester. »Und dann ruf den Notarzt!«
»Wird gemacht!« Ohne nachzufragen, ließ Hildy die Rosenschere fallen und verschwand im Haus.
Helen zog rasch die Handschuhe aus und öffnete das Gartentor. »Ein Badeunfall, was? Aber noch am Leben?«
Völlig außer Atem nickte ich.
»Dann los, Mädchen, nichts wie ins Haus mit ihm. Der Ärmste ist ja ganz blau vor Kälte! Einen Moment …« Mit sicherem Griff tastete sie Beine, Arme und Brustkorb des Bewusstlosen ab. »Scheint nichts gebrochen zu sein. Na komm, ich fasse mit an!«
Mühsam schafften wir ihn vom Karren ins Haus.
»Nach oben, ins Gästezimmer! Hier unten haben wir kein Bett!«, befahl Helen.
Die enge Treppe zogen wir den armen Kerl eher hinauf, als dass wir ihn trugen. Noch ein paar Schritte durch den schmalen Flur, dann hatten wir das Gästezimmer erreicht und legten ihn aufs Bett. Hastig zerrten wir ihm den Anorak und das zerrissene, lange Hemd vom Körper.
Dann zögerte ich. Schließlich hatte ich noch nie einem fremden Mann die Hosen ausgezogen – ob bewusstlos oder nicht.
»Na, was hast du denn, Herzchen?« Die alte Dame blickte mich fragend über den Rand ihrer Nickelbrille an. Dann verstand sie, was los war, und schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Das ist doch jetzt wohl zweitrangig, oder?«
Oh Mann, natürlich hatte sie recht. Also zogen wir ihm auch noch die Hose aus, so schnell das eben mit dem nassen Stoff ging. Wobei, eine normale Hose war es gar nicht, sondern irgendein weit geschnittenes, an der Hüfte und den Knöcheln geschnürtes Teil. Er trug auch keine Unterhose im eigentlichen Sinne, eher so etwas wie einen Lendenschurz. Hatte ich schon wieder einen dieser Hipster-Trends verpasst?
Zum Glück war Helen vollkommen beherrscht bei der Sache. Zum Abschluss zauberte sie aus dem schmalen Wandschrank mehrere Decken hervor, in die wir den Bewusstlosen einhüllten.
»Hildy! Was machen die Wärmflaschen? Und wo haben wir das Fieberthermometer?«
»Gleich da!«, schallte es von unten zurück. »Ich hänge beim Notruf noch in der Warteschleife!«
»Wie? Na, das wollen wir doch mal sehen!« Helen Bernhardt drehte sich zu mir, strich energisch ihre Strickjacke zurecht und warf mir einen strengen Blick zu. »Und du, Kleine, ab unter die Dusche! Keine Widerrede!«
Ich hatte keine Widerrede.
Zwei Minuten später stand ich hinter einem mit Rosenblüten bedruckten Duschvorhang und ließ heißes Wasser über meinen Körper laufen. So lange, bis das Kältezittern aufhörte, das Schockzittern anfing und die Tränen kamen. Die Knie wurden mir weich, ich sank in der Wanne zu Boden und heulte mir den Schreck und die Anspannung der letzten Stunde aus dem Leib.
Dann war der Boiler leer. Ich bekam einen Schwall kaltes Wasser ab, der mich aufkreischen ließ und wieder auf die Beine brachte. Ein letztes Mal schniefte ich, atmete tief durch und machte mich ans Abtrocknen. Es klopfte an der Badezimmertür.
»Wenn du so weit bist, Liebes, kannst du das hier erst einmal überziehen«, hörte ich die ältere Bernhardt-Schwester sagen. »Hat Hildy in Hongkong gekauft. Keine Ahnung, was das wieder sollte, wurde noch nie getragen …«
Durch den Türspalt reichte sie mir eine Art Morgenmantel, ein unglaubliches Teil in Dunkelblau und Gold mit aufwendiger Drachenstickerei. Wow. Aber da meine eigenen Klamotten in einem kalten, salzigen Klumpen auf dem Fliesenboden lagen, warf ich mir den Bruce-Lee-Fummel dankbar über. Als ich das Badezimmer verließ, war weder von der einen noch von der anderen Miss Bernhardt etwas zu sehen, doch ich hörte ihre Stimmen im Erdgeschoss. Sie kämpften immer noch mit der Notruf-Warteschleife. Ich tappte den Flur entlang zum Gästezimmer, um nach dem Surfer zu sehen. Vorsichtig öffnete ich die Tür und trat ein.
Er lag noch so da, wie ich ihn verlassen hatte. Regungslos, tief versunken unter einem Berg pastellfarbener Decken und Quilts, den Kopf auf ein Kissen mit Veilchenaufdruck gebettet. Nein, etwas war anders: Zwar sah er noch fahl im Gesicht aus, aber es war nicht mehr diese halb erfrorene bläuliche Blässe, die mich vorhin so erschreckt hatte. Sein Atem ging gleichmäßig und ruhig. Entweder verfügte er über eine bemerkenswerte Konstitution – oder die Bernhardts hatten ganze Arbeit mit ihren Wärmflaschen geleistet. Vermutlich beides.
Leise trat ich an das Bett heran und setzte mich vorsichtig auf die Kante. Mein erster Eindruck hatte mich nicht getrogen: Er musste wirklich ungefähr mein Alter haben. Ich sah in ein ausdrucksvolles Gesicht mit einer geraden Nase und starken Wangenknochen. Mit dem dunklen, leicht gewellten kurzen Haar erinnerte es mich an die Büsten römischer Herrscher, die ich letztes Jahr in einer Berliner Ausstellung gesehen hatte. Kam der Unbekannte vielleicht aus Italien? Seine Lippen waren schmal, aber schön geschwungen.
Der kann bestimmt gut küssen, schoss es mir durch den Kopf.
Whoa, Ella, reiß dich zusammen! Meine innere Stimme verpasste mir einen Tritt in den Hintern. Mädchen, du brauchst echt einen neuen Freund, wenn du schon am Bett eines fast Ertrunkenen an so etwas denkst …
Die Hauptsache war schließlich, dass es ihm offenbar besser ging. Alles andere spielte überhaupt keine Rolle, richtig? Mein Blick fiel auf seine rechte Hand, die unter der Bettdecke hervorschaute. Am Zeigefinger steckte ein großer goldener Ring. War der etwa echt? Statt eines Edelsteins zierte das Schmuckstück eine ovale Scheibe aus Gold mit feinen eingravierten Mustern.
Gerade als ich sie genauer betrachten wollte, hörte ich den Surfer leise aufseufzen. Ich zuckte zurück. Seine Lider flatterten, öffneten sich – und dann blickte ich ihm in die Augen. Sie waren grün. Kein Grasgrün, eher ein Graugrün, aber eine ganz unglaubliche, strahlende Farbe. Wie der Atlantik im Sonnenschein.
Aus so einem Meer müsste mich bestimmt niemand retten, dachte ich versonnen.
Sein Blick schweifte zuerst ziellos in die Ferne, aber dann bemerkte er mich – und fuhr zusammen, als ob man ihm einen Elektroschock verpasst hätte.
»Hey, schon gut.« Ich versuchte, meiner Stimme einen beruhigenden Tonfall zu geben, und legte meine Hand leicht auf die Decken über seiner Brust. »Es ist alles okay. Du warst ein bisschen zu lange im Wasser, aber es ist noch mal gut gegangen. Der Arzt kommt gleich.«
»Nein!«, brachte er hervor. Gehetzt blickte er um sich, stieß meine Hand weg und versuchte, sich aufzurichten. »Nicht … Arzt! Niemand!« Seine Stimme klang heiser, und er sprach mit einem Akzent, den ich nicht einordnen konnte.
»Komm, du musst jetzt ruhig liegen bleiben!«, bat ich. »Verstehst du nicht, das hätte echt übel ausgehen können …« Doch er wehrte sich weiter, erstaunlich kräftig sogar, obwohl ihn sein Kampf mit den Wellen geschwächt haben musste. »Beruhige dich doch! Es ist alles in Ordnung!« Als ich schon dachte, er würde sich wirklich hochstemmen, verließ ihn die Kraft. Sein Atem ging schwerer und er sackte zurück auf das Kissen. »Alles okay. Nur keine Panik«, murmelte ich. »Wir holen einen Arzt, der weiß, was zu tun ist.«
»Nein …« Seine Stimme war nur noch ein Flüstern. Seine Augenlider zitterten, als würde er gleich wieder bewusstlos werden. Aber er kämpfte dagegen an – und plötzlich packte er meine Hand. Er umklammerte sie in einem geradezu eisernen Griff. Ganz dicht heran zog er mich, sodass ich seine unglaublichen seegrünen Augen besser sehen konnte, als mir lieb war. »Niemand … holen!« Noch nie hatte ich einen Tonfall gehört, der so dringlich und verzweifelt ernst war. »Niemand. Niemand. Sie … finden mich. Sie töten mich. Und … dich auch …«
Dann kippte sein Kopf zur Seite und er war wieder bewusstlos. Doch seine Finger umklammerten noch immer meine Hand. Ich hatte Mühe, sie zu befreien.
Oh Mann. Was war hier eigentlich los?