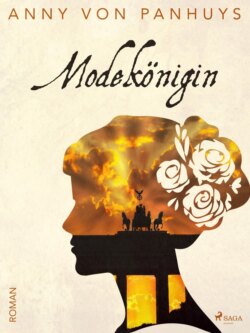Читать книгу Modekönigin - Anny von Panhuys - Страница 13
X.
ОглавлениеIm Osten Berlins, in einer von der Großen Frankfurter Straße abzweigenden Seitenstraße, in einem hohen grauen Mietshause, wohnte Frau Kressin, zu der Emma die Freundin brachte.
Frau Kressin war eine schmale blasse Person von ungefähr vierzig Jahren. Ihre unnatürlich geweiteten Augen hatten den matten Glanz kühler grauer Halbedelsteine.
Sie blickte die beiden Eintretenden flüchtig an, lächelte leicht: „Die jungen Damen möchten gern etwas von dem Liebsten wissen, nicht wahr? Natürlich, natürlich“, fuhr sie fort, „wenn man jung ist, will man nur darüber hören, später sind dann die Kinder und das liebe tägliche Brot das Allerwichtigste.“
Das Zimmer machte einen düsteren Eindruck. Freudlos und kahl sah es aus und es herrschte Dämmerlicht, weil die schwarz und weiß gemusterten Fenstervorhänge halb geschlossen waren.
Elisabeth dachte, dieses ganze Stimmungsmilieu war weiter nichts als das geschickte Mätzchen einer Großstadtsibylle, die dummen Leuten das Geld aus der Tasche lockte.
Nur widerwillig nahm sie neben Emma Platz.
Ein schwarzglasiger und hoher schmaler Stehspiegel ward von dem alten Mann vor die blasse Frau gerückt, ehe er leise das Zimmer verließ.
Frau Kressin starrte in das dunkle Glas, als gelte es alle Geheimnisse der Welt darin zu entdecken. Es war, als ob sie in einen Trancezustand verfiele.
Elisabeth wäre froh gewesen, wenn sie jetzt hätte lachen können.
Es war hier alles so bedrückend. Das düstere Zimmer, die blasse Frau, die schweigend in den schwarzen Spiegel starrte und dabei wie eine Tote aussah.
Wäre es nicht am klügsten und einfachsten, wenn sie Emma ganz energisch bei der Hand nehmen und mit ihr davonlaufen würde?
Jetzt ward der Gesichtsausdruck der starrenden Frau visionär, lautlos bewegten sich ihre Lippen. Plötzlich begann ein mattes Flüstern, aus dem sich einzelne Worte hervorhoben und deutlich wurden.
Elisabeth lauschte und verstand: „Ich sehe ein Schiff mitten auf dem Meere, es ist nur klein und es sind nicht viele Menschen darauf. Einen davon sehe ich sehr, sehr deutlich. Er hält ein kleines Bild in Händen. Ein Mädchenbild, und ich kenne das Gesicht, ich habe es vorhin von ganz nahe gesehen. Es war ein schönes junges Gesicht.“
Elisabeth verspürte gar kein Verlangen mehr, davonzulaufen, gierig lauschte sie auf die Worte der Frau, die schon weitersprach: „Er küßt das Bild und streichelt es. Jetzt aber werden seine Züge finster. Er reißt das Bild mittendurch und nun zerpflückt er es in winzige Fetzen. Er befindet sich in einer Kabine und verläßt sie jetzt mit schnellem Schritt. Ich sehe ihn die Treppe hinaufsteigen, er steht oben auf dem Deck des kleinen Schiffes und läßt die Bildfetzchen ins Meer gleiten. Fort sind sie. Nun lacht er böse, so wie ein sehr zorniger Mann lacht. Eine elegante junge Frau, sie ist blond, tritt an ihn heran. Sie lächelt sehr freundlich und er lächelt auch.“
Elisabeth hatte die Lippen fest zusammengepreßt. Sie bezweifelte keinen Augenblick, was aus dem Munde der blassen Frau kam und ihr war es, als sähe sie alles deutlich vor sich.
Ein langgedehnter Seufzer der Hellseherin ließ Elisabeth erschauern und sie dachte, sie wollte gar nichts mehr hören, gar nichts mehr. Es war genug, nein, es war übergenug.
Jetzt ging es wie ein Zucken über das Gesicht der blassen Frau, ihr Kopf bewegte sich, die Augen blinzelten, als täten sie ihr weh. Sie schien sehr erschöpft.
Endlich sprach sie, während sie Elisabeth dabei ansah: „Ich möchte Ihnen noch Wichtiges sagen.“
Sie erhob sich schwerfällig und nun erkannten die beiden Mädchen, die Ärmste war kreuzlahm.
Wieder wollte sich Elisabeth wehren: „Ich möchte nichts mehr hören!“ und wieder fehlte ihr die Kraft dazu.
Frau Kressin holte ein Kartenspiel hervor. Es waren seltsam gezeichnete Karten. Mit der Hand waren verworrene Bilder darauf gestrichelt. Dünn und fein waren die Bleistiftlinien und -arabesken.
Elisabeth zwang sich, ein wenig verächtlich zu denken: Es steckte hinter der von Emma so besonders Angepriesenen im Grunde doch weiter nichts wie eine Kartenlegerin.
Als hätte die Frau gewußt, was Elisabeth dachte, sagte sie mit ihrer leisen Stimme: „Meine Karten habe ich von meinem Lehrer geerbt. Er war ein alter märkischer Schäfer. Er hat sie noch von seinem Großvater und die Striche darauf mußten schon oft nachgezogen werden. Aus gewöhnlichen Spielkarten kann man nichts herauslesen, das ist Unsinn.“
„Und das hier ist erst recht Unsinn“, empörte sich Elisabeth. Und sie wunderte sich, wie unverständlich sie es murmelte, die Frau hatte es wohl kaum gehört.
Sie hatte es ihr entgegenschreien wollen, aber die Silben erstickten schon, ehe sie noch über die Lippen gekommen.
Sie befand sich zu sehr im Bann ihrer Umgebung.
Frau Kressin setzte sich an einen länglichen Tisch, dessen Platte mit schwarzem Tuch überzogen war und breitete die Blätter in Kartenform in einem Halbkreis aus.
Sie forderte Elisabeth auf, ihr die rechte Hand zu geben.
Elisabeth fand die Situation für Momente lächerlich und reichte der Frau doch die Hand.
Sie konnte einfach nicht anders.
Frau Kressin umspannte die Hand mit leichtem Druck und begann fast flüsternd: „Sie haben großes Leid in der Liebe hinter sich und kommen nicht darüber fort. Der Mann, den Sie lieben, hat in der Heimat etwas sehr Böses erlebt und ist jetzt fort in ein anderes Land. Er reist über das Meer. Eine blonde Frau und ein dunkler Mann sind bei ihm und durch die beiden bedroht ihn schweres Unheil. Die Todeskarte liegt ihm zur Seite und Blut ist um das Schiff, mit dem er fährt —“
Sie brach ab, machte eine kleine Pause und ihre Stimme ward ein wenig lauter: „Sie aber werden — er liegt schon ganz nahe — einen großen Schrecken haben durch ein wunderliches Zusammentreffen, ein Wiedersehen. Die Polizei mischt sich ein —“
Elisabeth entriß der blassen Frau die Hand.
„Hören Sie auf mit dem Unfug, ich mag den Blödsinn nicht mehr hören.“
Sie warf drei Mark auf den Tisch und lief aus dem Zimmer.
Verdutzt und erschreckt folgte ihr Emma.
Erst unten im Hausflur holte sie die Freundin ein. Sie packte sie am Ärmel, hielt sie fest.
„Aber Liliken, warum bist du denn so jetürmt? Die Jeschichte wurde doch jetzt erst interessant!“
Es klang vorwurfsvoll.
„Ach, es war einfach gräßlich, was das dumme Weib zusammenphantasiert hat. Mir tun die drei Mark schon leid, die ich ihr in der Aufregung hinwarf. Meinst du, ich hätte noch mehr von dem Blech vertragen können, mit dem sie mich ja auch glücklich in die Flucht geschlagen hat? Ich habe doch nichts Unrechtes getan, wie darf sie da von der Polizei anfangen? Meinst du, ich hätte Lust, mich in allerlei Ängste hineinjagen zu lassen?“
Emma zuckte mit den Achseln.
„Sie soll den Leuten aber Sachen jesagt haben, die janz jenau einjetroffen sind bis aufs Tüpfelchen. Un ich wollte auch allerhand wissen. Über meinen Apotheker. Ich kann den Kerl zwar nich leiden, aber man möchte doch jerne wissen, woran man is.“
Elisabeth lachte. Aber ihr Lachen klang schwerfällig, als wäre es mit Ketten belastet.
Sie meinte noch immer die blasse Frau mit den mattglänzenden Augen sagen zu hören: „Die Todeskarte liegt ihm zur Seite und Blut ist um das Schiff, mit dem er fährt —!“
Sie erschauerte trotz allen Wehrens von einer geheimen Angst, die sich in ihr festhängte.
„Du siehst verflixt jrau aus, Liliken“, stellte die gutmütige Emma fest. „Komm, wir trinken auf den Schreck ’ne jute Tasse Kaffee. Da drüben is ’ne Konditorei.“
Sie schob ihren Arm unter den Elisabeths und zog sie mit sich über den Fahrweg.
Es war eine einfache, aber sehr saubere Konditorei mit ein paar kleinen Nischen aus dünnem Staketenzaun, von künstlichem wildem Wein umsponnen.
Da saßen sie nun beide in einer der Nischen, tranken Kaffee, hatten je ein Stück Napfkuchen vor sich und sprachen scheu und in leisen Sätzen von dem Besuch bei Frau Kressin.
Emma tadelte: „Du hättest die Frau wenigstens ausreden lassen sollen.“
Elisabeth verteidigte sich: „Das war mir unmöglich. Erst macht sie die unheimlichen Andeutungen von dem Schiff, die natürlich Unsinn sind, und dann fängt sie an, mir die Polizei anzudrohen. Wenn sie so weiterphantasiert hätte, wäre ich wahrscheinlich noch ins Zuchthaus gekommen. Ich bin durch alles, was mit Heino zusammenhängt, innerlich verstört genug, den geheimnisvoll scheinenden Unfug, den sich die Frau leistete, habe ich schon viel zu lange mitangehört.“
Ihr Blick glitt unwillkürlich zur Ladentür schräg gegenüber.
Mehrmals schon hatte Elisabeth Kunden eintreten sehen. Sie kauften eine Kleinigkeit und gingen gleich wieder. Eben trat eine sehr schmale Person ein im schlichten Hauskleid und gestreifter Kattunschürze.
Elisabeth zuckte so stark zusammen, daß es Emma nicht entging.
„Was machst du denn mit einemmal für ’n komisches Jesicht, Liliken?“ fragte sie fast laut.
Elisabeth faßte nach Emmas Hand.
„Still, ganz still“, flüsterte sie, „und guck nicht nach dem Ladentisch. Halte aber Geld zum Zahlen bereit, wir müssen der Frau, die sich eben Kuchen einpacken läßt, nach, müssen herausbringen, wo sie wohnt, ohne daß sie was davon merkt. Drehe den Kopf nach der anderen Seite, damit sie uns nicht erkennt, falls sie hersieht.“
Alles klang kurz und abgerissen.
„Was willst du denn von der Frau, hat sie dir was getan?“ wisperte Emma.
Sie äugte neugierig dorthin, wo sich das Mädchen mit der dicken Konditorsfrau unterhielt.
Sie brummte: „Du bist überreizt, Liliken. Warum sollen wir denn der Frau nachlaufen? Das wäre doch verrückt.“
Elisabeth flüsterte: „Wir müssen wissen, wo sie wohnt, es ist doch die —“ Ihre Stimme war kaum noch hörbar, als sie schloß: „Die Schwindlerin, die Frau Weilert so böse hineingelegt hat.“
„Die Maharadscharin —??“ Emmas etwas lautes Flüstern erstarb jäh, denn Elisabeth hielt ihr energisch den Mund zu.
Dafür suchten sich ihre Augen zu entschädigen. Sie hingen an der Frau, die vor dem Ladentisch stand und sich noch immer unterhielt.
„Guck doch, bitte, nicht mehr hin“, mahnte Elisabeth, „Wenn wir ihr auffallen, verderben wir alles.“
Kaum spürte Emmas Mund wieder seine Freiheit, raunte er: „Du irrst dir, Liliken, mach wejen einer kleinen Ähnlichkeit keine Dummheiten.“
„Es ist die Hauptschwindlerin selbst“, gab Elisabeth leise zurück.
Eben verließ die Verdächtige den Laden.
Elisabeth sprang auf.
„Bleibe hier, Emma, es ist weniger auffallend, wenn ich ihr allein nachgehe.“
Emma nickte: „Jawohl, Liliken, mit der Verrücktheit möchte ich auch nix zu tun haben. Ich warte hier, bis du zurück bist. Merke dir man jenau die Konditorei.“
Elisabeth hatte gar nicht mehr zugehört, sie stand schon an der Ladentür, die ein gelles Läuten ertönen ließ, als sie das blonde Mädchen öffnete.
Emma überlegte.
So unmöglich ihr die Behauptung der Freundin auch im ersten Augenblick vorgekommen, so möglich erschien sie ihr jetzt schon.
Jedenfalls bestand wirklich sehr große Ähnlichkeit zwischen der einfachen Frau und der Schwindlerin. Es gab hier in Berlin wohl nicht allzu viele Gesichter von so eigenartig fremdländischem Aussehen. Und es kamen oft so sonderbare Dinge vor in der Riesenstadt, daß man sich über gar nichts zu verwundern brauchte.
Sie bestellte sich ein Stückchen Torte, und als es ihr die Konditorsfrau brachte, fragte sie: „Kennen Sie vielleicht die hübsche schmale Frau, ich meine, die so ’n Zijeunerjesicht hat und ein jroßes Paket Kuchen einkaufte? Sie hat nämlich Ähnlichkeit mit einer alten Bekannten von meiner Freundin und mir. Sie ist ihr deshalb nachjelaufen. Bis wir uns darüber einig waren, ob sie’s sein könnte oder nich, war sie schon losjejondelt.“
Die Besitzerin der Konditorei lächelte wohlwollend.
„Sie wohnt noch nicht lange in der Gegend hier, aber sie ist schon eine von unseren allerbesten Kunden. Sie bewohnt genau gegenüber von uns, auf der anderen Straßenseite, die Etage über’m Blumengeschäft. Zusammen mit ihrer Tante. Sie vermieten Zimmer und es wohnen zwei Herren bei ihnen.“
Sie entfernte sich wieder, zwei Kunden waren eingetreten.
Emma bezweifelte Elisabeths Scharfblick nicht mehr. Die Dunkelhaarige war die Inderin gewesen; die hier als Tante galt, spielte bei Frau Weilert wohl die Gesellschafterin und die beiden Pensionäre hatten sicher in den Rollen des Maharadschas und seines Sekretärs gastiert.
Jetzt hatte auch Emma die Unruhe gepackt. Sie zahlte und wartete auf der Sraße auf Elisabeths Rückkehr.
Bald kam sie denn auch. Ihre Erregung war unverkennbar.
Sie berichtete: „Der Name Weber steht an der Korridortür da drüben im ersten Stock, hinter der die Person verschwunden ist. Ich holte sie noch ein und war nur eine halbe Treppe hinter ihr. Sie dachte aber gar nicht daran, sich umzugucken. Als die Korridortür aufging, hörte ich eine Männerstimme. Es war bestimmt die knarrende Stimme vom Maharadscha.“
„Wir müssen sofort auf die nächste Polizeiwache“, entschied Emma.
Elisabeth nickte: „Natürlich, das müssen wir.“ Dann meinte sie nachdenklich: „Nun stimmt das doch mit der Polizei, die komischen Karten mit dem Bleistiftgeschnörkel haben recht behalten.“
„Siehst du!“ triumphierte Emma. „Hättest du die Kressin ausreden lassen, Liliken, wüßten wir nu vielleicht mehr un könnten die Jeschichte janz anders anpacken!“
Auf dem ziemlich nahen Polizeirevier hörte man die beiden aufmerksam an und setzte sich dann telefonisch mit Frau Weilert in Verbindung.
Zwei Stunden später befand sich der „Maharadscha mit Gattin, Gesellschafterin und Sekretär“ bereits unter der Obhut der Polizei, ebenso ein großer Koffer mit hocheleganten Toiletten, die ihre Herkunft aus Frau Weilerts Ateliers nicht verleugnen konnten.
Man hatte bei der Haussuchung auch einige ungemein kostbare Schmuckstücke gefunden, die aus einem erst kürzlich begangenen Juwelenraub stammten.
Jedenfalls hatte die Polizei mit dem vierblättrigen Kleeblatt einen guten Fang gemacht.
Als Elisabeth der falschen Inderfürstin gegenüberstand, funkelten sie die nachtdunklen Augen an und das bräunliche Gesicht entstellte Wut.
„Nimm dich in acht vor mir, blonde Kröte, ekelhafte Spionin, und behalte es gut im Gedächtnis, das hast du uns nicht umsonst getan. Wenn ich wieder frei bin, dann wehe dir!“
Der Kommissar befahl ihr grob, sie möge den Mund halten.
Frau Weilert, die ihre wertvollen Modelle in tadellosem Zustand zurückerhielt, freute sich sehr und konnte gar nicht liebenswürdig genug zu den beiden Mädels sein. Sie vergab ihnen lächelnd den kleinen Schwindel, daß sie unter dem Vorwand, Elisabeth fühle sich nicht wohl, im Osten Berlins herumgebummelt waren.
Elisabeth aber war von dem Tage an, den Frau Weilert einen Glückstag nannte, in tief niedergedrückter Stimmung. Die Drohung der Fürstin von eigenen Gnaden war nicht geeignet, ihre Nerven zu beschwichtigen, die seit dem Besuch bei der Hellseherin unaufhörlich schwangen.
Frau Weilert schenkte Elisabeth ein sehr elegantes Herbstkostüm zur Belohnung, Emma erhielt einen Mantel.
Ein paar Tage nach der Verhaftung der Gauner meinte Frau Weilert, nun wäre es bald soweit, die Wahl der Modekönigin stände dicht bevor.
„Sie müssen sich von jetzt ab mehr als je pflegen, Kindchen“, riet sie, „Sie müssen mit Ihrem Körper und Gesicht umgehen wie mit einem Heiligtum. Sie sollten auch morgens und abends die stumpfsinnige Eisenbahnfahrt nicht mehr machen. Wenigstens vorläufig nicht. Ich räume Ihnen bei mir ein Zimmer ein, sprechen Sie, bitte, mit Ihrer Mutter darüber.“
Elisabeth freute sich über das Angebot.
Sie fühlte sich zu Hause nicht besonders wohl. Trotz aller Mühe, die sie sich gab, blieb ihr der Vater noch immer ein Fremder.
Die Mutter aber ging völlig in seinen Wünschen auf.
Als Elisabeth zu Hause von dem Angebot sprach, verwahrte sich Robert Tann sehr lebhaft: „Das gibt es nicht, das ist ausgeschlossen. Die Schneidermadame soll dich nicht beherbergen. Das Recht, unserem Kind ein Daheim zu bieten, lassen wir uns nicht nehmen, nicht wahr, Martheken?“
Martha Tann hatte sich durch das Glück, den geliebten Mann wiederzuhaben, beinahe zur jungen Frau zurückverwandelt. Sie kleidete sich modern und nett und das Lächeln wich jetzt nie von ihrem Gesicht.
„Bleibe bei uns, Liesel“, bat sie, „wir haben eine herrliche Wohnung in Aussicht.“
Elisabeth erklärte, ihr Aufenthalt bei Frau Weilert würde ja nur vorübergehend sein und die Hin- und Herfahrerei strenge sie ziemlich an. Da gab man nach.
Elisabeth bezog nun in der großen Wohnung der bekannten Modekünstlerin ein sehr hübsches und bequemes Zimmer. Morgens erschien bei ihr zuerst die Masseuse, ein Weilchen später der Friseur, der auch Gesichtsund Handpflege übernommen hatte.
Elisabeth wurde von Frau Weilert wie eine Kostbarkeit von unschätzbarem Wert behandelt. Sie sah in ihr schon die gekrönte Modekönigin von Berlin. Elisabeth war noch zu jung, um nicht schließlich doch etwas eitel darauf zu werden, daß solch Kultus mit ihr getrieben wurde. Sie war der Mittelpunkt des Weilertschen Modesalons, um ihre Person drehte sich jetzt hier alles.
Frau Weilert ging oft mit ihr des Abends aus. In vornehme Restaurants, ins Theater, in Kabarette. Und Elisabeth trug bei den Gelegenheiten die erlesensten Kleider und Mäntel.
Die geschäftstüchtige kluge Frau Weilert machte dadurch das junge schöne Mädchen schon zur Modekönigin, ehe noch die Wahl stattgefunden.
Ein so wundervolles und auffallendes Geschöpf wie Elisabeth Tann konnte nicht unbemerkt bleiben. Wohin sie kam, erregte sie Aufsehen.
Sie fragte sich selbst oft ganz naiv, wie war es nur möglich, daß Heino sie hatte verlassen können? Sie, die überall von neidischen Blicken der Damen und begehrlichen Blicken der Herren verfolgt wurde.
Sie wehrte sich jetzt mit aller Macht gegen ihre Liebe, die noch oft so gebieterisch und stürmisch aufbegehrte.
Sie schob auch immer wieder die Erinnerung zurück an das, was die Hellseherin gesagt hatte.
Sie wollte nicht daran denken.
Sie glaubte weder das, was die arme Kreuzlahme in dem schwarzen Spiegel gesehen haben wollte, noch das, was sie aus den Karten herausgelesen hatte.
Vielleicht stimmte es, daß sich Heino Staufen zur Zeit wirklich auf einem Schiff befand.
Dann wünschte sie von Herzen, er möchte sein Bestimmungsziel gut erreichen. Seine und ihre Wege würden doch niemals mehr zueinander führen. Sie würde ihn nie Wiedersehen, damit mußte sie sich endgültig abfinden.
Mit all ihrem Stolz mußte sie die Sehnsucht in sich bekämpfen, mit all ihrem Stolz. Denn sie war nicht so schuldig, daß er sie so hart strafen durfte, so grausam hart, mit dem Verluste seiner Liebe.
Sie lebte jetzt wie ein verwöhntes Prinzeßchen und Emma meinte neckend: „Wenn du nich Modekönigin werden solltest, bereitest du unserer Ollen die jrößte Enttäuschung ihres Lebens. Ich jlaube, dann bricht ihr das Herz vor Verzweiflung.“
Die Zeitungen interessierten sich schon für Elisabeth, Modeblätter brachten ihr Bild mit der Unterschrift: „Das schönste und graziöseste Mannequin von Berlin, vielleicht von ganz Europa!“
Filmregisseure warfen auch schon ihre Netze nach der bezaubernden Blondine aus.
Frau Weilert war äußerst zufrieden, der Boden für die „Modekönigin“ war gut vorbereitet.