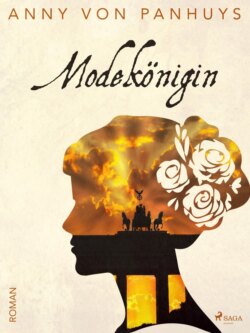Читать книгу Modekönigin - Anny von Panhuys - Страница 7
IV.
ОглавлениеDie Firma Mosbach war noch geschlossen, als Elisabeth ihr Ziel erreicht hatte. Sie mußte noch beinahe eine Viertelstunde warten, bis Leonhard Mosbach erschien und selbst die Bureauräume aufschloß.
Er war stets der erste hier morgens, aber auch der letzte, der abends fortging.
Elisabeth kannte den reichen Getreidehändler vom Ansehen und nachdem er ein Weilchen das Haus betreten, eilte sie ihm nach.
Mosbach hatte gerade die Rolläden hochgezogen, als es an die Tür des Büros klopfte.
Er zog verwundert die halbmondförmig gewachsenen Brauen hoch, deren Form seinem Gesicht ständig den Ausdruck leichten Erstaunens gab.
„Nanu, wer kommt denn da schon?“ murmelte er verwundert.
Seine Angestellten pflegten doch nicht zu klopfen und es war auch noch gar nicht so spät, daß er sie erwarten konnte.
Er rief laut „Herein!“ und riß die Augen auf, als nun ein wunderschönes Mädchen zur Tür hereinspazierte.
Leonhard Mosbach schritt ihr entgegen und erkundigte sich mit ganz besonderer Höflichkeit nach den Wünschen der frühen Besucherin.
Elisabeth blickte den sehr kleinen, auffallend breitschulterigen Mann bittend an.
„Herr Mosbach, wenn Sie ein wenig Zeit hätten, wäre ich Ihnen für eine kurze Unterredung sehr dankbar“, begann sie.
Sie hatte sich den Satz der Einleitung vorher zurechtgelegt.
Mosbach erwiderte galant: „Für schöne junge Damen habe ich immer etwas Zeit übrig.“
Er öffnete vor ihr die Tür zu seinem Privatkontor, das ziemlich nüchtern, aber bequem eingerichtet war.
Die Glanzstücke darin waren ein riesiger Schreibtisch und zwei braunlederne Klubsessel.
In den einen davon nötigte er die Besucherin, in dem anderen nahm er selbst Platz. Er blickte Elisabeth unaufhörlich an und begriff nicht, daß es so wunderschöne Menschenkinder gab, wie diese junge fremde Dame, die ihn anscheinend kannte, weil sie ihn gleich mit seinem Namen angesprochen.
Elisabeth holte tief Atem.
„Ich heiße Elisabeth Tann, und ich habe mir erlaubt, Sie aufzusuchen, Herr Mosbach, um mit Ihnen über Heino Staufen zu sprechen. Ich möchte Sie nämlich so recht, recht sehr bitten, alles aufzubieten, damit ihm kein weiteres Unrecht zugefügt wird.“
Leonhard Mosbach blickte sehr interessiert.
Dieser vermaledeite Gauner Staufen hatte Glück, dachte er, daß ein so entzückendes Mädchen für ihn bat.
„Was kann ich für Sie tun?“ fragte er und betonte das „Sie“ besonders. „Für Staufen rühre ich keinen Finger, er ist ein Dummkopf. Wenn ich auch der Geschädigte bin, ärgert es mich fast, wie blöde er die Geschichte angefangen hat.“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Sie irren, Herr Mosbach, Heino ist kein Betrüger. Und Sie selbst müßten doch davon am meisten überzeugt sein. Er arbeitet doch seit drei Jahren in Ihrem Geschäft.“
Mosbach lächelte ein wenig, seine wulstigen Lippen zogen sich dabei in die Breite.
„Das sagt gar nichts! Und wenn er zehn Jahre in meinem Geschäft gearbeitet hätte! Man kennt doch seine Angestellten nicht. Was weiß ich, was für aufrührerische Gedanken die Leute haben, die mir grundbrave Biedermänner vormimen. Wissen Sie, zwanzigtausend Mark sind kein Pappenstiel, und wenn einer Gelegenheit hat, soviel Geld an sich zu bringen, bezweifle ich nicht, daß er es tut. Auch Staufen traue ich es zu.“
Elisabeth richtete sich etwas auf.
„Das dürfen Sie aber nicht, Herr Mosbach, nein, das dürfen Sie nicht. Heino Staufen ist grundehrlich, er würde nicht einmal eine Stecknadel unterschlagen.“ Ihre Stimme ward eindringlich: „Sie könnten ihm Ihr gesamtes Vermögen anvertrauen, es wäre sicher und gut bei ihm aufgehoben.“
„Nun, den Beweis dafür hat er erbracht, nicht mal die Zwanzigtausend waren bei ihm sicher“, erwiderte Leonhard Mosbach etwas ärgerlich. „Der Himmel erhalte Ihnen Ihre Kindlichkeit.“ Er nahm eine väterliche Miene an. „Nun reden Sie aber mal: Warum legen Sie sich für Staufen so ins Zeug? Er ist Ihr Liebster, nicht wahr?“
„Er ist mein Bräutigam, Herr Mosbach, wenn wir auch nicht öffentlich verlobt waren“, entgegnete sie, „und ich darf es nicht dulden, daß man ihn einer gemeinen Handlung beschuldigt.“
Ihr fiel es selbst auf, wie schroff ihre Antwort geklungen und sie dachte, wie töricht von ihr, sich so gehen zu lassen, sie wollte sich doch mit Mosbach gut stehen. Er konnte doch am meisten für den Geliebten tun.
Sie fuhr ganz klein und bittend fort: „Wenn Sie bei der Polizei gut von Heino Staufen sprechen, Herr Mosbach, wird man den Verdacht gegen ihn fallen lassen.“
Leonhard Mosbach antwortete nicht gleich, aber er blickte das Mädchen, das ihm gegenüber saß, nur durch ein kleines Tischchen von ihm getrennt, mit verlangenden Augen an.
Ein wundervoll schöner Schmetterling war ihm an diesem Sommermorgen in sein nüchternes Kontor geflogen.
Leonhard Mosbach war fünfzig Jahre, er hatte das gutgehende Geschäft vom Vater geerbt, es durch eisernen Fleiß bedeutend vergrößert, sich aber nie viel Zeit genommen, an sein persönliches Vergnügen zu denken.
Seine Frau war dick und gehörte zu jener unangenehmen Klasse der Weiblichkeit, die sich stets beleidigt fühlt, und er amüsierte sich manchmal ein bißchen in Berlin mit Kellnerinnen und Bardamen dritter Ordnung, fühlte sich dann als Lebemann.
Jetzt durchzuckte ihn der Gedanke, es müsse tausendmal angenehmer sein, so ein wundervolles Geschöpf wie Elisabeth Tann in den Arm nehmen und küssen zu dürfen.
Er nahm einen sehr freundlichen Ton an, wechselte aber das Thema.
„Sie heißen Tann, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe. Sagen Sie, sind Sie irgendwie mit dem früheren Bauunternehmer Robert Tann verwandt?“
Elisabeth neigte leicht den Kopf.
„Ja, ich bin seine Tochter. Aber ich weiß gar nichts von meinem Vater, er ist verschollen.“
Mosbach dachte: Also die Tochter des Bankerotteurs war sie! Er durfte danach wohl annehmen, daß sie nicht gerade auf Rosen gebettet war.
Er lächelte: „Ich kaufte neulich die frühere Villa Ihres Vaters und werde sie im Herbst beziehen. Das ist doch interessant, nicht wahr?“
Elisabeth fand die Mitteilung nicht im mindesten interessant. Ihr schien der Gedanke eher häßlich, daß dieser plumpe unangenehme Mensch das Haus bewohnen würde, in dem sie ihre sorglosen Kinderspiele gespielt.
Sie erwiderte dennoch: „Gewiß, das ist sehr interessant.“ Dann aber sprang sie auf das alte Thema zurück, behielt den ergebenen, bittenden Ton von zuletzt bei.
„Sie waren hoffentlich niemals unzufrieden mit Heino Staufen, Herr Mosbach, nicht wahr? Oder doch? Bitte, seien Sie ehrlich. Ich wäre Ihnen sehr, sehr dankbar für Ihre Antwort.“
Mosbach schmunzelte.
„Ihre Dankbarkeit möchte ich mir schon verdienen, Fräulein Tann. Also, ich war sogar sehr zufrieden mit ihm.“
Elisabeth atmete ein wenig freier.
„Nun, Herr Mosbach, wenn das der Fall ist, dürfen Sie auch kein Mißtrauen gegen ihn hegen. Sie müssen ihn entlasten. Wenn Sie auf der Polizei erklären, Sie glauben, Heino Staufen hat den Umschlag mit dem Geld tatsächlich auf die Weise verloren, wie er angibt, wird er freigegeben werden. Und wenn es der Polizei nicht gelingt, den Menschen aufzuspüren, der das Geld fand und unterschlug, werden Heino und ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ihn aufzuspüren. Irgend jemand muß doch das Geld haben.“
Auf Leonhard Mosbachs Stirn lag eine dicke Falte der Mißstimmung.
„Sie muten mir ein wenig allzu viel Nächstenliebe zu von der Sorte, wenn mir jemand einen Schlag auf die rechte Wange gibt, müsse ich ihm die linke auch hinhalten. Sie muten mir, klarer gesprochen, ganz einfach eine Dummheit zu. Ich habe doch vorgestern nachmittag, als man mich auf die Polizei rief, erklärt, ich hätte es zwar niemals geglaubt, daß mich Staufen derartig beschwindeln könnte, so gemein, so niederträchtig, aber ich habe auch zugleich erklärt, ich bezweifle keine Sekunde, daß er das Geld unterschlagen hat und seine Erzählung Schwindel ist.“
Er rieb seine breiten Hände, die wie Schaufeln waren, energisch aneinander.
„Wenn ihn die Polizei mürbe macht, ihn ordentlich in Angst jagt mit ihrem Ausfragesystem, gesteht er schließlich wahrscheinlich doch, wo er das Geld gelassen hat. Und es kommt doch für mich darauf an, das Geld wiederzukriegen. Ich wäre ja ein Narr, wenn ich mich um seine Freilassung bemühen würde. Außerdem weiß ich nicht einmal, ob es ginge. Nein, Fräulein, den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun. Mir liegt vor allem daran, mein Geld wiederzukriegen.“ Sein Gesicht erhellte sich. „Wenn ich dagegen Ihnen persönlich einen Gefallen erweisen könnte, bin ich dazu sofort bereit. Sie müssen nämlich wissen, Fräuleinchen, ich bin ’ne Seele von Mensch. Machen Sie Ihrem Herzen Luft, ich würde mich freuen, mich für Ihre persönlichen Wünsche interessieren zu dürfen.“ Seine Stimme bekam einen heiseren Beiklang. „Lassen Sie den Bruder Leichtsinn laufen, trauern Sie dem nicht nach. Sie haben das nicht nötig mit Ihrem Aussehen.“
Er setzte sich in Positur.
„Man ist leider nicht mehr jung, aber man kann sich sehen lassen und das Beste, man ist so situiert, einem netten Mädelchen ab und zu was Hübsches zu schenken.“
Er erhob sich, während Elisabeth wie gelähmt dasaß.
Auf diese Wendung des Gesprächs war sie nicht vorbereitet gewesen.
Er trat näher.
„Sie sind reizend, Kindchen, ganz reizend, viel zu schade für einen solchen Schwindler, wie es Staufen ist!“
Er blinzelte: „Sie sind eine süße Krabbe, ein entzükkendes Pusselchen. Wie wäre es mit unserer Freundschaft? Sie sollten es nicht bereuen.“
Die Schaufelhände streckten sich nach ihr aus, während er lachte: „Komm, Püppchen, gib mir einen Kuß als Vorschuß.“
Elisabeth, die noch eben wie gelähmt dagesessen, erhob sich blitzgeschwind und stieß den Zudringlichen zurück.
„Fassen Sie mich nicht an, Sie ekelhafter Mensch, sonst schreie ich so laut um Hilfe, daß die ganze Nachbarschaft zusammenläuft.“
Ihre Augen funkelten drohend und sie schienen im Zorne fast schwarz. Ihr Gesicht glühte, ihr Atem flog.
Nebenan hörte man eben laut eine Tür schließen.
Auch Leonhard Mosbach hörte es und er trat sofort zurück, sagte so laut, daß man es nebenan im Büro hören mußte: „Es tut mir leid, ich kann nichts für Staufen tun. Der Kerl hat mich um zwanzigtausend Mark geprellt.“
Er lächelte höhnisch, als er leise fortfuhr: „Seien Sie nur vorsichtig, man kann nicht wissen, ob Sie nicht selbst die beste Auskunft geben könnten, wo das Geld geblieben ist.“
Da schlug Elisabeth, ihrer selbst nicht mehr mächtig, dem Schandkerl in das feiste höhnische Gesicht.
Im nächsten Augenblick aber stand sie mit schlaff niederhängenden Armen da.
Wozu hatte sie sich hinreißen lassen!
Der Schlag war nicht allzu kräftig gewesen, aber die Wut des Mannes war grenzenlos. Tücke lag in seinem Blick.
„Vielleicht kommt der Tag, an dem ich Ihnen das von eben böse heimzahlen kann“, knirschte er. Dann schrie er sie überlaut an: „Nun aber raus mit Ihnen, Sie haben mich schon zu lange von der Arbeit abgehalten.“
Elisabeth Tann wagte keine Silbe zu erwidern. Trotzdem sie von Leonhard Mosbach beleidigt worden war, sie und Heino, kam sie sich schuldig vor.
Sie war hierhergekommen, um dem Geliebten zu helfen und hatte sich so ungeschickt benommen.
Leonhard Mosbach hatte den Schlag nicht einmal, sondern zehnmal verdient, aber sie hatte Heino und sich einen erbitterten Feind geschaffen.
Sie mußte im Nebenraum an dem ersten Buchhalter und an einer Stenotypistin vorbei, die eben beide mit ihrer Arbeit beginnen wollten.
Neugierige Blicke trafen sie.
Als sie eben zur Tür hinausging, die auf den Hausflur führte, hörte sie die Stimme Mosbachs, der ihr ein Stück gefolgt sein mußte, zu den beiden sagen: „Das war dem Schwindler Staufen sein Liebchen. Sie sieht aus wie ein recht lockeres Vögelchen, nicht wahr?“
Wie gejagt stürzte Elisabeth aus dem Hause, das sie so hoffnungsvoll betreten.
Die frische Luft draußen brachte sie wieder etwas zu sich, sie war ja völlig betäubt gewesen von dem Erlebten.
Sie wanderte ein paarmal langsam die stille Gartenstraße auf und ab, ehe sie sich entschloß, zur Polizei zu gehen.
Sie fragte, ob sie Heino Staufen sprechen dürfe.
Ein Polizist erklärte ihr, der befände sich in Untersuchungshaft und sie müsse nach dem Gefängnis gehen. Er nannte ihr den Namen des Kommissars, der die Untersuchung des Falles führte und diesen Vormittag im Gefängnis anzutreffen sein würde. Bei ihm sollte sie sich melden lassen.
Das war ein schwerer Weg, ein wahrer Golgathaweg für Elisabeth Tann.
Im Ohr klangen ihr noch die Unverschämtheiten Mosbachs nach und nun mußte sie Heino im Gefängnis aufsuchen.
Sie hatte geglaubt, er säße in irgendeiner Art von möbliertem Zimmer des Polizeigebäudes, wo das Meldeamt war.
Aber auch der schwerste Weg nimmt einmal ein Ende, und ihre junge, sieghaft blonde Schönheit nötigte selbst dem etwas grimmig dreinschauenden Kommissar ein freundliches Gesicht ab.
Er bot ihr einen Stuhl an und sie war froh, sich setzen zu dürfen. Gar so erschöpft war sie von ihren Sorgen und Ängsten.
Sie sagte schlicht: „Ich habe Heino Staufen sehr lieb, Herr Kommissar, wir sind heimlich verlobt. Das heißt, meine Mutter weiß es und unsere näheren Bekannten auch. Im Oktober sollte Heino mehr Gehalt bekommen, dann wollten wir heiraten.“ Eindringlich fuhr sie fort: „Heino ist durch und durch ehrlich, er hat das Geld bestimmt auf die Weise verloren, wie er erklärt hat.“
Sie blickte den scharfnasigen Herrn bittend an.
„Glauben Sie alles, Herr Kommissar, was er sagt. Er ist wahr und aufrichtig. Sehen Sie, an dem Tage, an dem er das Unglück mit dem Geld hatte, also vorgestern, trafen wir uns mittags nach der Arbeitszeit, wie schon oft zuvor, und Heino erzählte mir, er müsse für seinen Chef zwanzigtausend Mark bei der Firma Klymann abgeben. Und dann“, sie stockte flüchtig, „dann zankten wir uns, Herr Kommissar. Mir wurde in einem Berliner Modesalon eine Stellung angeboten für das dreifache Gehalt wie hier im Atelier Vollhard. Das hatte ich ihm mitgeteilt und davon wollte er nichts wissen. Schließlich wurde er so wütend, daß er mich stehen ließ und ganz aufgeregt davonlief. Er ist eben manchmal ein bißchen heftig. In seinem Zorn vergaß er das Geld abzugeben und rannte in den Stadtwald, dachte nicht daran, welchen Wert er bei sich trug. Es ist ja alles so klar, Herr Kommissar. Bitte, lassen Sie nur nachforschen, wer gestern außer Heino noch im Stadtwald gewesen ist! Auf diese Weise findet man ihn dann, der das Geld unterschlug.“
Der Kommissar lächelte heimlich über den Vorschlag. Man hatte auch ohne den Ratschlag des schönen Mädchens schon alles in Bewegung gesetzt, um des Geldes wieder habhaft zu werden, wenn Staufens Angaben Glauben verdienten.
Was dieses aufgeregte schöne Mädchen erzählte, wirkte wahr, und es schien ihm durchaus möglich, daß Staufen in seinem Liebeszorn das Geld abzugeben vergaß und im Walde damit herumlief, bis er es verlor.
Elisabeth fragte leise und bescheiden: „Darf ich Heino Staufen vielleicht sprechen, Herr Kommissar?“
Der scharfnasige Herr sah keinen Grund dazu, die Erlaubnis zu verweigern.
Er nickte: „Ich will es erlauben. Sie können ihn hier sprechen, ich lasse ihn holen.“
Er klingelte und gab dem eintretenden Schutzmann einen Befehl.
Elisabeth flog innerlich förmlich vor Erregung.
Nun würde sie Heino wiedersehen.
Ob er sich über ihr Kommen freuen würde?
Sie hoffte es bestimmt.
Wie er ihr leid tat, der Ärmste! Was mußte er seit vorgestern gelitten haben!
Die Tür öffnete sich, der Schutzmann ließ Heino Staufen an sich vorüber eintreten.
Elisabeth sprang auf und stürzte auf ihn zu. Sie vergaß völlig, daß sie sich beide nicht allein befanden.
Schon hing sie am Halse Heinos, der sehr bleich aussah.
Seine Augen strahlten sie an.
„Liesel, wie lieb von dir, daß du zu mir gekommen bist. Das vergesse ich dir nicht! Du ahnst ja nicht, wie sehr ich mich nach dir gesehnt habe. Daß ich neulich gleich so wütend war, dafür wurde ich hart bestraft.“ Seine Stimme wurde unsicher vor Erregung. „Man glaubt, ich hätte das Geld unterschlagen! Was sagst du dazu?“
Elisabeth legte ihre Wange gegen die seine.
„Ich sage, wenn es nicht so ernst und traurig wäre, müßte man darüber lachen. Aber laß den Mut nicht sinken, Liebster, deine Unschuld muß sich herausstellen.“
„Das hoffe ich natürlich auch“, gab er zurück, „aber manchmal packt mich die Verzweiflung.“
„Ich wäre schon eher zu dir gekommen“, erklärte sie, während ihr Gesicht noch immer dicht an dem seinen lag, „aber ich habe erst gestern abend von deiner Verhaftung gehört. Als ich von Berlin zurückkam, erfuhr ich es von Mutter. Gestern abend.“
Er nahm ihre Arme von seinem Hals und sie an den Handgelenken festhaltend, fragte er: „Was hast du denn in Berlin getan?“
Sie war sehr rot geworden und sah aus, als hätte sie ein ganz böses Gewissen.
Er preßte ihre Hände fester.
„Du hast doch nicht etwa die Stellung in dem Berliner Modesalon angenommen?“
Die letzten Worte drängten sich unwillig durch seine Zähne. Es klang wie ein Knirschen.
Der Kommissar beobachtete die Szene aufmerksam. Die beiden schienen sich gar nicht seiner Gegenwart zu erinnern.
Das schöne Mädchen tat ihm leid, Staufen benahm sich zu herrisch zu dem armen Ding.
Ob er sich einmischen sollte?
Aber wer weiß, ob er dem Paar damit einen Gefallen erwies.
Elisabeth verharrte noch immer in Schweigen und überlegte, ob sie lügen sollte.
Er erriet wohl ihre Gedanken.
„Wahrheit verlange ich! Hast du etwa die Stellung angenommen?“
Er preßte ihre Handgelenke so stark, daß sie am liebsten laut aufgeschrien hätte.
Sie stotterte: „Weil du dich nicht mehr sehen ließest und ich meinte, du wolltest nichts mehr von mir wissen, nahm ich die Stellung an. Aber ich will sie sofort wieder aufgeben.“
Er stieß sie so plötzlich zurück, daß sie taumelte.
„Also doch!“ empörte er sich. „Hast der Verlockung nicht widerstehen können! Aber ich denke und hoffe, die blendende Aussicht, vielleicht Modekönigin von Berlin zu werden, entschädigt dich reichlich für die Liebe eines Menschen, mit dem du sowieso keinen Staat mehr machen könntest.“
Er schritt auf den Kommissar zu.
„Ich möchte mich nicht weiter mit der Dame unterhalten, sie und ich haben uns nichts mehr zu sagen.“
Der Kommissar war empört.
Elisabeth Tann tat ihm bitter leid.
„Wie darf man sich von seinem Zorn nur gleich so fortreißen lassen“, sagte er kopfschüttelnd, „Sie danken der jungen Dame den Besuch schlecht, den sie Ihnen gemacht hat.“
Elisabeth hielt Heino Staufen die gefalteten Hände entgegen.
„Heino, sei nicht so unbarmherzig hart. Ich versprach dir doch, die Stellung wieder aufzugeben. Du hast keinen Grund, um so eine Kleinigkeit mit mir zu brechen. Laß uns doch ruhig über alles reden.“
Heino Staufen blickte über sie hinweg.
„Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Kommissar, wenn ich wieder gehen dürfte!“
Der Kommissar klingelte und der Schutzmann erschien.
Ohne Elisabeth zu beachten, folgte ihm Staufen.
Als sich die Tür vor beiden öffnete, stürzte Elisabeth vor und ihre Hände krampften sich in Heinos rechten Ärmel.
„Du darfst so nicht gehen, ich habe dich doch lieb, Heino!“ schrie sie auf.
Ein hartes, unerbittliches Gesicht wandte sich ihr zu.
„Das hast du bewiesen, Elisabeth, mir genügt der Beweis jedenfalls. Und nun laß mich, bitte, sofort los, oder ich bedaure, dir wehe tun zu müssen.“
Da fielen ihre Hände wie leblos von seinem Ärmel nieder, und im nächsten Augenblick schloß sich die Tür hinter Heino Staufen und dem Schutzmann.
Mit todblassem Antlitz und zuckenden Lippen stand Elisabeth Tann vor dem Kommissar.
Der hätte ihr gern ein paar Trostworte gesagt, aber diesem bleichen, verstörten Jungmädchengesicht gegenüber fand er alles, was ihm einfiel, zu ungeschickt und plump.
Er brachte nichts anderes zustande, als die mitleidige Frage, ob sie ein Glas Wasser trinken wolle.
Sie trank, fast ohne zu wissen, daß sie es tat.
Sie war vor Schmerz völlig wirr.
Eine halbe Stunde später stand sie schon wieder vor dem Hause, in dem sie wohnte. Sie starrte es an, als hätte sie es nie zuvor gesehen, als müßte sie sich erst besinnen, daß in diesem Steinkasten hoch oben im vierten Stockwerk ihr kleines Daheim lag.
*
Martha Tann schrie auf, als sie die Tür öffnete und Elisabeth einließ.
Wie konnte ein Mensch nur so entsetzlich bleich aussehen wie ihr Kind.
Sie zog Elisabeth ins Zimmer, drückte sie auf das Sofa nieder. Dann nahm sie ihr den Hut ab, fragte weich und leise: „Was hat man dir getan, du armes Ding?“
Die zärtliche Mutterstimme riß aus Elisabeth heraus, was sie wie eine tiefe blutende Wunde trug, seit Heino Staufen sie so hart von sich gestoßen.
Sie schüttete der Mutter ihr Herz aus, klagte ihr, was ihr geschehen.
Zuerst erzählte sie von der Unverschämtheit Leonhard Mosbachs, dann klagte sie ihr, wie grausam Heino zu ihr gewesen.
Sie redete hastig und zuweilen verwirrte sich der Redefaden. Als sie geendet, lehnte ihr Kopf müde an der Rückwand des Sofas und über ihre blassen Wangen zogen die Tränen in langen Reihen, schienen kein Ende nehmen zu wollen.
Ihr war erbärmlich zumute und sie sann verzweifelt: Was sollte sie nur um des Himmels willen tun?
Was lag ihr noch an der kurz zuvor so heiß begehrten Stellung in dem Modesalon! Heino sollte nur wieder gut mit ihr sein, sie wieder liebhaben.
„Arme Liesel“, seufzte die mit ihr erregte Mutter. „Wenn ich nur wüßte, wie ich dir helfen könnte.“
Sie merkte mit Entsetzen, wie heiß die Stirn ihres Kindes war, wie Elisabeths Hände glühten.
„Ich glaube, du fieberst, Liesel“, stellte sie fest, „geh ins Bett, Kind, ich besorge Chinin.“
Elisabeth war es, als höre sie dumpfen fernen Trommelschlag.
Sie wußte nicht, daß es sich nur um eine Sinnestäuschung handelte.
Sie sagte leise mit lauschend vorgeneigtem Kopf: „Es marschiert wohl ein Verein vorbei, Mutter, nicht wahr? Ich glaube, es wird ein alter Soldat begraben. Sei ganz still, Mutterchen, gleich wird man die Schüsse hören, die über sein Grab abgegeben werden. Der Friedhof ist doch nahe bei uns.“
Der Friedhof war fast eine Stunde entfernt von dem Mietshause, in dem Mutter und Tochter wohnten. Martha Tann wußte vor Angst kaum, was sie zuerst tun sollte.
Sie sagte in bebender Verzweiflung: „Warte einen Augenblick, Kind, ich hole nur etwas von Frau Schulten, bin aber sofort zurück.“
Sie rannte die Treppe hinunter, bat die alte Frau, den Arzt zu rufen.
Als sie wieder ins Zimmer trat, saß Elisabeth noch genau so auf dem Sofa wie vorhin.
Als sich Martha Tann besorgt über sie neigte, lachte sie seltsam trocken: „Mutter, weißt du es schon, Heino hat mir das Herz aus der Brust genommen und es zerdrückt. Jetzt habe ich kein Herz mehr.“
Elisabeth ließ sich wie ein kleines Mädchen ins Bett bringen.
Als der Arzt erschien, fand er die junge schöne Elisabeth Tann bereits in heftigen Fieberphantasien.
Am nächsten Vormittag fand eine Haussuchung in der Wohnung von Martha Tann statt.
Leonhard Mosbach hatte auf der Polizei angegeben, die Geliebte Staufens, Elisabeth Tann, schiene ihm sehr verdächtig. Sie wäre bei ihm gewesen, um ihn zu veranlassen, Staufen zu entlasten, und er meinte, es bestehe die Möglichkeit, sie hätte das Geld versteckt.
Die Haussuchung, bei der die Beamten die denkbar größte Rücksicht auf die Kranke nahmen, verlief natürlich resultatlos und Elisabeth erfuhr erst davon, als sie wieder gesund war und aufstehen durfte.
Sie wußte sofort, das war Leonhard Mosbachs Rache gewesen.
Aber sie erfuhr noch mehr.
Die Mutter wollte sie schonen, aber Elisabeth sagte: „Ich bin einmal unter meinem Leid zusammengebrochen, ein zweites Mal tue ich es dir nicht an, daß du dich um mich ängstigen mußt, du armes Muttchen. Ich kann alles hören, verlaß dich darauf, alles!“
Die Mutter nahm Elisabeths Hand.
„Frau Vollhard hat sich sehr eingehend nach deinem Befinden erkundigt während deiner Krankheit. Das schöne Obst da drüben auf der Kommode hat sie heute früh geschickt und die Blumen auch. Sie bestellte neulich Grüße von Frau Weilert, die dich besuchen wird, sobald du längere Zeit aufbleiben darfst.“
„Wie nett die Damen zu mir sind“, sagte Elisabeth dankbar. „Wenn Frau Weilert kommt, werde ich sie bitten, mich wieder zu entlassen, weil Heino es nicht wollte, daß ich die Stellung annahm.“
Sooft Elisabeth in den letzten Tagen nach Heino Staufen gefragt hatte, war ihr von der Mutter die Antwort geworden, die Verhandlung seines Falles stehe bevor, weiter wüßte sie nichts.
Jetzt aber mußte Martha Tann die Wahrheit berichten.
Sie erwiderte ein bißchen gepreßt: „Heinos wegen brauchst du eigentlich die gute Stellung nicht aufzugeben, ihm ist es wohl gleich, ob du es tust oder nicht.“
„Wie meinst du das, Mutter, hat Heino von sich hören lassen? Sprich offen heraus. Schon‘ mich nicht mehr, sage mir die Wahrheit! Ich wiederhole dir, ich kann jetzt alles hören.“
Sie fühlte es, irgend etwas, das mit Heino zusammenhing, verbarg die Mutter vor ihr.
Martha Tann dachte verzweifelt: Wie entsetzlich schwer war es doch, einem geliebten Kinde Schmerz zufügen zu müssen.
Aber sie sah keinen Ausweg. Elisabeth mußte einmal die Wahrheit erfahren.
Wenn sie es jetzt unterließ, sie ihr mitzuteilen, bedeutete das nur einen Aufschub. Und die Ungewißheit über das Schicksal des Geliebten quälte Elisabeth doch. Sie glaubte ja, die Verhandlung gegen Heino stände noch bevor, sie fände erst statt, während sie doch schon vor drei Tagen stattgefunden hatte.
Auch Elisabeth war als Zeugin geladen gewesen, aber durch ihre Erkrankung war sie von der Zeugenschaft befreit worden. Man glaubte, darauf verzichten zu können.
Der Kommissar, mit dem Elisabeth gesprochen, hatte alles für sie geordnet.
Nachdem sie noch ein Weilchen gezögert hatte, berichtete Martha Tann, daß die Verhandlung gegen Heino Staufen bereits vorüber war.
Mit weitgeöffneten Augen sah Elisabeth die Ältere an.
„Wie fiel das Urteil aus, Muttchen? Sprich schnell, die Ungewißheit martert mich. Nicht wahr, er wurde freigesprochen?“
Unendlich drängend war die Frage.
Martha Tann nickte: „Ja, mein Kind, er wurde, Gott sei Dank, freigesprochen, aber leider freigesprochen wegen Mangels an Beweisen.“
Elisabeth lächelte, während ein tiefer Atemzug ihre Brust hob.
„Das ist doch gleich, darauf kommt es doch wohl kaum an!“
Die Ältere wußte nicht recht, was sie erwidern sollte. Endlich aber entschloß sie sich zur Antwort.
„O doch, Liesel, der Beisatz ‚wegen Mangels an Beweisen‘ ist kein ganz glatter Freispruch. Es bleibt damit an dem auf diese Weise Freigesprochenen etwas hängen. Der Verdacht bleibt gewissermaßen bestehen.“
Elisabeths noch eben so frohes Gesicht ward sehr ernst und nachdenklich.
„So ist es aufzufassen! Es steht danach also in jedermanns Belieben, Heino für schuldig oder unschuldig zu halten. Das ist natürlich sehr traurig und sein Stolz muß darunter leiden.“ Sie lächelte schon wieder. „Meine Liebe soll es ihn vergessen machen. Vielleicht findet man den wirklichen Dieb aber doch noch. Ich meine den Menschen, der das Geld an sich genommen und unterschlagen hat. Heino und ich werden uns die größte Mühe geben, ihn aufzuspüren.“
Martha Tann dachte, nun kam das Allerschlimmste für Elisabeth, nun mußte sie ihr die bitterste Wahrheit sagen.
Sie sann, ob sie es nicht lieber wenigstens noch einen Tag aufschieben sollte?
Aber was erreichte sie damit?
Morgen würde es ihr genau so schwer werden, zu sprechen, wie heute, und verbergen konnte sie die letzte traurige Wahrheit doch nicht vor Elisabeth.
Sie nahm wieder die Hände ihres Kindes.
„Liesel, bitte, rege dich nicht auf, denke an mich und wie sehr ich mit dir leide, wenn ich dir jetzt das Allerschwerste mitteilen muß.“ Ihre Stimme bebte: „Heino ist nämlich gar nicht mehr in unserer Stadt. Gestern ist er abgereist.“
„Woher weißt du das, Mutter, und wohin ist er gereist?“ stammelte Elisabeth mit verlöschendem Atem.
Martha Tann erhob sich.
„Gestern abend ist ein Brief von ihm an dich gekommen. Mit der letzten Post. Und da er nur sehr leicht und nachlässig verschlossen war, habe ich ihn geöffnet, Liesel. Nicht aus Neugier, nein. Sondern um dir gleich den Brief zu geben, falls er, was ich annahm, eine gute versöhnende Nachricht enthielt, und dir wenigstens nicht den Nachtschlaf zu rauben, wenn die Nachricht schlecht wäre.“
Elisabeth saß ganz geduckt auf dem bequemen Sofa, saß so da, als fürchte sie, es wollte jemand einen Schlag gegen sie führen.
„Gib mir den Brief, Muttchen“, bat sie, „und habe keine Angst, ich werde über alles wegkommen, du darfst und sollst meinetwegen nicht noch mehr leiden. Hast genug an deinem eigenen Leid zu tragen.“
Martha Tann öffnete den obersten Kommodenkasten und zog unter allerlei Wäschekleinkram einen Brief hervor, den sie Elisabeth reichte.
Ihr Herz war dabei übervoll vor Jammer und Mitgefühl.
Sie setzte sich an das Fenster und wandte ihrer Tochter halb den Rücken. Sie sollte ganz ungestört die wenigen Zeilen lesen, die ihr für immer die schönste Glückshoffnung nahmen, sie vernichteten in Grund und Boden.
Sie saß ganz still und blickte durch das Fenster hinaus.
Vom vierten Stockwerk aus vermochte man weit zu sehen. Bis an den Tannenwald, der ein Stück mit der Bahnstrecke mitzog.
Vor dem Wald streckte eine Fabrik ihre roten Schornsteine wie lange, von der Arbeit gerötete Arme gegen den Himmel und im Vordergrund drängte sich eine Gruppe von niedrigen Häuschen zusammen.
Es war eine kleine Kolonie, die eine Baugesellschaft geschaffen, um auch einfacheren Familien den Besitz eines Eigenheims zu ermöglichen.
Martha Tann dachte, solche Häuser zu bauen, das wäre eine lockende Aufgabe für ihren Mann gewesen.
Er hätte sie sicher hübscher, bequemer und billiger herzustellen verstanden, wie diese Baugesellschaft.
Ihre Sehnsucht flog, wie seit zehn Jahren Tag für Tag, zu ihm, dem ihre Liebe galt, nach wie vor, dem sie nun einmal nicht zu zürnen vermochte.
Das Schweigen Elisabeths dauerte ihr zu lange. Sie wandte sich nach ihr um.
Sie hatte gefürchtet, Elisabeth mit tränenüberströmtem Gesicht zu erblicken, oder gar mit einer Ohnmacht kämpfend, und wunderte sich, wie scheinbar ruhig das Antlitz der Tochter aussah.
„Hast du den Brief noch nicht gelesen, Liesel?“ fragte sie sehr erstaunt.
Elisabeths Hände ruhten im Schoß, sie hielten den auseinandergefalteten Brief.
„Natürlich habe ich ihn gelesen, Mutter, aber dir fällt wahrscheinlich auf, daß ich nicht weine und mich nicht aufrege. Aber ich nahm mich zusammen. Mit aller Gewalt tat ich es.“ Sie seufzte. „Ich verstehe Heino nicht mehr, und ich sehe ein, es ist wohl richtig und gut, daß alles zwischen uns zu Ende ist.“
Wenn sie auch ruhig schien, merkte Martha Tann doch das Zittern ihrer Stimme, und als sie nun den Brief vor die Augen hielt, beobachtete die Mutter deutlich, wie die schmalen Finger dabei flogen.
Elisabeth las laut, als müsse sie sich jedes Wort einprägen:
„Nun bin ich freigesprochen, Liesel, aber nur wegen Mangels an Beweisen. Mosbach hat mich im Gerichtssaal laut einen Lumpen und Betrüger genannt, dazu paßt dieser Freispruch. Mit der Schande belastet, finde ich hier voraussichtlich keine Stellung mehr, deshalb habe ich mein Spargeld abgehoben und will damit ins Ausland, um dort mein Glück zu probieren. Wenn Du diesen Brief erhältst, bin ich schon unterwegs. Wir beide passen ja doch nicht zusammen, denn ich kann kein Mädchen liebhaben, das sich nach dem Talmiruhm sehnt, Modekönigin zu werden. Ich wünsche aber, dieser Wunsch möge Dir in Erfüllung gehen.
Und nun lebe wohl, Liesel, habe Dank für die schönen Stunden, die Du mir gegeben, und vergiß mich. Es lohnt nicht, an einen Menschen zu denken, der nur wegen Mangels an Beweisen freigesprochen wurde.
Gräme Dich nicht meinetwegen, denn ich habe Dich nicht mehr lieb, seit ich weiß, Du tatest doch, was ich nicht wollte.
Heino.“
Sie legte den Brief auf den Tisch.
„Ich habe ihn aber noch lieb, Mutter“, sagte sie leise, „doch meine Liebe ist wohl von anderer Art, wie die Heinos. Ich muß mit meinem Schicksal fertig werden. Ich muß, weil er es will.“ Aller Glanz in ihren Augen war erloschen. „Was soll ich aber tun, wie könnte ich mich wehren? Er schreibt, wenn ich den Brief erhalte, ist er schon unterwegs. Ich weiß ja nicht, wohin er ist. Wo sollte ich ihn finden?“
Martha Tann neigte den Kopf mit der demutsvollen Bewegung, die ihr dabei eigen war.
„Ja, Kind, du mußt dich in dein Schicksal ergeben. Frau Schulten hat heute morgen Frau Wille getroffen, bei der Heino Staufen gewohnt hat. Sie erzählte ihr, gestern nachmittag wäre er abgereist nach Hamburg. Er hätte gesagt, er fahre ins Ausland. Wohin? Das brauche niemand zu kümmern, denn es gäbe hier in der Stadt keinen einzigen Menschen, der Interesse dafür hätte. Darauf meinte Frau Wille, er hätte doch eine Braut. Er aber hat erwidert, er könne sich beim besten Willen nicht erinnern.“
Sie sah ihre Tochter voll Mitleid an.
„Es klingt nach Klatsch, aber es ist doch gut, wenn man Bescheid weiß.“ Sie lächelte zärtlich: „Du wirst ihn vergessen, Liesel, er verdient es nicht, wenn du dich seinetwegen grämen würdest.“ Sie lobte: „Du hörst das Traurige, was ich dir am liebsten vorenthalten hätte, aber auch so tapfer an, daß ich aufatme. Was glaubst du, Kind, was ich seit gestern abend durchgemacht habe, seit der Brief im Hause ist.“
Elisabeth preßte die Lippen aufeinander, damit ihnen kein Wehlaut entschlüpfen sollte. Sie empfand einen dumpfen ungeheuren Schmerz. Betäubend stark war er. Zu stark.
Und immer stärker wurde er, löschte ihr Empfinden aus, gab ihr Fügsamkeit.
Es klopfte draußen.
„Es wird Frau Schulten sein“, sagte Martha Tann und ehe sie öffnen ging, strich sie mit zärtlicher Hand über das leicht gelockte wundervolle Blondhaar der Tochter.
Es schlug eben elf Uhr.
Ja, es konnte nur Frau Schulten sein, dachte Martha Tann, alle anderen Leute klingelten.
Aber das Klopfen hatte so stark geklungen, so energisch. Seit der Haussuchung war sie nervös, fürchtete immer, die Beamten könnten wiederkommen.
Sie spähte durch das kleine Guckloch in der Korridortür hinaus und stürzte dann in die Stube zurück, als hätte sie ein Gespenst am hellen Tage gesehen.
Elisabeth erschrak, so erregt war das Mienenspiel der Mutter und ihre Stimme war heiser, ihr Atem keuchend, als sie hastig hervorstieß: „Ich bin schwer krank, Liesel, mein Geist ist verwirrt, denn denke nur, ich sah den Vater vor unserer Tür!“
Sie flog an allen Gliedern.
Elisabeth war plötzlich von großer Angst erfüllt. Die fixe Idee der Mutter artete aus und sah Wahngebilde. Sie fürchtete für ihren Verstand.
Aber geklopft hatte jemand, denn sie hatte es ebenfalls gehört.
So ruhig, wie es ihr nur möglich war, sagte sie: „Ich werde mich überzeugen, wer draußen ist, Muttchen, denn du hast dich sicher geirrt.“
Sie ging langsam, noch von der Krankheit müde und erschöpft, auf den kleinen Vorplatz hinaus.
In diesem Augenblick klopfte es wieder, aber noch bedeutend stärker als das erstemal.
Elisabeth öffnete und ein paar Schritte hinter ihr lehnte die Mutter an der Wand, beide Hände auf das sich wie wahnsinnig gebärdende Herz gedrückt.
Jetzt wich die Tür zurück und der Klopfende ward sichtbar.
Es war ein mittelgroßer schmaler Herr. Auf seinem Gesicht hatten viele Leidenschaften ihre Runen eingezeichnet, aber seine unter starken Lidern ruhenden braunen Augen blitzten unternehmungslustig, als er nun, den Hut ziehend, der neu und elegant war, wie seine übrige Kleidung, sehr höflich sagte: „Ich erfuhr auf Erkundigungen, daß hier Frau Martha Tann und ihre Tochter Elisabeth wohnen, und möchte beide gern sprechen.“
Das junge Mädchen wollte erwidern: „Ich bin Elisabeth Tann!“ Aber sie kam nicht dazu, denn die Mutter stürzte an ihr vorbei, schrie jauchzend auf: „Du bist es, du bist es wirklich! Also habe ich recht gehabt, daß ich so lange auf deine Wiederkehr gewartet habe.“
Schon lag sie an der Brust des Mannes und schluchzte vor Freude laut auf.
Robert Tann drängte sie mit sanfter Gewalt in das Zimmer, sonst hätte es draußen im Hausflur ein Schauspiel für die Nachbarn gegeben.
Elisabeth schloß sacht die Tür.
Es schoß ihr durch den Kopf, wie seltsam das doch war: Ihr Vater, dessen Rückkehr ihr das Unglaubwürdigste der Welt schien, tauchte urplötzlich wieder auf, so plötzlich, wie er eines Tages verschwand, und Heino Staufen, den sie noch vor kurzem für das ganze Leben festzuhalten geglaubt, war so jäh daraus fortgegangen, als sei Liebe nur ein müßiges Spiel, das man jederzeit beenden kann.
Sie stand in der Küche und hing ihren Gedanken nach.
Von nebenan hörte sie das Lachen der Mutter und die Stimme erschien ihr fremd, weil das Lachen so jung, so leicht und unbeschwert klang. Wie vollgesogen von Sorglosigkeit und Glück.
Elisabeth setzte sich auf den Holzstuhl am Küchentisch und stützte den wirren, schmerzenden Kopf in die Hand.
Heino war abgereist ins Ausland, sie würde ihn wahrscheinlich niemals wiedersehen, und ihr Vater hatte den Weg in die Heimat gefunden.
Der Gedanke dünkte ihr befremdend, daß der Vater wieder da war.
Sie freute sich nicht.
Sie konnte es nicht, weil der Vater die Mutter so lange in Gram und Leid auf sich hatte warten lassen.
Sie vernahm lebhaftes Sprechen der Mutter und dazwischen ab und zu eine Männerstimme. Es war die Stimme ihres verschollenen, von ihr totgeglaubten Vaters.
Sie hatte sich nicht mehr an sein Aussehen erinnern können und seine Stimme war ihr fremd wie sein Äußeres.
„Elisabeth! Liesel!“ drang es an ihr Ohr und mechanisch erhob sich das junge Mädchen, um dem Rufe zu folgen.
Sie drückte die Klinke zur Wohnstube nieder und stand dann auf der Schwelle, die Mutter staunend betrachtend.
Sie sann, welche Wunder doch die Freude zu vollbringen vermochte.
Das war ja gar nicht mehr die Mutter, die sie bisher gekannt, das war eine andere, eine viel jüngere Frau.
Robert Tann hatte den dünnen Mantel, den er über dem Arm getragen, auf einen Stuhl geworfen, sein Hut lag auf der Kommode.
Elisabeth wandte ihm nun den Blick zu, und der Blick durchforschte das Faltengesicht, prüfte die braunen Augen, die sie anblitzten.
Die Mutter rief ihr entgegen: „Dein Vater konnte nicht eher zu uns kommen, Liesel, der Ärmste hatte viel Unglück in der Fremde. Nun glückte es ihm aber endlich doch, etwas zu erwerben, damit will er für uns alle eine gute Zukunft aufbauen.“
Sie mahnte: „Begrüße doch deinen Vater, Liesel, er ist überglücklich, wieder bei uns zu sein.“
Elisabeth bewegte sich mit bleiernen Füßen vorwärts.
Es war da etwas in ihr, was es ihr schwer machte, in diesem ihr fremden Manne den Vater zu sehen.
Sie dachte an die lange Wartezeit der Mutter, dachte daran, daß er die Mutter mit ihr, dem damals kleinen Mädchen, hilflos im Stiche gelassen.
Er lächelte sie an: „Was bist du für ein wunderschönes Mädel geworden, Elisabeth. Ich werde ganz eitel und stolz auf dich sein!“
Er streckte ihr die Arme entgegen und zog sie an sich, küßte sie auf die Wange.
„Ich bin glücklich, euch beide so gefunden zu haben, wie ich es mir immer in schönen Träumen ausmalte, und ich denke, wir werden sehr zufrieden miteinander leben.“
Elisabeth entzog sich ihm.
„Verzeihung, Vater, aber ich möchte mich setzen. Ich war krank und bin noch nicht imstande, längere Zeit zu stehen.“
Er führte sie, mit einem Ausdruck der Besorgnis auf dem Gesicht, zum Sofa und streifte dabei den Brief Heino Staufens, der auf der Tischecke lag, so daß er zu Boden flatterte.
Er hob ihn sofort auf und reichte ihn Elisabeth, die danach langte und ihn in die Tasche ihres Hauskleides schob.
„Unser Kind war krank?“ fragte er seine Frau und ließ sich auf dem Sofa neben Elisabeth nieder. „Erzähle doch, was fehlte ihr, Martheken?“
Martha Tann errötete bei der Anrede „Martheken“ wie ein junges Mädchen.
„Wir wollen später davon sprechen“, erwiderte sie, „denn es ist eine lange Geschichte. Jedenfalls erkrankte Liesel am Fieber. Sie hatte hohe Temperatur und phantasierte unausgesetzt. Sie hatte sich stark erkältet und dazu einen Nervenzusammenbruch.“
Elisabeth fühlte förmlich den mitleidigen Blick des Vaters, obwohl sie ihn nicht ansah. Sie grübelte, es war wohl unrecht von ihr, den Vater so fremd und kühl begrüßt zu haben.
Er hätte vor zehn Jahren nicht so davonlaufen dürfen, wie ein junger freier Bursche, er hätte nicht schweigen dürfen zehn lange Jahre, aber sie besaß eigentlich kein Recht, ihn zu verurteilen, wenn es die Mutter nicht tat.
Sie hob den Kopf.
„Der Vater soll die Wahrheit, wovon ich eigentlich krank wurde, lieber gleich erfahren. Dann ist das Thema wenigstens gleich erledigt und wir brauchen nicht mehr davon zu sprechen. Ich würde ja doch nur immer wieder aufs neue leiden.“
Sie schöpfte tief Atem.
„Ich hatte einen Mann lieb, Vater, er heißt Heino Staufen und war Buchhalter in der Getreidehandlung von Leonhard Mosbach. Mir wurde eine Stellung in Berlin angeboten mit vielen Vorteilen und ich wollte sie gern annehmen. Heino aber war dagegen, und als ich darauf bestand, wurde er heftig und lief davon, ließ mich einfach mitten auf der Straße stehen.“ Sie seufzte in der Erinnerung. „An jenem Mittag — er war aus seinem Bureau, ich aus Frau Vollhards Schneideratelier gekommen — sollte er zwanzigtausend Mark, die in einem versiegelten Umschlag lagen, im Auftrag von Mosbach zu einer anderen Firma tragen. Aber im Zorn, nachdem er mich stehen gelassen, vergaß er den Auftrag und lief, um sich auszutoben, in den Stadtwald.“
Sie unterbrach ihre Erzählung, denn der Vater war sichtlich zusammengezuckt, als empfinde er plötzlichen Schmerz.
Ihre Mutter hatte es auch bemerkt. Sie fragte besorgt: „Was hast du nur, Robert? Weshalb zucktest du eben so sehr zusammen?“
Er lächelte schon wieder, aber Elisabeth fand, sein Gesicht wirkte jetzt fahl.
Er erwiderte hastig: „Mir ist nichts, rein gar nichts, aber ich bin nervös vor Freude, wieder bei euch zu sein, das ist alles.“
Seine Frau erhob sich.
„Ich will jetzt für unser Mittagessen sorgen. Elisabeth wird dir derweil weitererzählen.“
Robert Tann nickte ihr zu, warf ihr eine Kußhand nach und wandte sich dann an die Tochter:
„Nur weiter, Liesel, ich bin sehr gespannt.“
Und während Elisabeth wahrheitsgetreu alles berichtete, was ihr soviel Kummer geschaffen, saß er still neben ihr und seine Augen blickten geradeaus ins Leere.
Erst nachdem sie geendet, kehrte sein Blick zu ihr zurück und nachdenklich fragte er: „Und glaubst du, liebes Kind, wenn die verhängnisvolle Sache mit dem Geld nicht geschehen wäre, ihr hättet euch wieder versöhnt?“
Sie brauchte erst gar nicht zu überlegen.
„Bestimmt hätten wir uns dann ausgesöhnt, ganz bestimmt. Das bezweifle ich gar nicht.“ Wie heimliches Weinen zog es durch ihre Stimme: „Er wurde durch seine Verhaftung zwei Tage lang davon zurückgehalten, mich zu treffen. Ich aber nahm an, es wäre nur Trotz von ihm, daß er sich nicht mehr sehen ließ, und trat die Stellung an. Als ich ihn dann im Gefängnis besuchte und er von mir hörte, ich hätte das lockende Angebot nicht ausgeschlagen, sondern sei schon in Berlin gewesen, wurde er sofort wieder zornig. Noch zorniger wie das erstemal. Er brach mit mir, ganz schroff tat er es.“
Sie sprach immer unsicherer. Wellen der Erregung spülten über ihren von der Krankheit müden Körper hin, und zugleich empfand sie ein ganz unbeschreibliches Mitleid mit Heino Staufen.
Sie klagte mit tränenfeuchten Augen: „Ich kann ihm nicht zürnen, denn er war überreizt durch sein Unglück und ist nun, weil man ihn wegen Mangels an Beweisen freisprach, ein armer Mensch, der schuldlos mit einem Schandmal herumläuft.“
Sie ballte die im Schoß ruhenden Hände.
„Ich wollte mir die Füße blutig laufen, wenn ich wüßte, ich fände den Menschen, der die Hauptschuld an seinem und meinem Unglück trägt!“
„Und wer ist das nach deiner Meinung, mein Kind?“ fragte Robert Tann mit einem Blick, der dem ihren auswich.
„Aber Vater, danach fragst du noch?“ sagte sie kopfschüttelnd. „Die Hauptschuld an dem Unglück trägt der Mensch, der das gefundene Geld unterschlagen hat. Das ist doch klar. O, wenn mein Wunsch Kraft hätte, in Erfüllung zu gehen! Ich wünschte diesem schlechten Menschen, daß ihm das Geld Unheil bringen möge, daß es ihn unglücklich machen soll und daß es ihm unter den Händen zerrinnt wie Hexengold.“
Er hob abwehrend die Hand.
„Aber Elisabeth, so hart darfst du nicht sein. Bedenke nur, wenn vielleicht ein ganz armer Teufel das Geld fand. Einer, der so bettelarm war, so verhungert, so heimatlos und elend, daß er wohl gar seinem Leben ein Ende machen wollte, und sich nun damit aus aller Not retten konnte.“
Sie blickte ihn verwundert an.
„Wie bist du nur darauf verfallen, Vater?“
Er fuhr sich über die Stirn, die dünnes, aber noch dunkles Haar begrenzte, an dessen dunkler Farbe irgendein Friseur nicht ganz schuldlos schien.
Es zuckte um seinen Mund.
„Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf komme, aber ich meine, es wäre doch möglich, so ein armer Schlucker fand das Geld.“ Leiser setzte er hinzu: „Falls es sich wirklich so verhielte, dürftest du ihm eigentlich nicht so viel Böses wünschen, Liesel.“
„Doch, Vater, auch dann“, war die schnelle Erwiderung. „Er, der das Geld fand, wußte selbstverständlich wohl kaum, wer es verlor, aber es war seine Pflicht und Schuldigkeit, es auf der Polizei abzugeben. Er durfte doch auch für alle Fälle mit einer guten Belohnung rechnen. Damit hätte er sich dann helfen können, wenn er es nötig gehabt. Die Unterschlagung, der man Heino verdächtigte, hat er begangen, und die Schande, die nun Heino nachläuft wie ein dunkler Schatten, müßte jenen anderen verfolgen. Wie ein Brandzeichen müßte ihm die Schande aufgedrückt werden.“
Sie dachte so recht stark daran, daß der Unbekannte die Schuld an ihrem Unglück und Herzeleid trug. Rascher strömte ihr Blut, Haß flammte in ihren Augen auf.
„Ich muß dem Mann Böses wünschen, Vater, weil ich Heino um seinetwillen verlor.“ Wie ein Schrei brach es von ihren Lippen: „Ich habe ihn doch so lieb, so grenzenlos lieb!“
Robert Tann war es, als läge ihm ein Alpdruck auf der Brust, den er gewaltsam abschütteln wollte, was ihm aber nicht gelang.
Sein verwittertes Gesicht war fahl, als er mit scheuer Bewegung über Elisabeths Hände streichelte und sagte: „Gräme dich nicht allzusehr, Liesel, mit Staufen wärest du ja doch nicht glücklich geworden. Er hätte dich um solcher Bagatelle willen nicht so rücksichtslos behandeln dürfen. Wenn er dich wirklich lieb gehabt hätte, würde er dich gebeten haben, die Stellung wieder aufzugeben, was du ihm ja sowieso versichertest, und damit wäre dann alles erledigt gewesen. Sieh einmal, Liesel, wenn einer schon um so eine Kleinigkeit sich so anstellt, als hättest du wer weiß was begangen, wie wäre das erst in der Ehe geworden. Mußt das etwas leichter auffassen, Kind, mußt darüber wegkommen.“
Elisabeth drängte die Tränen zurück.
Plötzliche Scheu zwang sie dazu, denn mit einem Male hatte sie das Gefühl, ein fremder Mensch saß neben ihr.
Es störte und ernüchterte sie.
Ihr Blick huschte über das verwitterte Gesicht hin, das dem ihren so nahe war, und sie sann: Es war doch gar kein fremder Mensch, dem es gehörte. Es war ihr Vater, und die Augen waren zweifellos den ihren ähnlich. Vielleicht auch Nase und Mund.
Seltsam, dachte sie, daß dieser ihr so fremd scheinende Mann ihr Vater war und sie ihm ähnelte.
Grau und müde war sein Gesicht. Er mußte viel durchgemacht haben, ehe er heimgekommen.
Sie hätte den Vater nicht mehr vermißt. Er war viel zu lange fortgeblieben, die Lücke, die sein jähes Verschwinden einmal in ihr hinterlassen, war längst nicht mehr bemerkbar.
Aber die Mutter war froh und glücklich. Und nur darauf kam es an.
Sie erwiderte auf das, was er vorhin gesagt: „Ich werde auch wohl darüber hinwegkommen müssen, Vater, ich wüßte ja nicht einmal, wohin ich ihm schreiben könnte. Die Welt ist dazu viel zu groß.“
Die Welt ist klein! dachte Robert Tann und er spürte den Alpdruck stark und quälend. Winzig klein war die Welt und sie lag in den Banden von unzähligen Zufällen, die wie tückische Kobolde alles regierten und leiteten nach ihren Launen.
Wäre Größe in dieser Welt, überlegte er, dann hätte es nicht geschehen dürfen, daß er, gerade er das Geld fand und daß es gerade Heino Staufen verlor.
Es zwickte ihn, weil Elisabeth nun unter all dem leiden mußte, als hätte man ihm Blutegel an Arme und Beine gesetzt.
Er versuchte sich gegen die Bedrängnis zu wehren, sagte ein wenig scharf: „Man kann dem jungen Mann den Vorwurf großen Leichtsinns kaum ersparen. Es war fremdes anvertrautes Geld, damit mußte er vorsichtig umgehen, das durfte er einfach nicht vergessen. Überlege einmal, Liesel, wie würde geschäftlich alles drunter und drüber gehen, wenn jeder Angestellte so pflichtvergessen sein würde wie er. Liebesschmerzen haben doch schließlich viele.“
Das Wort „plichtvergessen“ kränkte Elisabeth. Sie hatte es auf der Zunge, zu antworten: Der Pflichtvergessenste aller Menschen, die ich kenne, bist du, denn du ließest Frau und Kind im Stich in Sorgen und Not.
Aber ihr fiel rechtzeitig wieder ein, die Mutter verurteilte ihn nicht, also durfte sie es gar nicht.
So schwieg sie denn, während Robert Tann etwas betont fortfuhr: „Natürlich kannst du ihm nicht schreiben, selbst wenn du wüßtest, wo er zu finden wäre. Er hat dir mitgeteilt, er liebt dich nicht mehr, also mußt du deinen Stolz zu Hilfe rufen.“ Er atmete etwas leichter. „Du bist wunderschön, mein Kind, so schön, daß ich alter Kerl ordentlich erschrocken bin vor dir. Wer weiß, was das Schicksal noch für ein großes Glück für dich bereithält und wozu es gut ist, daß alles so kam.“
Um Elisabeths jungen Mund lag ein Hauch von Bitternis, als sie entgegnete: „Wozu es gut ist! Das sagt die alte Frau Schulten, die unter uns wohnt, auch immer. Sogar, wenn ihr ein Teller hinfällt oder die Milch anbrennt. Und nun wollen wir nicht mehr von meinem Kummer reden, ich muß und werde darüber wegkommen. Vor allem möchte ich nicht, daß sich Mutter meinetwegen zuviel sorgt. Ich habe ihr durch meine Erkrankung gerade genug Aufregung bereitet.“ Ihre Augen sahen den Mann groß an. „Mutter hat während der Jahre, die du weggewesen, sehr nach dir gebangt, sie hat zehn Jahre lang nur immer und immer auf dein Wiederkommen gewartet. Alles, was in der Zeit um sie herum geschah, nahm sie nicht viel anders auf, wie es eine Nachtwandlerin tun würde.“
Ihre Stimme ward leiser, aber sie gewann an Eindringlichkeit.
„Du mußt sehr gut zur Mutter sein, sehr, sehr gut, sie hat das um dich verdient. Du mußt sie mit viel Liebe und Güte bezahlen für die zehn traurigen Jahre des Wartens.“
Robert Tann nickte und machte ein beinahe feierliches Gesicht.
„Ich weiß, was ich ihr schuldig bin.“ Er druckste. „Ich – ich habe sie auch lieb, aber weißt du, ich verlor damals den Kopf. Ich hatte mich verbaut und geriet in allerlei Schwierigkeiten, mit denen ich nicht fertig werden konnte. Das bildete ich mir wenigstens ein. Jetzt weiß ich allerdings, mein Fortlaufen damals wäre gar nicht nötig gewesen. Deine Mutter sagte mir schon, was ich damals an Werten zurückließ, das Haus und die Möbel, hätte genügt, meine Verbindlichkeiten zu ordnen.“ Er seufzte. „Ich habe also auch zehn Jahre verloren! Zehn Jahre, die ausgereicht hätten, mich hier wieder emporzubringen.“
Er erhob sich und trat an das Fenster.
„Ihr wohnt zu hoch und zu eng, man müßte da eine Änderung schaffen.“ Er blickte nach dem fernen Tannenwald hinüber, vor dem sich die winzige Kolonie zusammendrängte. Er murmelte vor sich hin: „Unschön ist das! Wie können die Leute sich an den Häuserchen freuen, wenn ihnen die roten plumpen Fabrikschornsteine so auf den Leib rücken.“
Elisabeth fragte, ob er etwas zu ihr gesagt hätte, sie habe ihn nicht verstanden.
Eben trat seine Frau ein.
Ihr Blick streifte flüchtig die Tochter, suchte sehnsuchtsvoll den Mann.
Er sah sich nicht um und beantwortete Elisabeths Frage.
„Eigentlich habe ich nur etwas zu mir selbst gesagt, aber du darfst es natürlich auch hören, Liesel. Weißt du, ich habe mir eben mit kritischem Auge die neue Häusergruppe vor den Tannen angesehen. Ein Mitreisender im Zuge hierher erzählte mir, daß kleine Sparer ihr Geld in den Liliputbuden angelegt hätten, und da dachte ich eben: Warum wurden die Häuschen ausgerechnet in so abscheulichem Stil erbaut und gerade vor die häßliche Fabrik hingestellt? Die Stadt hat doch hübsche Umgebung genug, man hätte doch ein vorteilhafter gelegenes Stück Land dafür aussuchen können.“
Martha Tann war leise herangetreten und stand nun dicht hinter ihm.
Sie legte ihm mit zärtlicher Bewegung die Hand auf den Arm, ihn aber durchzuckte es bei der behutsam sanften Berührung wie ein elektrischer Schlag.
Erst jetzt erinnerte er sich, vorhin war die Tür gegangen, doch er war zu vertieft in sein Schauen, zu eingesponnen in seine Gedanken gewesen, um sich umzuschauen.
Jetzt wagte er sich nicht zu rühren, vor Angst, im nächsten Augenblick in das Gesicht eines Polizisten blikken zu müssen.
Teufel, wenn man es inzwischen doch herausgebracht hätte, wer das Geld fand!
In der nächsten Sekunde kuschelte sich die Hand unter seinen Arm und die Stimme seiner Frau sagte: „Du hast vollständig recht, Robert, die Eigenheime sind häßlich, aber du kannst dir kaum vorstellen, wie rasch der Unternehmer die Scheusale los geworden ist. Ich dachte gerade heute daran, wie völlig anders die Kolonie aussähe, wenn du sie erbaut hättest.“
Er hatte die jähe Angst längst abgeschüttelt und lächelte nun mit dem Ausdruck vollkommener Seelenruhe.
„Und ob die Kolonie anders aussähe, wenn ich sie erbaut hätte! Wenn ich eine solche Kolonie erbauen dürfte, sie würde bildschön, würde ein Schmuck der Stadt.“
Sie hatte leuchtende Augen und warf ihm entgegen: „Wenn du dürftest? Wer hat dir denn etwas zu befehlen, wer könnte es dir verbieten? Du bist dein eigener Herr, und wenn du etwas Geld besitzt, wie du mir erzähltest, dann probiere doch, das zu tun, was dich reizt.“ Sie war begeistert von ihrer Idee. „Solche Häuschen braucht unsere Stadt. Viele wünschen sich so ein eigenes Heim! Und wenn du nicht zu teuer, aber trotzdem geschmackvoll baust, würdest du die Häuschen schon im Rohbau los.“
Sein alter Unternehmungsgeist war geweckt und kletterte frisch und munter blitzgeschwind zu höchsten Höhen empor.
„Martheken, du hast mir eine Anregung gegeben, für die ich dir dankbar bin“, versicherte er strahlend, „ich glaube jetzt zu wissen, wie ich es anpacken muß, um wieder ganz obenauf zu kommen.“ Seine Augen unter den schweren Faltenlidern blitzten unternehmungslustig. „Martheken, paß mal auf, ich bringe es doch noch zu etwas, ich baue mich noch einmal reich, aber diesmal darf die Karre nicht wieder schief gehen.“
Die schmale Frau sah ihn bittend an.
„Ich glaube an dich und dein Können, Robert, ich glaube felsenfest daran. Sollte es aber doch geschehen, daß dir nicht alles nach Wunsch geht, sollte, was Gott verhüten möge, noch einmal die Sorge an dich herantreten, dann verlaß mich nicht wieder. Tue das nie wieder! Ein zweites Mal würde ich es nicht ertragen, ein zweites Mal ginge ich daran zugrunde.“
Er reckte sich auf.
„Lassen wir die Vergangenheit, liebste Martha, reden wir von unserer Gegenwart und von der goldenen Zukunft. Ich habe stolze Pläne und Ziele.“
Die Frau lächelte.
„Die böseste Zeit ist nun vorbei, du bist ja wiedergekommen!“
„Die böseste Zeit ist nun vorbei!“ klang es in Elisabeth nach und ein paar Tränen tropften in ihren Schoß.
Für sie fing die böseste Zeit nun erst an, sie hatte ja den Mann ihrer Liebe verloren.
Doch an sie dachte die Mutter wohl eben nicht in ihrem übergroßen Glück.