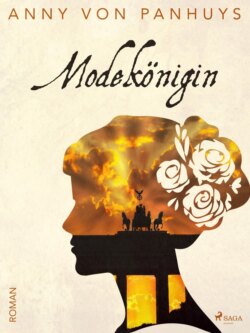Читать книгу Modekönigin - Anny von Panhuys - Страница 8
V.
ОглавлениеDie Nachricht, daß Robert Tann nach zehn Jahren völligen Verschollenseins urplötzlich wieder in der kleinen Stadt erschienen war, verbreitete sich mit Windeseile. Da aber damals alle Gläubiger zu ihrem Geld gekommen waren, gab es hier niemand, der noch mit irgendwelchen Ansprüchen an ihn hätte herantreten können.
Stolz erhobenen Hauptes ging er durch die Straßen.
Seine Kleidung entsprach allen Forderungen, die man hier im Durchschnitt an Solidität und Eleganz zu stellen gewohnt war, und sein hageres durchfurchtes Gesicht fand man interessant.
Auch sorgte seine Frau dafür, daß man freundlicher mit ihm sprach, wie man während seiner langen Abwesenheit von ihm gesprochen.
Sie erzählte jedem, der es hören wollte, sie wäre während der zehn Jahre seiner Abwesenheit stets davon unterrichtet gewesen, wo sich ihr Mann jeweils aufgehalten, sie hätten nur beide darauf gewartet, das Glück sollte ihm ein wenig lächeln. Auch wäre er mit ihrem Einverständnis fortgegangen, mit ihrem vollen Einverständnis, heute dürfe sie das ja ruhig zugeben.
Das sprach natürlich zu Robert Tanns Gunsten.
Er war in den Augen aller bis jetzt so etwas wie ein Bankerotteur gewesen, der sich, als sein Geschäft zusammenbrach, aus dem Staube gemacht hatte, jetzt aber verwandelte sich sein Bild. Man sah ihn anders. Er ward zum sorgenden Gatten und Vater, der in der Stunde der Not in die Fremde gewandert, um dort Geld zu verdienen, weil er den Seinen recht rasch zu helfen wünschte.
Daß ihm sein Vorhaben nicht so schnell geglückt, wie er es gehofft, wer wagte es, ihn deshalb zu verurteilen?
Niemand tat es mehr, niemand.
Alte Geschäftsfreunde, die bisher in verächtlichem Tonfall von ihm geredet, erinnerten sich jetzt, er war damals doch ein ungemein tüchtiger Mensch gewesen, der was verstanden hatte, und als er zum Dämmerschoppen in „Deutsche Haus“ kam, wo er früher sooft mit seinen Bekannten zusammen gesessen, ward er mit freudigen Zurufen begrüßt.
Er saß als wichtigste Person am Stammtisch und mußte erzählen von draußen, von der weiten, weiten Welt.
Da mühten sich alle die Falten und Fältchen seines Gesichts, sich zu straffen, und die braunen Augen leuchteten auf in der Erinnerung an ein Abenteurerleben, das ihn nur durch Jämmerlichkeit und Niederungen geführt. Aber es erschien ihm jetzt, vom friedlichen Hafen aus, reizvoll und poetisch.
Er schwadronierte: „Die Fremde ist bunt und reich, man möchte tausend Augen haben, um nur alles zugleich sehen zu können, was um einen herum ist. Was richtig leben und erleben heißt, das habe ich erst in der Fremde gelernt, und die Versuchung trat an mich heran in den verlockendsten Gestalten.“ Er tat lebemännisch. „Weiberchen gibt es da draußen, Weiberchen wie Bilder! Vor allem die Mexikanerinnen. Augen wie dunkle Feuerräder haben sie und einen Körper, so schmal und federnd, daß ihr Gehen wie heimlicher Tanz ist. Und wie klein sind ihre Füße und Hände! Es gibt nichts Schöneres als eine Mexikanerin.“
Dann ward er elegisch.
„Ich aber dachte stets an meine treue Frau und an mein Mädchen. Es war mein liebster Gedanke, mein Halt. Obwohl ich jeden Pfennig, den ich nicht für Lebensnotwendigkeiten ausgeben mußte, sparte, dauerte es lange, viel zu lange für meine Ungeduld, bis ich heimkehren konnte. Ich hatte oft Unglück, sehr oft. Aber ich verlor den Mut nicht, ich blieb willensfest.“
Er lächelte selbstbewußt.
„Endlich hatte ich ein nettes Sümmchen beisammen, endlich!“
Er erschauerte plötzlich. Weshalb sah er nur mit einem Male ganz deutlich eine Stelle in einem Eichenwald, sah sich selbst dort in elendster Kleidung und fühlte die Schlinge eines Strickes in seiner Hand?
Fort mit der Erinnerung, weit fort damit! Er hatte ja nichts mehr gemeinsam mit dem heruntergekommenen Selbstmörder, der einen passenden Ast für seinen Strick suchte und zwanzigtausend Mark fand, die ihm das Leben retteten.
Er dachte nicht mehr an die düstere Szene im Stadtwalde, er war ganz durchdrungen von dem Wohlsein der Stunde.
„Jetzt will ich wieder hier anfangen zu arbeiten“, lächelte er, „will wieder anfangen zu bauen.“ Er renommierte: „Vielleicht baue ich mir zuerst selbst ein nettes Villachen. Nicht allzu groß, denn ein Krösus bin ich leider nicht. Aber ein behagliches Haus muß es sein mit einer bequemen Autogarage.“
Was brauchten die Kleinstädter zu wissen, daß seine Kasse ihm vorläufig weder eine eigene Villa, noch ein eigenes Auto erlaubte. Er wollte aber mit seinem Geld geschickt manöverieren, so daß er dann doch bald zur Villa und zum Auto kam.
Er mußte es nur verstehen, sich Kredit zu verschaffen, dann gelang auch alles, was er vorhatte.
Seine Zuhörer dachten: Er muß einen guten Batzen Geld heimgebracht haben, wenn er sofort an Villa und Auto denken kann.
Alle tranken ihm zu. Man wollte sich gut mit ihm stehen, wollte liefern.
Robert Tann lachte innerlich. Es ging alles ganz vorzüglich und nach seinen Wünschen.
Am nächsten Tag umwanderte er die Stadt, fand herrliches Wiesengelände am kleinen Buchenhain, unweit davon zog das Flüßchen. Das Land gehörte der Witwe eines Gutsbesitzers. Das Gut war nicht groß, und die Frau hatte vier halbwüchsige Söhne und drei Töchter zu ernähren.
Sie mußte mit jedem Pfennig rechnen. Das paßte Robert Tann in den Kram, er suchte sie eines Vormittags auf.
Josephine Südenow war eine energische Vierzigerin, war ihr eigener Inspektor und ritt in Lederhosen und der alten, abgetragenen Joppe ihres verstorbenen Mannes über die Felder.
Von so einem Ritt kam sie gerade heim, als Robert Tann den Hof betrat.
Kühl fragte sie nach seinem Begehr.
„Das läßt sich nicht so kurz erklären, gnädige Frau“, erwiderte er, „aber es handelt sich um eine äußerst wichtige Angelegenheit.“
„Vielleicht wichtig für Sie“, gab sie achselzuckend zurück. „Das Wort Wichtigkeit führen sie alle im Mund, die hierherkommen, mir meine Zeit zu stehlen. Aber meistens wollen sie weiter nichts, als meine prächtigen Wiesen am Buchenhain für ein Butterbrot schlucken. Falls Sie dieselbe Absicht hierherführt, lohnt es erst gar nicht, Sie ins Haus zu bemühen, denn ich lasse mir meine besten Wiesen nicht abgaunern, damit sich so ‘n Stadtprotz dort ‘ne Villa hinstellt, wo jetzt meine Kühe ihr schönstes Futter finden.“
„Nein, die Absicht führt mich nicht her“, versicherte Robert Tann, „und deshalb bitte ich Sie, gnädige Frau, gewähren Sie mir die gewünschte Unterredung.“
Sie zuckte wieder die Achseln.
„Meinetwegen! Vorausgesetzt, Sie sind auch kein Weinreisender, denn die belästigen mich gerade genügend, obwohl das ganze Jahr keine Flasche Wein bei uns auf den Tisch kommt. Und vor allem, gnädigen Sie mich bitte nicht fortwährend an. Davon wird mir leicht übel. Ich heiße Frau Südenow, ein paar gute Freunde und meine Kinder nennen mich Joseph, aber das geht Sie natürlich nichts an.“
„Ich kam noch nicht dazu, mich Ihnen vorzustellen“, entschuldigte er sich, „ich bin der Bauunternehmer Robert Tann.“
„Bauunternehmer?!“ sagte sie langgedehnt. „Also habe ich mich nicht geirrt, also gehören Sie richtig doch zu der Sorte, die mir meine Wiesen abluchsen möchten für ein Butterbrot. Jedenfalls rate ich Ihnen, gleich wieder zu gehen.“
Sie machte mit dem Kopf eine unzweideutige Bewegung nach dem Hoftor.
„Aber ich bin wirklich nicht aus dem von Ihnen vermuteten Grund gekommen“, beteuerte Robert Tann zum zweiten Male und erreichte es denn auch, das er das Haus betreten durfte.
Ein einfaches Arbeitszimmer im strengsten Bürostil öffnete sich vor ihm, dem Schreibtisch sah man es an, es wurde daran tüchtig geschrieben und gerechnet.
„Nun will ich gleich zur Sache kommen, gnädige Frau – Verzeihung, ich meine Frau Südenow. Also ich möchte Ihnen einen vorzüglichen Vorschlag machen. Ich glaube sogar, ich darf sagen, einen glänzenden Vorschlag. Ihre Wiesen am Buchenhain gefallen mir nämlich außerordentlich und ich muß Ihnen –“
Weiter kam er nicht, denn Josephine Südenow sprang mit einer Gebärde des Zornes so lebhaft auf, daß ihr Stuhl umflog.
„Zum Teufel, Herr, beabsichtigen Sie, sich über mich lustig zu machen“, schrie sie ihn an. „Haben Sie mir vorhin nicht zweimal erwidert, Ihr Besuch hätte nichts mit meinen Wiesen zu tun?“
Er kniff das linke Auge zu, was ihm einen äußerst schlauen Ausdruck gab.
„Bedaure, Frau Südenow, aber das habe ich nicht gesagt. Sie haben mich gefragt, ob ich auch gekommen wäre, um Ihre prächtigen Wiesen am Buchenhain für ein Butterbrot zu schlucken. Das konnte ich ehrlich verneinen. Um Ihnen so ein Angebot zu machen, kam ich nicht. Aber reich werden können Sie durch mich. Steinreich! Ich habe ein Plänchen, das ich Ihnen entwickeln will, wenn Sie mir versprechen, zu keinem davon zu reden. Mein Plan darf keiner Konkurrenz zu Ohren kommen.“
„Ich bin keine Kaffeeklatsche“, fuhr sie ihn an und beförderte ihren Stuhl mit kräftigem Fußtritt wieder in die richtige Lage. „Aber da Sie nun doch mal hier sind, reden Sie ohne Umschweife, zu langen Unterhaltungen habe ich keine Zeit.“
Er hüstelte und bat: „Aber unterbrechen Sie mich möglichst gar nicht, Frau Südenow, bis ich Ihnen meinen Plan, oder sagen wir meinen Vorschlag, genau klargelegt habe.“
Er saß seitlich vom Schreibtisch und blickte die Frau an. Sie nickte kurz.
„Gut, gut, fangen Sie an und fassen Sie sich kurz, sonst streike ich.“
Er rieb sein sorgfältig rasiertes Kinn, dem man es nicht mehr ansah, mit was für langen grauen Stoppeln es noch vor kurzem besetzt gewesen und dann lächelte er: „Ich habe die Absicht, eine kleine Villenkolonie am Buchenhain erstehen zu lassen, zur Freude der vielen, die gern ein hübsches billiges Eigenheim besitzen möchten und zur Freude unserer Börsen. Mir schwebt schon alles klar und deutlich vor, wie es werden soll. Zeichnungen können Sie in kürzester Zeit sehen. Wir würden das sichere, bombensichere Geschäft zusammen machen. Also nicht etwa so, daß ich Ihnen die Wiesen vollständig abkaufe und dann nach dem Erbauen ein reicher Mann geworden bin, während Sie ein für allemal abgefunden sind, sondern wir machen alles zusammen. Risiko haben Sie keins und das Geld werden wir bald scheffeln. Ich will im Anfang nichts weiter von Ihnen, wie den Platz für zwei Häuschen mit Garten. Ich beginne so bald wie möglich zu bauen, und nachdem die ersten zwei Villen verkauft sind, mache ich mich an die nächsten zwei, später baue ich dann gleich ein halbes Dutzend. Den Reingewinn teilen wir so, daß Sie ein Drittel, ich zwei Drittel erhalte. Außerdem zahle ich Ihnen nach dem Verkauf jedesmal ein Stück Wiese, auf dem das betreffende Häuschen steht, extra. Zahle dafür einen guten, nach oben abgerundeten regulären Preis. Schief gehen kann nichts, diese Villenkolonie kommt einem großen Bedürfnis entgegen. Sind Ihre Wiesen bebaut, sind Sie eine sehr wohlhabende, nein, wie ich mich vorhin ausdrückte, eine steinreiche Frau.“
Josephine Südenow hatte ein schroffes „Nein“ auf den Lippen, aber sie hielt es zurück. Die zwei Silben „steinreich“ gebärdeten sich zu aufrührerisch.
Weiß der liebe Himmel, Geld konnte sie brauchen. Sieben Kinder zwischen acht bis siebzehn Jahren kosteten eine Menge Geld, alle erhielten guten Unterricht, gingen gut gekleidet.
Sie sagte: „Erklären Sie mir Ihren Vorschlag noch genauer, nennen Sie, bitte, Zahlen, damit ich mir eine Vorstellung davon machen kann, ob sich das Geschäft wirklich lohnt. Wenn ich mich entschließe, die Wiesen herzugeben, muß ich auch wissen, wofür.“
Er freute sich der Frage nach Zahlen. Die Gier in der energischen Frau war geweckt, alles schien besser zu gehen, wie er vorhin zu hoffen gewagt.
Als er nach einer Stunde den Gutshof verließ, war er mit Frau Josephine Südenow vollkommen einig geworden.
Er freute sich, seine rednerische Überzeugungsgabe war noch vollkommen auf der Höhe. Als er nach Hause kam, war er wie trunken vor Freude.
Er nahm seine Frau in den Arm, schwenkte sie ein paarmal herum wie tanzend.
„Weiberchen!“ rief er begeistert, „ihr beide sollt es von jetzt ab guthaben, jetzt beginnt meine große Karriere! Ihr werdet staunen, wie rasch ich jetzt hier in unserem guten Krähwinkel wieder auf der Achtungsleiter hochklettere.“ Er rieb sich die Hände. „Martheken, vor allem ziehen wir hier aus, das ist keine Wohnung für zukünftige Millionäre. Hier kann ich weder jemand empfangen, noch ein Bureau aufmachen. Na, ich finde schon eine passende Wohnung für uns.“
Elisabeth hörte stumm zu. Sie, die sich in dieser Wohnung unter den billigen häßlichen Möbeln niemals wohlgefühlt, vermochte sich nicht über die Aussicht zu freuen, hier fortzuziehen.
Sie wunderte sich selbst darüber und dachte, das kam wohl daher, weil ihr die Güte, die der Vater über sie ausschüttete, nicht so wohl tat, wie man es eigentlich hätte erwarten dürfen.
Er blickte sie an.
„Mache doch auch ein vergnügtes Gesicht, Liesel, wirst ja nun bald alles erhalten können, was ein junges Mädchen deines Alters sich nur wünschen kann.“
Die Augen der Mutter ruhten wie bittend auf ihr. Sie wußte genau, es kränkte die Mutter, daß sie sich dem Vater gegenüber nicht wärmer und herzlicher gab.
„Ich freue mich ja mit euch“, erwiderte Elisabeth mit dem Schatten eines erquälten Lächelns, „ich freue mich sogar sehr, Vater. Aber bei der Gelegenheit möchte ich dir gleich bekennen, zur faulenzenden Haustochter habe ich kein Talent. Ich muß etwas zu arbeiten haben. Ich bin ja nun wieder gesund und bedarf keiner Schonung mehr. Als du heute ausgegangen warst, besuchte mich Frau Weilert aus Berlin. Sie quälte mich sehr, wieder zu ihr zu kommen. Mutter hat nichts dagegen und ich brauche Beschäftigung. Auch habe ich mich verpflichtet. Krank fühle ich mich gar nicht mehr und deshalb meine ich, von morgen ab sollte ich meine Stellung wieder antreten.“
Robert Tann machte eine großartige Handbewegung.
„Jetzt sorgt dein Vater für dich, mein Kind, und wenn du etwas tun möchtest, dann lerne Sprachen, Musik oder sonst etwas, was zu einer höheren Tochter gehört.“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Ich höre sehr gern Musik, Vater, aber ich verspüre gar keine Neigung dazu, mich selbst damit zu beschäftigen. Sprachen zu treiben, entspräche schon eher meinen Wünschen, aber dazu reichen die Abende und Sonntage. Ich habe meine Näherei liebgewonnen und ich kann bei Frau Weilert viel lernen und abgucken. Ich eröffne dann in einigen Jahren ein Modeatelier, das ist schon seit langem mein Zukunftsideal.“ Sie schloß etwas erregt: „Halte mich nicht zurück, Vater. Denn wenn ich hier mit den Händen im Schoß weiter herumhocke, werde ich verrückt vor lauter Grübeln und Sinnieren. Dann denke ich immer wieder an Heino Staufen und zermartere meinen armen Kopf, weshalb das zwischen uns so kommen mußte. Dann zermartere ich meinen Kopf aber fast noch mehr damit, daß ich herumrätsele, wer wohl der Mensch gewesen sein mag, der das Geld im Stadtwald gefunden hat und wie ich auf seine Spur kommen könnte.“
Sie machte unwillkürlich ein paar lebhafte Schritte auf die Eltern zu.
„O, wenn ich den Menschen fände, wenn es mir gelänge, ihn ins Gefängnis zu bringen, damit die Schande von Heino genommen würde! Vielleicht läse er dann darüber in den Blättern und käme zu mir zurück, hätte mich wieder lieb!“
Mit elementarer Macht überfiel sie der jammervolle Gedanke, daß ihr der Geliebte für immer verloren war, und im Übermaß eines jähen, überwältigenden Schmerzes warf sie die Arme hoch, schrie in förmlicher Ekstase: „Wüßte ich nur, wo dieser Elende wäre, der Heino und mich unglücklich gemacht, ich glaube, ich hätte die Kraft, ihn zu erwürgen.“
Dicht vor Robert Tanns Kinn befanden sich jetzt die nervös bewegten Hände und die Blitze von Elisabeths Augen trafen das verfältelte Ledergesicht.
Mit einem förmlichen Sprung zog sich Robert Tann um ein paar Schritte zurück, so daß Elisabeth die Arme sinken ließ und ihn, ebenso wie seine Frau befremdet anschaute.
Es durchzuckte ihn, er war auf dem besten Wege, sich auffällig zu machen. Und das wäre doch blöd, weder Elisabeth noch seine Frau ahnten, wie nahe die erregten Hände dem gewesen, der zwei Menschen, die sich liebten, unglücklich gemacht.
Er vertröstete sich, hätte er nicht das Geld genommen, dann würde es wahrscheinlich irgendein anderer gefunden und unterschlagen haben. Und er konnte es nicht zurückgeben, es wäre gleichbedeutend mit der Vernichtung seiner Existenz, alle seine Zukunftshoffnungen fielen dann in Trümmer. Und helfen würde er niemand dadurch. Heino Staufen war verschwunden, war wohl schon auf dem Weg nach dem Ausland. Also änderte sich für Elisabeth nichts, gar nichts. Der einzige, der von seinem Bekenntnis Vorteil hätte, war Leonhard Mosbach, der reiche Getreidehändler. Er würde das Geld erhalten, das er noch besaß und er selbst durfte ins Gefängnis spazieren für nichts.
Nein, so opferwillig war er nicht.
Das alles war blitzgeschwind durch seinen Kopf gegangen. Nun scherzte er: „Ich glaubte eben, du würdest mir an die Kehle springen, ich habe mich tatsächlich gefürchtet vor deinen drohenden Händen.“
Seine Frau lachte jetzt.
„Es sah aus, als ob du die Flucht vor Liesel ergreifen wolltest.“
Er lachte auch und dann sagte er, und es war heimliches Lauern in seiner Stimme: „Du blicktest mich eben an, als wäre ich der von dir so sehr gehaßte Mensch. Setzen wir also einmal den Fall, ich wäre es tatsächlich, ich selbst hätte das Geld gefunden! Was tätest du dann? Du würdest doch deinen Vater nicht ins Gefängnis bringen!“
Ihm war während seines Sprechens zumute, als schritte er über einen nur leicht zugefrorenen See, dessen Eis jeden Augenblick unter ihm einbrechen konnte.
Elisabeth ließ die Arme schlaff am Körper herabhängen.
„Ach, Vater, wozu soll ich über die Frage nachdenken, denn du hast ja nichts mit der bösen Sache zu tun, sie spielt doch vor deiner Ankunft.“ Sie warf den schmalen Kopf etwas zurück. „Wenn du aber doch eine Antwort auf die sonderbare Frage haben möchtest, kann ich sie dir auch geben. Also gesetzt den Fall, du wärest der Mensch, der das gefundene Geld unterschlug und ich wüßte es, dann würde ich auf dich genau so wenig Rücksicht nehmen wie auf jeden anderen. Die Schande, die Heino jetzt mit sich herumschleppt, wiegt zu schwer dagegen. Mein eigenes Leid würde ich dir dabei noch nicht einmal in Rechnung stellen.“
Robert Tann lächelte: „Dem Himmel sei also Dank, daß ich unschuldig bin!“ Aber die Antwort hatte ihm doch wehe getan. Er dachte mit heimlicher Qual: Es war ihm bisher leider noch nicht gelungen, Elisabeths Herz zu gewinnen. Sie trug es ihm nach, daß er ihre Mutter und sie einmal so rücksichtslos verlassen hatte.
Er würde viel Zeit dazu brauchen, sie so für sich einzunehmen, wie er es wünschte.
Zehn Jahre hatte er sich nicht um Frau und Tochter gekümmert, zehn lange Jahre.
Die Treue der Frau rührte ihn, schmeichelte seinem Selbstbewußtsein, aber er liebte sie nicht, die ihn förmlich anbetete.
Er hatte sie einmal geliebt, aber das war lange vorbei. Sie war ihm immer zu ergeben gewesen, hatte ihn immer zu sehr bewundert.
Elisabeth sagte müde: „Nicht wahr, Vater, es ist dir recht, wenn ich morgen früh nach Berlin fahre? Denn du willst doch sicher nicht, daß es zur fixen Idee bei mir wird, den Schuft suchen zu müssen, der das Geld unterschlug.“
Robert Tann nickte lebhaft.
„Tue, was du willst und was du für recht hältst, aber bitte, verbohre dich nicht in das, was du ganz richtig als fixe Idee bezeichnest. Du wolltest doch auch eigentlich gar nicht mehr davon sprechen. Und dazu rate ich dir, Kind, dazu rate ich dir noch besonders, denn es regt dich zu stark auf.“
Elisabeth lächelte matt, mit einer kleinen Beimischung von Dankbarkeit.
Am nächsten Morgen fuhr sie nach Berlin.
Sie wollte arbeiten, wollte unter Fremden sein, wollte ständig daran erinnert werden, daß sie ja gar nicht so wichtig war, ständig über ihr Leid nachdenken zu dürfen.
Doch wenn sie sich auch bemühte, von ihrer Unwichtigkeit durchdrungen zu sein bis ins tiefste, weh tat das Leid doch, bitter, bitter weh.