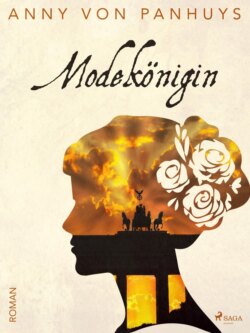Читать книгу Modekönigin - Anny von Panhuys - Страница 6
III.
ОглавлениеElisabeth hatte das einfache, aber schmackhafte Essen, das ihr die Mutter vorgesetzt, hinuntergewürgt.
Der Ärger über den Streit mit Heino Staufen war noch nicht abgeflaut und sie mußte sich sehr zusammennehmen vor der Mutter.
Nach dem Essen setzten sich Martha Tann und ihre Tochter stets zu einem Plauderstündchen auf das Sofa. Auch heute blieb es bei der alten Gewohnheit.
Elisabeth benützte die Gelegenheit, der Mutter von dem Angebot der Berliner Modistin zu sprechen und ihr die Vorteile des Angebots klar zu machen.
Die Mutter blickte nachdenklich.
„Vorteile würdest du in Berlin entschieden haben, aber auch mancherlei Unbequemlichkeiten. Schon die Fahrerei morgens und abends ist anstrengend.“
Elisabeth ließ den Grund nicht gelten.
„Ich stehe eine Stunde früher auf und gehe abends eine Stunde später schlafen, damit sind die Unbequemlichkeiten wohl so ziemlich erledigt. Aber bedenke, Muttchen, ich würde dreimal so viel Gehalt beziehen wie bei Frau Vollhard. Auch könnte ich in Berlin noch viel lernen. Ich würde dort die elegantesten Modelle sehen und wertvolle Erfahrungen sammeln können für meine spätere Selbständigkeit. Außerdem habe ich bei Frau Weilert Aussicht, Modekönigin zu werden. Bares Geld bekäme ich dann, vielleicht tausend Mark oder mehr. Wir würden es gut anwenden, nicht wahr, Mutter?“
Die vergrämte Frau nickte.
„Dann müßten wir hier alles ein bißchen hübscher einrichten, damit sich Vater, wenn er kommt, bei uns wohlfühlt.“
Elisabeth seufzte heimlich. Da fing die Mutter richtig wieder mit ihrer fixen Idee an.
Aber widersprechen würde sie der Mutter nicht mehr.
Nach einem Weilchen sagte Martha Tann: „Tue, was du für klug und richtig hältst, Liesel. Die Hauptsache ist ja wohl Heino. Wenn es ihm recht ist, was du vorhast, ist es ja gut.“
„Und wenn es ihm nicht recht wäre, Mutter?“ fragte Elisabeth langsam und mit Nachdruck.
Martha Tann sah sie groß an und in ihren Augen stand ein Leuchten.
„Brauchst du da überhaupt noch zu fragen, Kind? Wenn der Mann, den du liebst, etwas, was du tun willst, nicht wünscht, dann ist es doch ganz selbstverständlich, daß du es unterlassen mußt. Eine Frau, die liebt, denkt gar nicht darüber nach. Was der Vater wollte, das wollte ich stets auch, nie war das anders. Ehe ich heiratete nicht und auch nachher nicht.“
Elisabeth sah nicht recht ein, warum die liebende Frau blind tun sollte, was der Mann wünschte, aber sie widersprach nicht, weil sie es sich vorgenommen.
Aber als sie die Straßenecke erreichte, wo sie Heino Staufen auf dem Weg ins Geschäft zu treffen pflegte, wurden die Worte der Mutter wieder wach in ihr.
Weshalb war Heino aber auch gleich so schroff und rücksichtslos zu ihr gewesen?
Das hatte ihren Trotz herausgefordert.
Sie dachte, wenn er nun hier stände und auf sie wartete, hätte sie ihm wahrscheinlich nachgegeben. Ein bittendes Wort von ihm hätte sie veranlaßt, Frau Weilert für ihren lockenden Vorschlag zu danken.
Sie ging langsamer, kehrte ein Stückchen um, schaute angestrengt in die Richtung, aus der er kommen mußte, aber umsonst, er schien nicht zum Nachgeben bereit zu sein.
Ihr Trotz erwachte wieder.
All die schmeichelhaften Worte, die ihr Frau Weilert vormittags gesagt, wurden lebendig in ihr.
Ihr Köpfchen legte sich etwas selbstbewußter in den Nacken.
Wenn Heino nicht einsah, wie abscheulich er sich benommen, so warf das kein gutes Licht auf seinen Charakter.
Als sie die Nähstube betrat, wo vier Gehilfinnen und zwei Lehrmädchen eben mit ihren Arbeiten beginnen wollten, wurde ihr gesagt, sie möchte gleich zu Frau Vollhard kommen.
Sie fand ihre Chefin mit Frau Weilert im Wohnzimmer beim Kaffee und sie wurde eingeladen, mitzutrinken.
Elisabeth setzte sich schüchtern an den Tisch.
Zum Kaffee gab es Törtchen und süßen Likör. Elisabeth dachte, so gut hatte ihr noch kein Kaffee geschmeckt, aber sie aß daheim auch nur trockene Brötchen dazu, allerhöchstens des Sonntags ein Stückchen Streusel- oder Napfkuchen.
Das Gläschen Likör erzeugte eine eigentümliche Stimmung in ihr.
Als ihr Else Weilert nun genauer erklärte, wie gut sie es bei ihr haben sollte, dachte sie gar nicht daran, die Antwort zu überlegen oder ihre Zusage hinauszuschieben. Sie war sofort mit einem fast jubelnd klingenden Ja bereit zu allem.
Sie fand die Zukunft, wie sie ihr Frau Weilert ausmalte, ganz herrlich.
Aber plötzlich stiegen ihr die Tränen in die Augen. Sie hatte daran denken müssen, daß Heino sie vorhin nicht erwartet hatte.
Else Weilert blickte sie verwundert an.
„Was ist denn mit einem Male mit Ihnen los, liebes Fräulein? Eben sahen Sie noch aus, als wollten Sie die ganze Welt umarmen, und jetzt scheinen Sie Lust zum Weinen zu haben.“
Die Frauen drangen in sie, ihr Herz zu entlasten.
Da erzählte Elisabeth von Heino Staufen.
Die Inhaberin des Berliner Modesalons verzog ein wenig die Lippen.
„Aber, Kind, wie kann man deswegen so aufgeregt sein! Sie sind töricht, Mädel, ein so brutaler Mensch ist es wirklich nicht wert, daß Sie sich seinetwegen die schönen Augen verderben, Überlegen Sie nur, wenn der sich schon jetzt so aufspielt, wie wird er es dann erst in der Ehe treiben! Wenn er Sie lieb hat, gibt er nach und reißt Sie nicht zurück, wenn Ihnen die Gelegenheit geboten wird, zu etwas zu kommen. Aber ich möchte Sie nicht überreden und lasse Ihnen deshalb nochmals Zeit bis morgen, sich meinen Vorschlag zu überlegen. Ich bleibe bis morgen mittag hier und wenn Sie dann wollen, können Sie mich gleich nach Berlin begleiten.“
Elisabeths Erregung ließ nach. Tiefaufatmend dachte sie, nun blieb ihr Zeit, sich doch noch einmal mit Heino über das Thema zu besprechen. In Ruhe wollte sie alles mit ihm überlegen.
Sie rechnete bestimmt damit, er würde sie diesen Abend erwarten.
Aber er erwartete sie nicht.
Wie befremdend das war!
Sie schlief wenig in dieser Nacht. Ihr war es immer, als höre sie seine geliebte Stimme sagen: „Mein Liesel!“ Und danach klang es wieder schroff an ihr Ohr: „Komm du nur erst wieder zur Vernunft, dann melde dich bei mir!“
Auch am folgenden Morgen traf sie Heino nicht. Da siegte ihr Stolz. Wenn er keine Versöhnung wollte, mochte alles zwischen ihnen zu Ende sein.
Sie begleitete Frau Weilert am frühen Nachmittag nach Berlin, das sie bisher nur wenig kannte.
In der Voßstraße, nahe von Tiergarten und Potsdamer Platz, befand sich der Modesalon der Frau Weilert. Als diese die schlanke Elisabeth Tann den anderen Mannequins vorstellte, traf ihr Blick auf wenig freundliche Mienen.
Ein großes, etwas üppiges Mädchen spöttelte halblaut: „Aus was for ‘n Wachsfigurenkabinett is denn die ausjebrochen?“
Hämisches Lachen vereinte sich zu dünnem Chor.
Elisabeth war es, als stände sie mitten unter Feindinnen.
Frau Weilerts kluges Wieselgesicht wurde spitz und böse.
„Emma, wenn Sie sich nicht anständig aufführen, fliegen Sie, ohne daß Sie einen Platz im Flugzeug zu bezahlen brauchen. Ich wünsche nicht, daß Lili Tann von Ihnen oder einer lieben Kollegin hier ‘rausgegrault wird. Sie steht unter meinem ganz besonderen Schutz. Merken Sie sich das alle, ohne Ausnahme.“
Sie wandte sich an die Direktrice.
„Informieren Sie Lili ein bißchen. Sie ist auch eine gute Schneiderin. Und geben Sie ihr einen passenden Geschäftskittel.“
Sie nickte Elisabeth lächelnd zu und ging, sie ihrem weiteren Schicksal überlassend.
Im nächsten Moment sah sich Elisabeth von den Mädchen umringt und jede gab sich Mühe, recht freundlich zu ihr zu sein. Die große Schneiderstube schien förmlich in wohlwollendes Lächeln gebadet.
Auch die üppige Emma lächelte sie an.
„Wenn dir unse Olle so proteschiert, derf man nich mucksen“, sagte sie und ihr hübsches volles Gesicht strahlte vor Liebenswürdigkeit. „Weißt du, Liliken, eijentlich sind wir hier ja eine Rasselbande, aber schlecht sind wir nich. Du wirst schon mit uns auskommen.“ Sie tippte ihr mit der Spitze der sehr glänzend manikürten Zeigefingerkralle an das runde Kinn. „Ziehe man keinen Flunsch, Liliken, et hat keinen Zweck. Wir sind dir ja nich mehr böse, weil du hübscher bist wie wir. Bewahre! Ich wenigstens nicht! Ich werde mir hüten; Ärger macht dünn, un ich muß „vollschlank“ bleiben. So nennen sich doch heuzutage die Dicken, damit sie wat haben, womit sie sich rausreden können aus ihr Fett. Ich bin als „vollschlank“ angaschiert und muß so bleiben.“
Sie blinzelte schlau.
„Ich kann mir denken, uff dir setzt unse Olle die Hoffnung, du wirst den Vogel abschießen bei der Wahl der Modekönigin. Man sah ihr det ja an der verflixt spitzen Nase an. Un du bist ooch ‘n verdeibelt hübsches Vieh. Ich will ehrlich sein, so im ersten Momang, wo ich dir jesehen habe, hat et in mir anjefangen zu kribbeln. Au Backe, hab ich jedacht, die Kleinstadtkruke schmeißt uns alle wie nischt, die hat ‘ne zu süße Visasche! Aber nu habe ich mir beruhigt. Ich jönne es dir, mir zu überstrahlen. Wenn et dir meine Kollejen eben so ehrlich jönnen, det du ihnen überstrahlst, können wir jleich alle dicke Freundschaft schließen. Hier meine Hand drauf.“
Elisabeth nahm die Hand und drückte sie kräftig. Dabei mußte sie lachen. Das Gemisch von Hochdeutsch und Berliner Jargon kleidete die „vollschlanke“ Emma. Sie wirkte drollig in ihrer Art.
Noch immer lachend fragte sie: „Warum sagen Sie eigentlich „du“ zu mir?“
„Habe ich det vielleicht jetan?“ erkundigte sich Emma mit lustig blitzenden Augen. „Ja? Na, denn is et ja jut! So wat tue ick unbewußt, wenn mir jemand sympathisch is. Wenn ich dir sympathisch bin, darfst du auch „du“ zu mir sagen.“
Elisabeth war einverstanden und Emma Winter gefiel ihr wirklich.
Die Direktrice, Fräulein Ina genannt — eigentlich hieß sie Malvine — war sehr blaß, sehr gepudert und sehr onduliert. Sie reichte Elisabeth eine Art große Schürze aus gelblichem Leinenstoff mit bunter Borte.
„Das is unse Uniform“, erklärte Emma, „wenn wir jar nischt darunter anhaben, is et auch ejal. Man schont durch den Lappen die Kleider, Liliken.“
Jetzt fiel es Elisabeth erst auf, daß die meisten der Mädchen in solchen Kitteln steckten.
Sie sah und hörte an diesem halben Tage viel Neues und als sie abends mit dem Zuge heimfuhr, brummte ihr der Kopf.
Nachdem man zur Nacht gegessen, sagte die Mutter merklich zögernd: „Hast du mir gar nichts zu erzählen, Liesel? Ich meine, nichts Besonderes?“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Ich erzählte dir doch schon vorhin, wie es in Berlin gewesen und wie es mir bei Frau Weilert gefallen hat.“
„Das meine ich nicht“, wehrte Martha Tann ab, „ich meine, hast du mir nichts von Heino Staufen zu erzählen?“
Elisabeth antwortete mit einer Gegenfrage.
„Ist er hier gewesen, Mutter, hat er mich sprechen wollen? Und weshalb war er denn weder gestern noch heute an unseren Treffpunkten? Hat er es dir gesagt?“
Ihre Wangen waren ganz heiß. Nun freute sie sich doch, weil er anscheinend seine Heftigkeit bereute.
Die Mutter antwortete mit ihrer immer müden Stimme: „Nein, er war nicht hier. Aber Frau Schulten, die unter uns wohnt, hat mir erzählt, im Blatt stände, er wäre gestern mittag verhaftet worden.“
Ein entsetzter Aufschrei Elisabeths unterbrach sie.
„Verhaftet?! Muttchen, das kann nicht möglich sein. Was soll er denn getan haben?“ Sie umfaßte die Schultern der schmalen Frau mit leidenschaftlicher Heftigkeit. „Bitte, sage mir, daß es nicht wahr ist, bitte, sage es mir!“
Martha Tann schüttelte den Kopf.
„Das kann ich leider nicht. Im Blatt steht, er soll einen plumpen Schwindel mit zwanzigtausend Mark gemacht haben, die er von der Firma Mosbach einer anderen Firma bringen mußte. Es heißt, er hat der Polizei das leere aufgerissene Geldkuvert gebracht und hätte dazu eine Räubergeschichte erzählt. Kurz, man deutet an, er habe das Geld unterschlagen. Jedenfalls sitzt er jetzt im Gefängnis.“ Sie seufzte tief. „Ich traue das Heino Staufen nicht zu, aber er mußte doch anscheinend sehr belastet sein.“
Sie sah, Elisabeth kämpfte gegen einen Schwächeanfall an, weil sie die Hiobspost nicht fassen konnte.
Sie sagte beruhigend: „Ich hätte so gern, ach, so gern geschwiegen, aber ich mußte sprechen. Es ist tausendmal besser, du hörst die häßliche Geschichte aus meinem Mund, als aus dem irgendeiner Klatschbase. Du bist nun wenigstens vorbereitet.“
Elisabeth ging langsam durch das Zimmer, blieb vor der Mutter stehen.
„Ich kann und kann es nicht glauben, was du mir eben mitteiltest, Mutter. Es muß sich um einen Irrtum handeln. Heino hat bestimmt kein Geld unterschlagen.“ Sie schloß hastig: „Ich will gleich zu Frau Schulten hinuntergehen, ich muß es in der Zeitung selbst lesen, sonst glaube ich nicht, daß jemand es wagt, eine so gemeine Lüge zu drucken. Die gemeinste aller Lügen!“
Die Mutter wollte sie zurückhalten, aber Elisabeth hörte ihr Rufen gar nicht mehr, so eilig war sie davongestürmt.
Frau Schulten war eine bescheidene Kleinbeamtenwitwe. Sie lebte von einer knappen Pension und strickte für ein Geschäft Wollsachen. Sie suchte für Elisabeth sofort die betreffende Zeitung heraus.
Gutmütig mahnte sie: „Regen Sie sich nicht zu sehr auf, Liesel, die Männer sind es gar nicht wert, daß wir ihretwegen leiden. Ich weiß, Sie waren halb und halb mit Staufen verlobt, aber wo er nun solche Sachen ausgefressen hat, werden Sie wohl schnell mit ihm Schluß machen müssen, sonst schaden Sie sich.“
Elisabeth zitterte vor Aufregung. Ihre Hand, die das Blatt entgegennahm, flog hin und her, als wäre die wenig umfangreiche Zeitung zu schwer für sie.
Da stand:
„Gestern wurde Heino Staufen, der zweite Buchhalter der Getreidefirma L. Mosbach, auf dem Polizeibureau am Marktplatz verhaftet. Er erschien dort sehr aufgeregt und gab an, im Eichenwald einen versiegelten Umschlag mit zwanzigtausend Mark verloren zu haben den er in der Innentasche seines Rockes aufbewahrt hatte. Als er den Verlust bemerkte, wäre er eilig den Weg, auf dem er gekommen, wieder zurückgelaufen und hätte den aufgerissenen Umschlag leer an der Stelle gefunden, wo er ihn verloren haben müsse. Er erinnere sich, mit dem Arm, über den der ausgezogene Rock hing, hin- und hergeschlenkert zu haben. Er hätte den Rock ausgezogen, weil ihm zu warm geworden. Beim Schlenkern des Armes müsse das Geld, das er völlig vergessen, aus seiner Tasche gerutscht sein. Heino Staufen hat das Geld mittags nach Geschäftsschluß bei der Firma Klymann abgeben sollen. Er zog es statt dessen vor, einen Waldspaziergang zu unternehmen in der Zeit, wo er sonst zu essen pflegte. Staufen genießt sehr guten Leumund, aber seine Erzählung machte einen stark phantastischen Eindruck. Er bestreitet jede Schuld.“
In Elisabeths Augen blitzte es auf, und das Blatt zurückgebend, sagte sie sehr erregt: „Heino Staufen hat Unglück gehabt, auch leichtsinnig ist er gewesen, aber man hatte kein Recht, ihn zu verhaften.“
Die alte Frau nickte.
„Die Liebe glaubt alles, die Polizei ist weniger gläubig.“
Elisabeth hatte einen verzweifelten Blick. Sie vergaß zu grüßen und eilte zur Mutter hinauf.
Sie sank vor der schmalen kleinen Frau in die Knie.
„Mutter, man schmäht Heino, man klagt ihn an. Ich habe es selbst gelesen. Und wenn er auch heftig ist, so lügt er doch nicht. Und er ist auch keiner Unterschlagung fähig. Mich hat er durch seine Heftigkeit gekränkt. Er wollte nicht, daß ich die Stellung in Berlin annehmen sollte. Magst du es nur wissen! Und in der Verzweiflung über unseren Streit lief er mit dem vielen Geld, das er wegtragen sollte, im Stadtwalde herum und verlor es. Irgendein Lump, ein schlechter, unehrlicher Kerl wird dann die Scheine gefunden haben. Der Himmel mag wissen, wohin der Lump mit dem Geld verschwunden ist, und der arme Heino wird nun verdächtigt. Er, der beste und ehrlichste Mensch.“
Sie legte ihren Kopf in den Schoß der Mutter.
„Was soll ich tun? Ich muß ihm beistehen, ihm helfen. Wollen gründlich nachdenken, Mutter, was ich für ihn tun kann.“
Sie sprang auf.
„Morgen früh laufe ich zur Polizei und erzähle von unserem Streit“, rief sie, „dann wird man begreifen, weshalb Heino um die Zeit, wo er sonst zu essen pflegte, wie es in der Zeitung heißt, einen Waldspaziergang unternahm.“
Martha Tann nickte ihr zu.
„Versuche ihn zu entlasten, wie immer du es auch anfängst! Und jetzt gehe zur Ruhe, Kind, versuche zu schlafen. Guter Rat kommt über Nacht.“
Elisabeth hätte wer weiß was dafür gegeben, wenn sie heute nacht ein Schlafzimmer für sich allein zur Verfügung gehabt hätte, wenn sie sich so recht von Herzen hätte ausweinen dürfen. Aber der Schlaf der Mutter sollte nicht gestört werden.
Sie drückte das brennende Gesicht tief in die Kissen, um das mühsam gebändigte Schluchzen zu ersticken, damit die Mutter nichts hörte, deren Bett drüben an der Wand stand.
Die Nacht zeigte ihr Schreckbild um Schreckbild.
Man würde Heino verurteilen, weil man annahm, er habe das Geld unterschlagen, und sie klagte sich an, die Schuld an dem Unglück zu tragen. Hätte sich Heino nicht gestern mittag so sehr über sie geärgert, hätte er seine Pflicht nicht vergessen.
Ihr kam der Gedanke, zu Heinos Chef zu gehen, er mußte den Geliebten entlasten.
Er konnte das wohl am besten.
In aller Herrgottsfrühe erhob sie sich aus dem Bett, das für sie diese Nacht zu einem Marterlager geworden, und wusch sich in der Küche.
Nachdem sie sich fertig angekleidet, setzte sie sich in der Wohnstube ans offene Fenster, um sich die schmerzende Stirn von der Morgenluft kühlen zu lassen.
Immer fester ward ihr Entschluß, zur Firma Mosbach zu gehen und mit Heinos Chef zu sprechen.
Sie atmete tief die erquickende Luft ein, die sie belebte, und versuchte sich damit zu trösten, man könne den Geliebten ja nicht lange festhalten, weil er unschuldig war.
Sie bereitete den Kaffee und nachdem sie später mit der Mutter gefrühstückt, wobei sie nur wenige Bissen genoß, machte sie sich zum Ausgang bereit.
Martha Tann mahnte: „Aber Liesel, du mußt doch nach Berlin fahren, nun du die Stellung angenommen hast.“
Ihre Tochter schien gar nicht daran zu denken, daß sie seit gestern mittag ihre Stellung gewechselt.
Elisabeth drückte das Hütchen tiefer in den Kopf.
„Das ist unwichtig, Mutter, jetzt vermag ich nur an Heino zu denken.“
Die vergrämte Frau, die ihren Mann noch immer liebte, obwohl er leichten Herzens von ihr gegangen, die förmlichen Kultus mit ihrer Liebe trieb, fand Elisabeths Antwort völlig richtig.
Was lag an einer Stellung, wenn es sich um das Wohl des Geliebten handelte?
Wie nebensächlich dagegen alles, einfach alles!