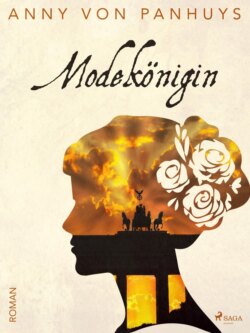Читать книгу Modekönigin - Anny von Panhuys - Страница 14
XI.
ОглавлениеHeino Staufen fuhr mit der Jacht „Lobo“ Spanien entgegen. Langsam, o, so langsam ging es. Unbegreiflich langsam.
Heino wunderte sich darüber und wagte eine Frage.
Frau Espada lächelte, wie sie stets lächelte, wenn sie mit Heino Staufen sprach.
„Wir haben doch keine Eile, gar keine Eile, und wo kann es denn schöner sein als auf dem Meer! Wir werden sogar noch tüchtig kreuzen, um den Aufenthalt unterwegs zu verlängern. Sie haben ja gleichfalls keine Eile und kommen immer noch zurecht.“
Heino stand auf dem Sonnendeck und sein Blick flog verloren weit über das Meer hin. Die blonde Frau hatte sich wieder entfernt und er befand sich nun allein. Er war es gewöhnt, allein zu sein. Ricardo Espada saß meist unten in seiner Kabine in seine Arbeiten vertieft.
Welcher Art die waren, wußte Heino nicht.
Die blonde Frau hatte ihm nur erklärt, ihr Mann arbeite am liebsten während der Seefahrt, daheim wäre er lange nicht so tätig.
Außer den Mahlzeiten sah ihn Heino Staufen wenig.
Es war ihm aber nur angenehm, er fühlte sich in der Nähe des Spaniers niemals besonders wohl und empfand heimliche Scheu vor seinem tastenden verschleierten Blick.
Heino seufzte, sein Herz tat ihm weh. Er dachte daran, daß er Elisabeths Bild zerrissen und die Fetzen ins Meer hatte hinunterfallen lassen. Aber auch ohne ihr Bild erblickte er sie immer wieder mit schmerzhafter Deutlichkeit.
Auch jetzt war die blonde Lieblichkeit wieder da, forschte mit großen Augen: Mußte es sein, das böse Auseinandergehen, ohne ein letztes gutes Wort, ohne einen letzten warmen Händedruck? Mußte es überhaupt sein, daß du so weit von mir fortgegangen bist?
Heino Staufen war es, als husche etwas an ihm vorbei.
Er blickte nach links und sah den chinesischen Steward ganz in seiner Nähe. Und nun tappte er auch schon wieder auf ihn zu, der widerwärtige Mitleidsblick, der ihn so sehr an dem kleinen mageren Männchen störte.
Er wollte seinen Platz wechseln, als es ganz leise an sein Ohr drang: „Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“
Heino stutzte und begriff den sonderbaren Satz nicht.
„Was meinen Sie damit, Mann? Reden Sie, bitte, etwas deutlicher.“
Er sagte es ziemlich laut in befehlendem Ton.
Der Chinese tat, als verstände er keine Silbe, ja als höre er überhaupt nichts. Um seine Lippen hing das rätselhafte, geheimnisvolle Lächeln der Asiaten und mit hastigen Schritten glitt die kleine Gestalt davon.
Heino Staufen hätte meinen können, alles wäre nur Einbildung gewesen, wenn es nicht immer noch allzu deutlich in ihm nachklänge: „Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“
Der eigentümliche Satz hatte zugleich etwas Komisches und Furchterregendes, so sinnlos er auch schien.
Was für einen Tisch hatte der Chinese gemeint und vor allem, wer war der Doktor?
Auf der Jacht befand sich doch gar kein Arzt.
In einiger Entfernung ließ sich die blonde Frau eben in einem Liegestuhl nieder. Sie blickte zu ihm herüber und er wagte sich näher, wartete darauf, daß sie ihn anredete.
Sie tat es, sprach begeistert von dem herrlichen Wetter.
Er meinte: „Es ist doch eigentlich bedauerlich, daß Ihr Gatte die wundervollen Tage in der Kabine verbringt. Verzeihen Sie meine Neugier, gnädige Frau, wenn ich frage, welches Fach betreibt Ihr Gatte? Ich habe schon öfter darüber nachgesonnen, daß Privatgelehrter ein weiter Begriff ist. Er kann sowohl Historiker sein wie Ägyptenforscher, sowohl Botaniker wie Numismatiker. Es gibt ja so viele Wissenschaften und Interessengebiete.“
Die blonde Frau sah fast stolz aus, als sie antwortete: „Mein Mann ist Mediziner, Herr Staufen.“
„Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“ schwirrte es alarmierend durch seinen Kopf.
Sein Atem ward schwer, und er hätte nicht einmal sagen können weshalb. Der Satz des Chinesen war doch Unsinn, verdiente nicht, daß er darüber nachdachte.
Weshalb würgte ihn nur mit einem Male gräßliche Furcht?
„Fühlen Sie sich nicht wohl?“ fragte ihn die blonde Frau. „Sie sind plötzlich ganz blaß geworden.“
„Das kommt nur von der ungewohnten Seefahrt“, erwiderte er hastig.
Sie nickte nur und schien mit ihren Gedanken beschäftigt zu sein.
Endlich hob sie den Blick zu ihm auf.
„Sie sollten meinen Mann besuchen, ich glaube, Sie waren noch gar nicht in seinem Studierzimmer. So großartig benennen wir nämlich die Kabine, in der er arbeitet. Er äußerte zufällig gerade vorhin, Sie möchten sich doch einmal bei ihm sehen lassen.“
Es war so etwas Harmloses und Einfaches, was ihm die blonde Frau vorschlug, aber Heino Staufen empfand es unangenehm.
Er verspürte nicht die geringste Lust, jetzt Ricardo Espada aufzusuchen.
Es war wie heimliches Widerstreben in ihm.
Leider durfte er nicht mit einem schroffen „Nein“ antworten, durfte sich keine Unhöflichkeit zuschulden kommen lassen.
Weil er kein zahlender Passagier war, sondern nur einer, den man aus Mitleid mitgenommen.
„Gehen Sie doch gleich zu meinem Mann, er wird sich freuen“, drängte Frau Espada, „ich schließe mich an, wenn es Ihnen recht ist und melde Sie bei ihm an. Mein Ricardo ist manchmal ein bißchen zerstreut.“
Schon erhob sie sich und ging ihm voran zur Treppe. Er konnte nicht anders als ihr folgen.
Und er dachte, er durfte sich doch nicht von irgendeiner dumpfen, unklaren Stimmung unterkriegen lassen. Von einer Stimmung, die ihren Ursprung hatte in den geheimnisvollen Worten des Chinesen. Sinnlose, törichte Worte eines Narren, der vielleicht mühsam ein paar deutsche Brocken aufgegabelt und sie nun willkürlich zusammensetzte.
Es war jetzt so wunderschön hier oben in freier Luft, es reizte ihn gar nicht, sich mit dem Spanier zu unterhalten.
Schon ward die Tür vor ihm geöffnet und er hörte Frau Espadas Stimme sagen: „Hier bringe ich dir Besuch, lieber Ricardo.“
Die Kabine des Spaniers war verhältnismäßig groß. Man sah einen kleinen Schreibtisch und mehrere niedrige Wandschränke mit Büchern.
Eine Seite des Raumes war durch einen grünen Vorhang abgeteilt.
Ricardo Espada war äußerst liebenswürdig, er brachte eine Flasche Likör herbei, nachdem er Platz genommen hatte.
„Mögen Sie ein Gläschen? Es ist ganz famoses Mönchsgebräu. Ich selbst bin zur Zeit Antialkoholiker, weil ich mit einer sehr wichtigen Facharbeit beschäftigt bin und meine Frau trinkt nie etwas. Ich bitte Sie aber, auf uns keine Rücksicht zu nehmen und die Marke zu probieren.“
Er schenkte ein feingeschliffenes Gläschen voll.
Heino Staufen sah zu, wie der goldfarbene Likör schwer und ölig aus der Flasche in das Gläschen rann, und dabei hörte er wieder ganz deutlich die Stimme des Chinesen sagen: „Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“
„Kosten Sie nur einmal, Herr Staufen, danach werden Sie zugeben, es ist der beste Likör, der jemals über Ihre Lippen gekommen ist“, ermunterte ihn Ricardo Espada.
Großer Achtung vor der goldene Schnaps!
Hörte er es nicht überlaut? War es nicht, als wenn es die Stimmen von Riesen überlaut hinausbrüllten?
Er wehrte mit mühsam erzwungenem Höflichkeitslächeln ab.
„Vielen Dank, Herr Espada, aber Schnäpse und Liköre trinke ich prinzipiell nicht.“
„Prinzipien sind dazu da, daß man sie gelegentlich umwirft“, widersprach der Spanier mit vollendeter Liebenswürdigkeit und streichelte seinen kurzen Spitzbart nach oben. „Werfen Sie also Ihr Prinzip, keinen Likör zu trinken, ruhig einmal um. Sie wissen: Einmal ist keinmal! Mir liegt daran, Ihr Urteil über den Likör zu hören. Bei meinen Bekannten in Deutschland habe ich damit immer Ehre eingelegt.“
„Kosten Sie ihn nur!“ lächelte ihn jetzt die blonde Frau an.
Heino Staufen fand, sie konnte zwar charmant lächeln, aber nach dem Likör langte er trotzdem nicht.
Die seltsamen Worte des Chinesen scheinen ihm nicht mehr sinnlos hingesprochen.
Der Beweis war wohl dadurch erbracht, daß man ihm wirklich den goldenen Schnaps anbot, vor dem der Chinese gewarnt hatte.
Er entgegnete höflich, doch bestimmt: „Ich bitte es mir nicht zu verübeln, aber ich habe direkten und unbezwinglichen Widerwillen gegen derartige Spirituosen.“
Er bemerkte deutlich, wie sich zwei scharfe Falten auf der Stirn des Spaniers bildeten, wenngleich ein mattes Lächeln um seinen Mund hängen blieb.
Er schien etwas sagen zu wollen, unterdrückte es aber, meinte nach geraumer Zeit: „Also lassen wir den Likör, plaudern wir ein wenig. Diese Kabine ist mein Tuskulum, hier fühle ich mich wohl, hier arbeite ich am liebsten. Viel lieber als auf dem festen Land. Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Verbesserung der Röntgenphotographie. Es handelt sich um sofortige Entwicklung der Platten und um enorme Verbilligung der ganzen Sache, so daß sich der kleinste und ärmste Arzt einen Apparat anschaffen kann, wenn meine Erfindung erst einmal der Allgemeinheit übergeben worden sein wird.“
Er rieb seine schmalen, hart wirkenden Hände gegeneinander.
„Ich probiere nun schon seit längerer Zeit mit meinem Apparat an allem Lebenden herum, was mir in den Weg gerät. Meine arme Frau ist mein bevorzugtes Opfer.“
Er hob den verschleierten Blick.
„Wie wäre es, Herr Staufen, würden Sie sich nicht auch einmal für den guten wissenschaftlichen Zweck zur Verfügung stellen? Ich möchte mit meinem neuen Apparat eine Aufnahme Ihres inneren Menschen machen.“
Heino fand, den Gefallen mußte er dem Spanier eigentlich tun. Es wäre wenigstens eine geringe Erkenntlichkeit für die Gastfreundschaft, die er hier genoß.
„Ich bin noch nie geröntgt worden“, gab er zurück. „Bedarf es dazu von meiner Seite besonderer Vorbereitungen?“
Ricardo Espada verneinte.
„Bewahre! Es ist eine höchst einfache Sache. Sie legen sich ohne Kleider auf eine Art langen Tisch und ich schiebe Ihnen den Aufnahmeapparat an die betreffenden zu durchleuchtenden Körperstellen.“
Er erhob sich, zog den grünen Vorhang, der ein Stück der Kabine verhüllte, beiseite und Heino Staufen sah ein Etwas, das einem Operationstisch so verzweifelt glich, daß ihm ein Frösteln über den Rücken ging.
Genau so einen Tisch hatte er einmal gelegentlich in einem Krankenhause gesehen.
Es war plötzlich ein dumpfer Schreck in ihm, der ihm sekundenlang die Zunge lähmte.
Und weiter trat die Erinnerung an den chinesischen Steward vor ihn hin. Der gar so sonderbaren Warnung mußte doch etwas Besonderes zugrunde liegen. Er durfte sie nicht in den Wind schlagen.
Er zwang sich zu einem leichten Ton.
„Über die Röntgenaufnahme sprechen wir noch, nicht wahr? Es braucht wohl nicht allzu bald zu sein?“
Ricardo Espadas Augen senkten sich zwingend in die seinen.
„Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich möchte Sie schnellstens um die Gefälligkeit bitten. Ich schlage vor, wir lassen keine Nacht mehr verstreichen und machen uns sofort ans Werk.“
Heino Staufen störte der zwingende Blick, der ihn nicht losließ.
Ricardo Espada schien ihm seinen Willen suggerieren zu wollen. Hypnotisch. Er spürte mit heimlicher Angst das Nachlassen seines eigenen Willens. Wie ein Narkotikum wirkte der Blick dieser verschleierten Augen, in deren Dunkel doch so viel gesammelte Energie lag.
Er gab sich einen innerlichen Ruck. Wehrte sich kraftvoll gegen die verschleierten Augen, die Zwang auf ihn ausübten.
Er entzog dem anderen den Blick, sah die blonde Frau an, deren Züge deutlich Spannung verrieten.
Die erst sinnlos scheinenden Worte des Chinesen wurden zu immer bedeutungsvollerer Warnung.
Die Luft in der Kabine bedrückte ihn.
Ohne Ricardo Espada anzublicken, sagte er: „Verzeihung, Herr Espada, aber mit dem besten Willen wäre es mir unmöglich, sofort Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich fühle mich gar nicht wohl und möchte in meine Kabine gehen, mich ein Weilchen niederlegen.“
Er verbeugte sich und wollte zur Tür.
„Wenn Ihnen nicht wohl ist, trinken Sie nur ein Likörchen, verehrter Herr Staufen, das wird Sie ungemein anregen“, empfahl der Spanier und vertrat ihm den Weg.
Der zwingende Blick kam schon wieder auf ihn zu und Heino Staufen dachte, der Blick war wie ein Lasso, mit dem er eingefangen werden sollte, der Blick war wie eine geschickt aufgestellte heimliche Falle, in die man ihn hineindrängen wollte, wenn er nicht von selbst hineintappte.
Der grüne Vorhang war noch immer zurückgezogen, der lange, weiße eiserne Tisch schien ihm das unheimlichste Möbel der Welt.
Er erwiderte fast scharf: „Bedauerlicherweise ist es mir jetzt einfach unmöglich, Ihren Wunsch zu erfüllen, und Likör erregt mir Ekel.“
Er beschrieb einen kleinen Bogen um Ricardo Espada und erreichte so die Tür. Er öffnete sie schnellstens und sah sich nicht mehr um. Er mochte den Operationstisch nicht mehr sehen. In einem Krankenhause oder in der Wohnung eines Arztes wäre er am richtigen Platz gewesen, aber hier in der kleinen Kabine der Jacht, die über das schimmernde Meer zog, schien er ihm ein Schreckgespenst.
Er eilte in seine Kabine, schloß sich ein und sann nach. Er kam zu dem Ergebnis, sich zuletzt sehr sonderbar und unhöflich gegen den Spanier benommen zu haben.
Als Gast hatte man die Pflicht, sich größter Höflichkeit gegen seinen Gastfreund zu befleißigen.
Nun er sich allein befand, dünkte ihm seine Angst blöd und lächerlich. Ebenso blöd und lächerlich wie der Satz des Chinesen.
Was würde denn geschehen sein, wenn er ein Gläschen von dem Goldgelben hinuntergeschluckt hätte? Und was würde denn geschehen sein, wenn er ein paar Röntgenaufnahmen seines Körpers hätte machen lassen?
Harmlosigkeiten waren durch den albernen Chinesen zu Wichtigkeiten geworden.
Er schämte sich seines Benehmens gegen den Spanier.
In der Kabine Ricardo Espadas, in seinem sogenannten Arbeitszimmer, saß sich das Ehepaar gegenüber und blickte sich stumm fragend an.
Auf des Doktors Stirn lagen die Falten so tief wie schmale Rinnen.
„Verstehst du das merkwürdig aufsässige Benehmen des Menschen?“ sagte er leise, als fürchte er Lauscher. „Er benahm sich ja geradezu herausfordernd. Man könnte fast glauben –“
Er brach nachdenklich ab und die Frau vollendete: „Man könnte fast glauben, er wäre gewarnt worden.“
Sie sprachen jetzt Spanisch.
Er nickte: „Ja, das könnte man fast glauben. Aber wer sollte es getan haben? Unsere Leute kümmern sich nicht darum, was wir tun, auch wissen sie nichts.“ Er blickte finster. „Weiß der Teufel, warum sich der Mensch so gegen alles sträubte. Rätselhaft und unbegreiflich im höchsten Grade ist es.“
Die blonde Frau machte eine nachlässige Handbewegung.
„Ricardo mio, wir bilden uns das alles vielleicht nur ein, weil wir – unter uns gesagt – ein schlechtes Gewissen haben. Wer hätte ihn warnen können? Es ist alles nur ein einfacher Zufall, was uns Absicht scheint. Er wird in Wirklichkeit keinen Likör mögen und weshalb soll ihm nicht einmal etwas flau zumute sein? Ich fand, er sah sehr bleich aus. Es fiel mir besonders auf. Und wenn er heute keine Lust hat, auf deine Bitte einzugehen, so hat er es doch versprochen. Was heute nicht gelungen ist, gelingt vielleicht morgen.“
Ricardo Espada wurde nicht so schnell mit seinem Unmut fertig.
„Es hätte gerade heute so gut gepaßt und ein verlorener Tag bedeutet für die große Sache unendlich viel“, brummte er verstimmt.
Sie erhob sich, zog ihn von seinem Stuhl hoch und legte ihre Arme um seinen Hals, während sie mit hinreißender Innigkeit zu ihm aufblickte.
„Ärgere dich nicht um den verlorenen Tag, Liebster. Es wird mir gelingen, ihn noch heute so weit zu bringen, daß er morgen freiwillig zu dir kommt und sich anbietet, sofort deinen Wunsch zu erfüllen. Ich habe das sichere Gefühl, er ist wunderbar für das Experiment geeignet. Soviel wissen wir ja, er ist ein armer Schlucker. Er wird später froh und glücklich sein, wenn er eine größere Summe Geld erhält und wenn alles gut gelungen ist. Ich rechne diesmal bestimmt mit dem Gelingen. Dann aber, wenn du den bewiesenen Erfolg auf deiner Seite haben wirst, kräht kein Hahn danach, wie und an wem du deine Erfindung ausgeprobt, du brauchst dann deine Versuche nicht mehr heimlich zu machen, als wären sie Verbrechen. Es werden sich Freiwillige genug für deine weiteren Versuche zur Verfügung stellen.“
Ricardo Espadas eben noch so finstere Stirn hatte sich entspannt.
„Du findest immer die richtigen Worte für midi, du einzige Frau, du einzig lieber Mensch. Ich will mich also bis morgen gedulden.“ Er küßte sie leidenschaftlich. „Daß ich dich auf meinem Wege fand, ist schon so ein überreiches Glück, mehr darf ich eigentlich vom Schicksal gar nicht verlangen. Viel zu vermessen ist der Wunsch, auch noch mein wissenschaftliches Lebenswerk gekrönt zu sehen.“
Sie flüsterte voll heißer Inbrunst: „O du, mir ist ganz wirr vor Glück zumute, wenn ich mir vorstelle, was du dann für die Menschheit getan hast! Wie man dich verehren wird! Ricardo, Geliebter, ich bin ja so über alle menschlichen Begriffe stolz auf dich. Und der Sieg wird dein, glaube es mir, er ist dir sicher!“