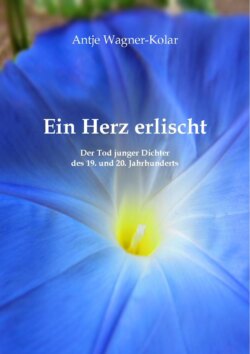Читать книгу Ein Herz erlischt - Antje Wagner-Kolar - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 Realismus (ca. 1850-1890)
ОглавлениеDer literarische Realismus war sehr gesellschaftskritisch angehaucht und ist als Werkzeug der nun Form annehmenden Objektivität in den Werken seiner Zeit zu sehen. Reale Ereignisse wurden aus Distanz beschrieben und hielten den Lesern den Spiegel der Gesellschaft vor. Diese Art von Gesellschaftsromanen war ebenso typisch für jene Literaturperiode wie es Novellen und auch bäuerliche Romane (z.B. „Waldheimat“ von Peter Rosegger) waren.
Die politischen Verhältnisse dieser Zeit – hier nur kurz angeschnitten, um die Auswirkungen zu verstehen – waren folgende: Seit 1848 regierte die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn unter dem österreichischen Kaiser Franz Josef, 1871 wurde Otto von Bismarck deutscher Reichskanzler. In den Zeiten des Umschwungs und der Neuorientierung entstanden Werke wie das „Kommunistische Manifest“ von Marx und Engels, Fontanes „Effie Briest“, Storms „Schimmelreiter“ und der teils autobiografische Roman „Der grüne Heinrich“ von Gottfried Keller.
Auch die Gründerjahre (1865-1873) fallen in diese Zeit. Die Epoche nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs war geprägt von zahlreichen Entstehungen von Unternehmen und Aktiengesellschaften, das Schienennetz wurde ausgebaut, und immer mehr privates Kapital wurde in die Wirtschaft investiert. Die Elektrizität wurde erfunden. Kriege wurden geführt (z.B. der preußisch-österreichische 1866 und der deutsch-französische Krieg 1870/71), die Weltwirtschaftskrise nahm ihren Lauf.
Zu realisieren, dass die einstige Weltvorstellung der Romantik nichts (mehr) mit dem Alltag und seinem Werdegang zu tun hatte, ließ viele Künstler innerlich zerbrechen. Eine Welt brach buchstäblich zusammen, die Revolution war gescheitert. Nicht ohne Grund ist die Selbstmordrate während der Jahre 1856–1861 enorm gestiegen, die Zahl der Suizidalen extrem hoch, wie die folgende Statistik – hier ein Beispiel aus Frankreich – zeigt:
Statistische Tabelle der Selbstmorde in Frankreich 1856-61:
| Ursache unbekannt: | 2.139 |
| Lebensüberdruss: | 951 |
| Geisteskrankheit: | 7.421 |
| mit Geistesstörung verbundene Leidenschaften: | 24 |
| körperliche Leiden: | 2.651 |
| Leidenschaften: | 745 |
| Laster: | 2.732 |
| Kummer über andere: | 331 |
| Zwist in der Familie: | 2.600 |
| Kummer über Vermögensverhältnisse: | 2.764 |
| Unzufriedenheit mit der Lage: | 253 |
| Reue und Scham: | 158 |
| Furcht vor Strafe: | [568] 1.528 |
| Selbstmord nach Mord: | 165 |
(Quelle: Kirchner, Friedrich / Michaëlis, Carl: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Leipzig 1907, S. 565-568)
Kulturpessimismus als Gegenform des Fortschrittglaubens beherrschte viele Teile der Künstlerszene. Ein Ende der Misere des sozialen und geistigen Elends beim Proletariat Ende des 19. Jahrhunderts war nur noch durch einen apokalyptischen Umbruch zu erwarten. Wer nicht warten wollte, beging Selbstmord. Aufgrund der hohen Suizidrate verbot das Reichsgesetz vom 13. Mai 1873 „über die Grenzen kirchlicher Straf- und Zuchtmittel“ die Diskriminierung von Selbstmördern. Letztlich hatte die Kirche nur noch die Möglichkeit, ihre Mitwirkung beim Begräbnis zu untersagen. Lediglich bei „notorischer Unzurechnungsfähigkeit“ konnte ein Begräbnis kirchlich stattfinden.
Trotz der neuen Gesetze zum Schutz der Unglücklichen gab es weiterhin die „Selbstmörderecken“ auf Friedhöfen, oder gar aufgrund der Ausweitung ganze Selbstmörderfriedhöfe (u.a. der dem weiter unten ein eigenes Kapitel gewidmetem Dichter Georg Heym lag auf einem solchen).
“Der Tod Chattertons” Henry Wallis (1856)