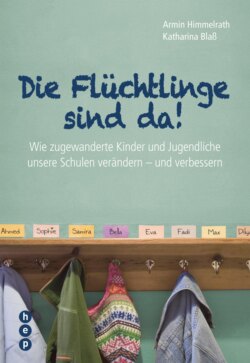Читать книгу Die Flüchtlinge sind da! - Armin Himmelrath - Страница 11
So viel zur Theorie – doch wie sieht die Praxis aus?
ОглавлениеDie internationalen Schulleistungsstudien IGLU und PISA, die auch einen Einblick in die Ursachen des schlechteren Abschneidens junger Migrantinnen und Migranten im deutschen Schulsystem ermöglichen, zeigen: In Deutschland gestaltet sich die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund ins Schulsystem besonders problematisch. Bereits in der Grundschule bestehen Unterschiede im Kompetenzniveau zwischen Lernenden mit und ohne Migrationshintergrund. Diese Unterschiede nehmen dann im Laufe des Sekundarbereichs noch einmal deutlich zu. Eine besondere Rolle bei der Erklärung der Unterschiede spielen der soziale Hintergrund der Schülerinnen und Schüler sowie das Ausmaß des Gebrauchs der deutschen Sprache innerhalb der Familien (vgl. Siegert 2008).
Die Daten aus amtlicher Bildungsstatistik (Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg), Schulleistungsstudien wie IGLU und PISA (schulische Kompetenzen) sowie dem Mikrozensus (allgemeines Bildungsniveau der deutschen Bevölkerung) zeigen: Ausländische Lernende gehen seltener auf Realschulen oder Gymnasien als deutsche, dafür aber deutlich häufiger auf Haupt- und Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Ausländische Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule deutlich häufiger ohne einen allgemeinbildenden Schulabschluss als deutsche. Darüber hinaus erzielen sie häufiger einen Hauptschulabschluss und seltener einen Realschulabschluss oder die Fach- oder Allgemeine Hochschulreife (vgl. Siegert 2008).
Anhand des Mikrozensus 2006 lässt sich zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger über keinen allgemeinen Bildungsabschluss verfügen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Hinsichtlich der vorliegenden Bildungsabschlüsse sind die Unterschiede dagegen eher gering (vgl. Siegert 2008). Aber nicht nur Deutschland bescheinigt die OECD strukturelle Schwächen im Bildungssystem für Migrantinnen und Migranten: In den meisten europäischen Ländern haben Schülerinnen und Schüler aus Migrantenfamilien einen weniger günstigen sozioökonomischen Hintergrund als einheimische, auch der Bildungsstand der Eltern ist geringer.
Volle Klassen, zu wenig Personal: In vielen Grundschulen ist die Klassenobergrenze von 29 Kindern erreicht. »Zu volle Klassen gefährden den Bildungsauftrag der Grundschulen und führen angesichts der großen Herausforderung der inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Handicap und zugewanderten Kindern zu weniger anstatt mehr Bildungsgerechtigkeit«, sagt Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Nordrhein-Westfalen (VBE Nordrhein-Westfalen 2016). Grundschulen hätten den Auftrag, alle schulpflichtigen Kinder eines Jahrgangs aufzunehmen und sie dem Grad ihrer individuellen Entwicklung entsprechend zu fördern. In manchen Bezirken von Berlin werden aber beispielsweise immer wieder Flüchtlingskinder abgelehnt, weil es nicht genügend Plätze in den überfüllten Willkommensklassen gibt. »Der Verteilungszufall entscheidet über den Bildungserfolg«, sagt Tobias Klaus von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, denn das Grundrecht auf Schulbesuch wird in jedem Bundesland unterschiedlich ausgelegt (Reiter 2015).
Darüber hinaus müssen Lehrerinnen und Lehrer in Willkommensklassen ihre Unterrichtsmaterialien immer noch mühsam zusammensuchen – geeignete Schulbücher, die Altersstruktur, ethnische Herkunft und die unterschiedlichen Sprachstände abbilden, gibt es bislang kaum.
Auch das Personal in den Schulen ist knapp: Fast 1000 der 3000 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen haben laut Landesregierung keinen Sonderpädagogen angestellt, sollen aber sonderpädagogisch präventiv besonders fördern (VBE Nordrhein-Westfalen 2016). Bundesweit kommt rein rechnerisch lediglich ein Schulpsychologe zurzeit auf 8600 Kinder (Podium der Körber-Stiftung 2015).