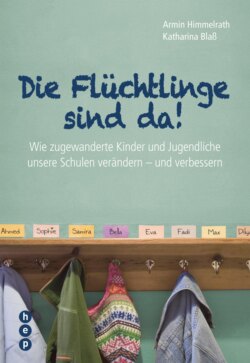Читать книгу Die Flüchtlinge sind da! - Armin Himmelrath - Страница 3
ОглавлениеVorwort
»Wir leben in einem Zeitalter weltweiter Migration«, schreibt die frühere deutsche Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth im Jahr 2008. Sie bezieht sich dabei auf Migration als Teil der Globalisierung, »die durch die schnelle Überwindung weit entlegener Räume verstärkt ermöglicht wird«, sowie die »erzwungene Migration aus existenzieller Not«. Das Wort »Flucht« verwendet sie nicht. Im gleichen Aufsatz beschreibt sie den Status quo für Deutschland: »Im Unterschied zu den 1990er Jahren kommen in allerjüngster Zeit so gut wie keine Einwanderer mehr nach Deutschland (Wanderungssaldo 2007: 22 000).«
Flüchtlinge in oder auf dem Weg nach Europa sind zu diesem Zeitpunkt kein Thema, weder in der politischen Debatte noch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dann kommt 2010 der Arabische Frühling, der in Syrien ein Jahr danach jäh in einen Bürgerkrieg mündet, an dem sich wenig später auch die Terrormiliz »Islamischer Staat« offen beteiligt. Als Rita Süssmuth ihre Worte schreibt, ahnt wohl niemand, dass deshalb knapp zehn Jahre später wegen der Flüchtlinge die Koalition in Berlin taumelt und eine neu gegründete rechtspopulistische Partei in acht von 16 deutschen Landesparlamenten sitzt.
Der Krieg trifft dabei nicht nur die Menschen, sondern auch seinen allergrößten Feind: die Bildung. Kinder, die während des Krieges, auf oder nach der Flucht nicht in die Schule gehen, laufen Gefahr, später wegen mangelnder Zukunftsperspektiven auf Abwege zu geraten. Krieg abzulehnen impliziert deshalb die Verpflichtung, uneingeschränkten Zugang zu Bildung zu gewährleisten.
Klar ist: Wenn Lehrkräfte, Schulleitungen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, schulpsychologisches Personal und nicht zuletzt auch Eltern und Schülerinnen und Schüler erst warten, bis Kultus- und Schulministerien flächendeckende Integrationskonzepte und Umsetzungsstrategien entwickeln und die dazugehörigen Erlasse auf den Weg gebracht haben, dauert es zu lange, bis im Schulalltag und in der einzelnen Klasse wirklich etwas passiert. Von 1,1 Millionen registrierten Geflüchteten allein in Deutschland und nur im Jahr 2015 gehen Experten aus – darunter sind, Schätzungen zufolge, bis zu 400 000 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Die Zahlen werden, nach Erscheinen dieses Buchs, noch weiter gestiegen sein. Diese Kinder und Jugendlichen sind zum großen Teil längst im Bildungssystem angekommen.
Und so haben sich unzählige Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Engagierte längst an die Arbeit gemacht: In Willkommensklassen und Arbeitsgruppen, in Deutschkursen und Handwerksprojekten, in kleinen und großen Zusammenhängen entwickeln sie täglich aufs Neue ihre Ideen weiter. Erprobte Strukturen gibt es nicht, Blaupausen und fertige Konzepte fehlen. »Es geht nur mit Offenheit und Zuversicht und dem Wissen, dass jeder neue Tag neue Herausforderungen und neue Überraschungen bringen kann«, sagt eine Lehrerin, die an einer Gesamtschule im Ruhrgebiet eine Willkommensklasse mit 14 Flüchtlingskindern leitet.
Wenn man mit den Akteuren spricht, die derzeit im Schulsystem des deutschsprachigen Raums Bemerkenswertes leisten, dann stellt man immer wieder fest, wie begeistert sie von ihrer Arbeit sind – trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten. Der Schwung und das Engagement von Lehrkräften und Ehrenamtlichen, die Lust aufs Lernen und die Neugier hunderttausender Flüchtlingskinder haben längst begonnen, unsere Schulen zu verändern und in den meisten Fällen auch zu verbessern. »Wir schaffen das«, ist ein viel zitierter und viel diskutierter Satz der deutschen Bundeskanzlerin zur Flüchtlingskrise. »Na klar, wir schaffen das!« – mehr als einmal bekamen wir diesen Satz bei unseren Besuchen vor Ort in den Schulklassen zu hören. Echte Zweifel daran ließ kaum jemand aufkommen.
Dieses Buch ist eine Bestandsaufnahme, die zeigt, wie es um den Bildungszugang für Flüchtlinge, die in Deutschland, der Schweiz und Österreich Schutz suchen, bestellt ist. Es will Lehrkräften und allen anderen Pädagoginnen und Pädagogen Mut machen, sich der Herausforderung zu stellen, Kinder und Jugendliche aus einer fremden Kultur mit einer manchmal traumatischen Vergangenheit bei uns willkommen zu heißen und ihnen Werkzeuge mit auf den Weg zu geben, mit denen sie hier ein neues Leben in mündiger Teilhabe an der Gesellschaft beginnen können. Das Buch erzählt von Projekten und aus dem Schullalltag, wie der Start gelingen kann. Es arbeitet aber auch heraus, dass es noch vieler Verbesserungen bedarf, um den Pädagoginnen und Pädagogen eine qualitativ und quantitativ angemessene Arbeit und den Flüchtlingen den bestmöglichen Start in ein Leben in Deutschland möglich zu machen. Dabei können sie häufig auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie bereits mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gemacht haben, also mit jungen Zuwanderern, die nicht als Flüchtlinge nach Mitteleuropa gekommen sind. Auch bei ihnen ging und geht es um schnellstmögliche Integration durch gute Sprach- und Lernförderung, und im Grunde ist die Herausforderung bei den Flüchtlingskindern eine vergleichbare: Auch sie sollen schnell Anschluss an das Land, seine Kultur und Sprache finden – haben aber, und das ist eine Besonderheit, häufig noch traumatische Erfahrungen gemacht. Umso wichtiger ist es, sich Gedanken um die Integration dieser jungen, neuen Mitglieder unserer Gesellschaft zu machen.
Das pädagogisch-professionelle Handeln sollte dabei im Zeichen der universell geltenden UN-Kinderrechtskonvention stehen: »Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist« (UN-Kinderrechtskonvention 1990, Artikel 3). Nur so können wir lernen, die Vielfalt in unserer Gesellschaft wertzuschätzen und allen, die hier leben – hier geboren oder hinzugekommen – ein Zusammengehörigkeitsgefühl ermöglichen.
Hamburg und Köln, im Juni 2016