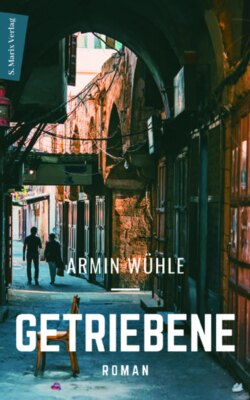Читать книгу Getriebene - Armin Wühle - Страница 11
6
ОглавлениеWie die Ausläufer einer Welle, die tiefer ins Land züngeln als die Übrigen, schwappte der Krieg nach Thikro. Lange erschien die Stadt zu klein, zu randständig für die Umwälzungen der Zeit. Aus Gefechten, die sich Splittergruppen mit einem schwachen Staatsapparat lieferten, entstand jedoch ein Flächenbrand, der sich weit über dessen Ausgangspunkt erstreckte. Demonstranten versammelten sich in den Straßen der Hauptstadt, Teile des Militärs liefen zu den freien Armeen über. Unterschiedlichste politische, ethnische und religiöse Lager erhoben ihre Ansprüche und bildeten Streitkräfte, die wechselnde Zweckbündnisse miteinander eingingen. Stück für Stück glitt der Staat in die Bedeutungslosigkeit ab, und die Waffen, die die Aufständischen gegen den gemeinsamen Feind erhoben hatten, richteten sich bald gegeneinander. Aus dem Land wurde ein Flickenteppich schraffierter Flächen, die sich wöchentlich verschoben. Die Kämpfe um die neue Vorherrschaft erreichten eine neue Stufe der Grausamkeit – und noch immer blieb Thikro weitgehend davon verschont.
Der Konflikt währte bereits zwei Jahre, als sich eine Rebellengruppe in den Bergen um Thikro verschanzte. Im Städtchen Amgar fanden sie eine ausreichende Zahl an Unterstützern, um deren Übernahme zu sichern, und innerhalb weniger Tage wehten dort die Flaggen der Rebellen. Kämpfer mit ihren Familien, die aus anderen Regionen vertrieben worden waren, wurden mit Bussen nach Amgar gebracht, und die Stadt entwickelte sich schnell zu ihrem größten Stützpunkt. Erstmals rückte der Krieg in die Nähe einer zwanzigminütigen Autofahrt.
Indes hatte die benachbarte Union ein Auge auf Thikro geworfen. Die Union war durch finanzielle und militärische Unterstützung einzelner Gruppen selbst zur Kriegspartei geworden. Im Zuge der sich rapide verschiebenden Grenzen gelang es der Union, ihren Einflussbereich zu erweitern. Mit diplomatischem Geschick (und etwas Korruption) brachten sie die kommunalen Vertreter Thikros dazu, die Aufnahme in ihren Staatenbund zu beantragen. Ein eilig abgehaltener Volksentscheid, der mit nordkoreanischer Deutlichkeit zu einem Ergebnis kam, gab dem Ganzen einen demokratischen Anstrich. Obwohl die Meinungen in der Bevölkerung durchaus differenzierter waren, als das Wahlergebnis vermuten ließ, musste man den Wählern nicht sonderlich auf die Sprünge helfen. Viele versprachen sich von der Eingliederung in die Union einen wirtschaftlichen Aufschwung sowie militärische Stabilität angesichts eines Krisenherdes, der vor ihrer Haustür loderte.
Die Wahl wurde als großes Fest inszeniert. Wimpel in den Farben der Union schmückten die Straßen, schon bevor das Wahlergebnis feststand. Musikgruppen spielten, Essensbuden und Fahrgeschäfte für Kinder wurden aufgebaut. Dass die Union Gruppen unterstützte, die zu den größten Feinden der Amgar-Rebellen zählten, bereitete nicht Wenigen Sorge, aber das Rad der Geschichte drehte sich bereits und war nicht mehr aufzuhalten. Das Fest dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Thikro wurde zum Territorium der Union erklärt und zwei Tage später von den Rebellen angegriffen.
Die ersten Toten waren Bauern, die ihre Felder vor den anrückenden Geländewagen verteidigten. Rebellen zogen in die Stadt, errichteten Barrikaden an allen Ausfallstraßen und verteidigten sie gegen die Union. Zeitgleich kontrollierten die Rebellen wahllos Passanten und befragten sie nach ihrer Wahlentscheidung. Je nachdem, wie plausibel sie ihre Ablehnung gegenüber der Union ausdrückten, wurden sie am Leben gelassen oder erschossen. Einige der Rebellen trugen Aktenordner bei sich. Darin hatten sie Bildmaterial gesammelt, das Fernsehbeiträgen entnommen war und Bürger zeigte, die sich am Wahltag positiv über die Union geäußert hatten. Diejenigen, die sie am Leben ließen, wurden nach den Adressen der abgebildeten Personen befragt. In einer Stadt wie Thikro, in der jeder jeden kannte, war dies ein klarer Beweis der soeben behaupteten Loyalität. Die ersten Lokalpolitiker, die für die Wahl verantwortlich gewesen waren, wurden auf die Straße getrieben. Man kappte die Wimpelketten, die noch zwischen den Häusern hingen, und strangulierte sie damit. Die Ermordungen und Verhaftungen dauerten bis in den späten Abend. Über siebzig Personen wurden in eine Turnhalle gebracht, in der die Rebellen ihre Gefangenen festsetzten. Vincent hatte in der Times den Bericht des einzigen Überlebenden gelesen. Er beschrieb die verbrauchte und säuerliche Luft in der Halle; die geflüsterten Gebete; den panischen Blick gefangenen Schlachtviehs. Gegen Mitternacht schlossen zwei Rebellen die Türen auf und traten ein. Sie schossen die Magazine ihrer Maschinengewehre leer, bevor sie Handgranaten ins Innere warfen und die Halle zum Einsturz brachten.
Mit dem Überfall aus Amgar hatte die Union nicht gerechnet. Sie hatte die Rebellen für zu schwach und zu beschäftigt mit dem Aufbau ihrer Strukturen gehalten, um einen Angriff derartiger Größenordnung durchzuführen. Am Tag des Überfalls waren nur wenige Unionssoldaten in der Stadt stationiert, und der Nachschub traf erst ein, als das Stadtgebiet Thikros schon eingenommen war. Die Union errichtete einen Belagerungsring, um ein weiteres Vordringen der Rebellen in ihr Territorium zu unterbinden. Ein schmales Zeitfenster, das zwischen der Einnahme und der Belagerung lag und nur wenige Stunden andauerte, reichte ein paar hundert Bewohnern zur Flucht. Der Rest blieb für die nächsten vierzehn Monate eingesperrt, Gefangene von innen wie von außen.
Auf Tage der Schockstarre, die die Bewohner Thikros in ihren Wohnungen verbrachten und nur für das Lebensnotwendige verließen, kehrte der Alltag zurück. Schulen und Geschäfte wurden geöffnet, der Busverkehr nahm seinen Betrieb auf. Nach der ersten Gewaltspirale wurden die Rebellen zu kalkulierbaren Gefängniswärtern, die den Bewohnern Thikros innerhalb eng gesteckter Grenzen – und unter der Voraussetzung absoluter Loyalität – ihren Freiraum ließen. Auf Tage der vermeintlichen Ruhe folgten regelmäßige Schusswechsel mit der Union. Diese gab sich nicht damit zufrieden, die Stadt den Rebellen zu überlassen. Sie hatte Thikro von allen Seiten eingekesselt, bis auf den schmalen Durchlass zwischen den Bergen, der ihren Feinden jederzeit den Rückzug ins Rebellengebiet garantierte. Die Union verfolgte eine Strategie der ausdauernden Zermürbung, die im gleichen Maße Besatzer wie Zivilisten traf. Durch den Belagerungsring kontrollierte sie den Warenverkehr und steigerte langsam den Druck, indem sie Wasser, Strom, Heizöl und Lebensmittel rationierte oder kappte. Die Versorgung über Amgar war ungleich komplizierter und kaum billiger als Schmugglerware. Die Einwohner Thikros, die weder der Union noch den Rebellen sonderlich zugetan waren, wurden zwischen den Fronten zerrieben.
Der Union lag vornehmlich an der strategischen Bedeutung der Stadt, weshalb sie Kollateralschäden in Kauf nahm. Während sie öffentlichkeitswirksam Hilfspakete in die belagerte Stadt schickte, sandte sie wenige Tage später Schützenfeuer hinterher. Rebellen und Union beschuldigten sich gegenseitig, für die wachsende Zahl an Toten verantwortlich zu sein. Der Beschuss eines Wochenmarktes, bei dem dreiunddreißig Zivilisten starben, sorgte für weltweites Aufsehen. Die Belagerung dauerte da bereits sieben Monate an. Die Rebellen machten die Union für den Beschuss des offensichtlich zivilen Ziels verantwortlich. Die Union warf den Rebellen eine False-Flag-Aktion vor. Einer unabhängigen Untersuchungskommission wurde seitens der Union der Zutritt verwehrt, mit Verweis auf die Sicherheitslage. Die Rebellen sahen dies als Beweis, dass die Union ihre eigene Verantwortung vertuschen wollte und versprachen den internationalen Beobachtern Geleitschutz. Beide Seiten hielten Pressekonferenzen ab, in denen sie Beweise für ihre Sicht der Dinge präsentierten: verwackelte Handyaufnahmen, Satellitenbilder, Zeugenaussagen und Patronenhülsen. Die Kommission nahm nie ihre Arbeit auf, und die Frage, wer für den Beschuss des Wochenmarkts verantwortlich war, geriet zur Fußnote inmitten eines Flächenbrands, in dem Thikro nur das jüngst brennende Scheit war.
Die Belagerung endete schließlich so abrupt, wie sie begonnen hatte. Gerüchte über einen Abzug der Rebellen gab es seit Monaten, bewahrheitet hatten sie sich nie. Erst wenige Tage zuvor waren Aufstände der Bewohner blutig niedergestreckt worden, mit einer Entschlossenheit, die keinen Zweifel daran ließ, dass die Rebellen die Stadt bis zuletzt halten wollten. Selbst einige Kollaborateure hatten von dem Abzug nichts gewusst und wurden von den Truppen der Union, die im Morgengrauen die Stadt übernahmen, festgenommen. Der sterbenden Stadt, in der ein geschmuggeltes Stück Brot zuletzt einen halben Monatslohn kostete, wurde der Abzug der Rebellen über Lautsprecher mitgeteilt. Die SU-Miliz, die bereits in anderen Gefahrengebieten für die Union arbeitete, wurde mit dem Mauerbau an der Demarkationslinie beauftragt. Das Flüchtlingshilfswerk und verschiedene NGOs nahmen ihre Arbeit auf und der Lichtkegel medialer Aufmerksamkeit wandte sich ab. Über zweitausendsechshundert Menschen waren durch Schusswechsel, Bombardements, an Mangelernährung oder unzureichender medizinischer Versorgung gestorben. Die verbliebenen Bewohner, gelockt vom aufklarenden Himmel, traten vor die Tür und fanden eine zerstörte Stadt vor.
Das war die Geschichte Thikros, und Vincent kannte sie gut. Er hatte sie damals live verfolgt, in den Nachrichtensendungen und Feeds seiner abonnierten Kanäle, und er hatte seinen Kenntnisstand vor der Reise mit einer vierstündigen BBC-Dokumentation aufgefrischt. Vincent kannte sich aus und war gerade deswegen so gespannt, wie das Kriegsmuseum der SU-Miliz die Geschichte darstellen würde. Wer die Aussichtsplattform besuchen wollte, musste sich zuvor an den zahlreichen Schautafeln vorbeiführen lassen. Einem Teil der zwanzigköpfigen Gruppe, der Vincent zugeteilt worden war, war anzusehen, dass sie in ihrem Urlaub – und auch sonst – keinen Wert darauf legten, ein Museum zu besuchen. Sie ließen die Kopfhörer ihres Audio-Guides um die Finger kreisen und warteten nur darauf, endlich einen Blick auf die andere Seite werfen zu können. Der weitaus größere Teil der Gruppe zeigte sich jedoch interessiert. Sie stellten dem Söldner, der sie im Kampfanzug durch das Museum führte, dutzende Fragen und hingen an seinen Lippen, wenn er von den Kämpfen der Unionstruppen erzählte, als sei er selbst dabei gewesen. Vor Beginn der Führung hatte sich Vincent bei ihm vorgestellt.
»Ist lange her, dass ich einem Journalisten begegnet bin«, hatte der Söldner gesagt und ihm die Hand geschüttelt. Er hatte Vincent dabei in die Augen gesehen und gelächelt. Wir sind auf Augenhöhe, sollte dieser Blick sagen – keine Geheimnisse zwischen uns, Buddy.
»Wann kam denn der letzte?«, fragte Vincent.
Der Söldner zuckte mit den Schultern. »Vor einem halben Jahr?«
Sein Lächeln war angenehm und gutmütig, ohne Vorbehalt. Er strahlte eine souveräne Offenheit aus, die antrainiert war wie seine Muskeln. Eine aufgenähte Flagge über der Brust wies ihn als SU-Offizier Iversen aus. Buddy Iversen nannte Vincent ihn in Gedanken und später in der Reportage.
Er führte die Gruppe durch die abgedunkelten Museumsgänge, die den Märtyrern von Thikro oder den Helden der Befreiung gewidmet waren. Eine schmucklose Wellblechbaracke von außen, war das Museum innen aufwendig gestaltet. Buddy Iversen führte sie durch ein multimediales Ausstellungskonzept, vorbei an Exponaten, Videosequenzen und Schaubildern, die mit dezenten Spotlights unterstrichen wurden. Der Angriff auf den Wochenmarkt wurde, wenig überraschend, den Rebellen zugeschrieben, und die vermeintlichen Beweise dafür unter Plexiglas ausgestellt. Mit dem Bau der Grenzanlagen und dem unerschrockenen Einsatz der SU-Miliz für die Union endete die Ausstellung. Eine Tafel listete die Namen der Spender auf, mit deren Mitteln das Museum errichtet worden war. Vincent fotografierte sie für seine Recherchen ab.
Durch einen hellerleuchteten Ausgang traten sie ins Freie. Vincents Augen mussten sich erst wieder an die Helligkeit gewöhnen; halb benommen vom Tageslicht stieg er eine Gittertreppe hinauf, bis sie die Höhe der Mauer erreicht hatten. Sie passierten einen mit Stacheldraht bewehrten Wachturm und betraten die Aussichtsplattform, die mehrere Meter ins Kriegsgebiet hineinragte.
Viel zu sehen gab es nicht. Vor ihnen lag ein unbewohntes Tal, vom selben Sandstein geprägt wie die andere Seite. Münzfernrohre standen in einer Reihe, um das Gebiet auszukundschaften. Der Blick ging mehrere Kilometer weit, bis er auf die reflektierenden Scheiben einer Stadt traf; dort lagen die Schachtelhäuser der Rebellenhochburg Amgar.
Ein gespanntes, fast schon ehrfürchtiges Schweigen hatte die Gruppe erfasst. Der Wind zog über die Plattform, heulend und trostlos. Wie auf ein stilles Signal, als erinnerten sich die Besucher daran, dass sie selbst in Sicherheit waren, setzten die Gespräche wieder ein. Kameras wurden hervorgeholt, und ein agil auftretender Rentner, den Vincent einer Studiosus-Reisegruppe zurechnete, bat seine Frau um ein Weitwinkelobjektiv. Er wollte das absurde Bild einfangen, das sich auf der Mauer bot: rechts das engbebaute, sich überstapelnde Thikro, links die weite Steppe.
Vincent trat ans Geländer. Er besah sich die mehrstufige Grenzanlage, die zu überwinden seit Jahren keinem Menschen gelungen war.
»Im Frühjahr haben wir mit den Bauarbeiten für einen Wassergraben begonnen«, erzählte ihm Buddy Iversen, den er um eine Erläuterung der Abwehrsysteme gebeten hatte. Dabei hielt er den sonnenbebrillten Blick in die Höhe gereckt, als spreche er nicht zu Vincent, sondern zum Himmel; in seiner Stimme schwang unverkennbar Stolz. Mehrere Besucher traten in Hörweite. »Der Wassergraben wird entlang der zwei Kilometer breiten Talöffnung gezogen. Ende des Jahres wird er fertiggestellt werden und die erste Hürde für potentielle Angreifer bilden. Die Bauarbeiten werden von einem Hochsicherheitsteam überwacht.«
Buddy Iversen wies in eine Richtung, und die Köpfe der Anwesenden folgten ihm. Sie sahen einen aufgerissenen Streifen Erde, aus dem der Arm eines Schaufelbaggers ragte. Vier schwer gepanzerte Wagen flankierten die Baustelle und die Bauarbeiter. »Auf den zukünftigen Wassergraben folgt ein drei Meter fünfzig hoher Drahtgitterzaun, der mit Rasierklingen besetzt ist und bei Bedarf unter Strom gesetzt werden kann. Danach sehen Sie eine Schotterpiste, die wir für unsere Kontrollfahrten nutzen, und letztlich die Stahlbetonmauer, auf der wir gerade stehen – sechs Meter hoch, einsfünfundzwanzig im Durchmesser, mit Stacheldrahtbewehrung und Wachtürmen im Abstand von zweihundert bis achthundert Metern. Nachts werden unsere Männer von Wärmebildkameras und Bewegungsmeldern unterstützt. Es sind aber meist nur wilde Tiere, die den Alarm auslösen.«
»Dürfen Sie auch schießen?«, fragte einer der Besucher.
»Nur in einer Bedrohungssituation. Aber in diesem Fall hat das Gegenüber nichts zu lachen, glauben Sie mir. Unser Waffenarsenal ist immens, und unsere Männer werden in Trainingslagern regelmäßig auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Wenn ich offen sprechen darf: Wer so dumm ist, sich mit uns anzulegen, ist selbst schuld. Den meisten ist die Mauer aber Abschreckung genug.«
»Was ist mit Menschen, die flüchten? Sind die auch eine Bedrohung?« Vincent war überrascht, eine halbwegs kritische Frage zu hören. Er sah einige Gesichter einen nachdenklichen, betroffenen Ausdruck annehmen. Andere verschränkten die Arme oder traten peinlich berührt von einem Fuß auf den anderen. Der Fragesteller, ein Rotschopf im mittleren Alter, registrierte den Stimmungswechsel und fühlte sich gezwungen, seine Aussagen zu kommentieren. »Also, da drüben herrscht ja Krieg, natürlich versuchen die, hier durchzukommen, auf die sichere Seite. Das ist zwar nicht erlaubt, aber es ist ja menschlich nachvollziehbar.«
Buddy Iversen antwortete mit einem entwaffnenden Lächeln. »Dafür gibt es Gesetze und Asylverfahren. Wer auf diese Mauer zusteuert, hat nichts Gutes im Sinn.«
Damit war das Thema erledigt. Er fuhr mit der Beschreibung der Grenzanlagen fort, und Vincent ließ ihn inmitten seiner Ausführungen zurück. Er schloss die Hände ums Geländer und blickte ins Tal hinab. Auch Vincent konnte sich des Grusels nicht erwehren, den der Anblick in ihm auslöste. Scheinbar friedlich lag das Tal vor ihm, und doch war er nur einen Steinwurf entfernt von der Hölle des Kriegs. Vincent musste an ein Ungeheuer denken, dessen Fesseln gerade so weit reichten, dass man seinen schlechten Atem riechen konnte, und das man doch auf sicherem Abstand wusste. Er übernahm eines der Fernrohre und streifte durch die zerstörten Straßen Amgars, bis ihm eine der schwarzen Rebellen-Flaggen vor die Linse kam. Aus einem Land mit jahrtausendealter Geschichte, mit vibrierenden Großstädten und Kulturszenen waren weiße Flecken geworden, die in den letzten Jahren kaum ein Ausländer zu Gesicht bekommen hatte. Trotzdem blieben die dort stattfindenden Gräueltaten in aller Munde, aufbereitet von Nachrichtensendungen, Reportagen und Spendenaufrufen. In der gesamten Welt wuchsen Generationen heran, die das Gebiet mit nichts anderem verbanden als mit Tod und Verderben – und die ihre Heimatländer dafür lieben sollten, ihnen den Frieden geschenkt zu haben.
Mit einem Sonnenbrand im Nacken und fünf vollgekritzelten Notizbuchseiten, auf denen er Gespräche mit Touristen und Buddy Iversen festgehalten hatte, kehrte Vincent in sein Apartment zurück. Er überlegte, einen Abstecher ins Garden zu machen, und mischte sich stattdessen ein großes Glas Rum-Cola in der Küche. Er streckte seine müden Glieder unter den Tisch und blätterte in seinen Notizen, auf der Suche nach einer Szene, die er in 280 Zeichen über den Äther jagen konnte. Er blätterte vor und zurück, doch die Sätze verschwammen vor seinen Augen. Er seufzte auf und bettete seinen müden Kopf auf die Tischplatte. An solchen Abenden fragte er sich, warum er sich selbst so unter Druck setzte; warum er sich zum Getriebenen seiner eigenen Geltungssucht machte. Sich als freier Journalist zu etablieren, mehr noch, damit erfolgreich zu sein, kostete unsäglich viel Kraft. Er fragte sich, ob eine Karriere das alles rechtfertigte: ständig dem nächsten großen Thema hinterherzuhecheln, der nächsten gelungenen Schlagzeile, der nächsten fein justierten Provokation, die den Artikel kontrovers machte und in den Feeds nach oben pushte. Letztlich blieben diese Gedankenspiele aber ohne Konsequenz. Sie waren ein bloßes Tribut an seinen selbstkritischen Geist – er würde auch am nächsten Tag aufstehen und seine Steine den Berg hinaufrollen.
Vincent schusterte einen Post zusammen und bestellte Pizza bei Domino’s. Er verbrachte den restlichen Abend damit, sich einheimische Filme anzusehen, in denen sich Angehörige der Oberschicht unglücklich in ihre Bediensteten verliebten. Er klebte mit der Backe an der Ledercouch und blickte katatonisch auf den Bildschirm. Auch ohne den Text zu verstehen konnte er der Handlung leicht folgen. Das übertriebene Mienenspiel erinnerte ihn an die Laien-Theatergruppe, in der Nina spielte. Er hatte sich immer am Dilettantismus ihrer Gruppe gestört, und noch mehr störte ihn, dass sich Nina damit zufrieden gab. Sie war mit Abstand die beste Schauspielerin, die einzige mit professioneller Ausbildung. Sie hatte aus vernünftigen Gründen den Theaterbetrieb verlassen, aber anstatt sich ein freies Kollektiv zu suchen, hatte sie einen Bürojob angenommen und sich damit begnügt, in ihrer Freizeit zu spielen. Sie sei zufrieden mit diesem zwanglosen Spiel, sagte Nina, zufrieden mit einem Ensemble, von denen manche Mitglieder zu Freunden geworden waren. Vincent glaubte ihr und versuchte, es dabei zu belassen. Wenigstens musste er jetzt nicht mehr in Gemeindesälen sitzen und tiefer in den Sitz rutschen, wenn einer ihrer Kollegen ein Solo hatte.
Er quälte sich vom Sofa und stieg zum Flachdach hinauf, um eine zu rauchen. In der schwülen Nachtluft begann er sofort zu schwitzen. Er blickte über die Lichter der Stadt, ohne etwas dabei zu empfinden, und trank seinen letzten Schluck Rum-Cola.
Er kehrte in die Wohnung zurück und sah sich weiter den Film an. Immer wieder schlief er dabei ein, bis ein Stromausfall alles zum Erliegen brachte. Licht und Fernseher gingen aus, und auch der Rotor des Deckenventilators erlahmte. Vincent sah sich in der plötzlichen Dunkelheit um, ohne etwas zu erkennen. Es musste Mitternacht sein. Milo hatte ihm erzählt, dass um diese Uhrzeit der Strom gekappt wurde – fünf Sekunden würde es dauern, bis das Notstromaggregat einsprang, das Varga der Stadt spendiert hatte. Tatsächlich ging das Licht nach wenigen Sekunden wieder an. Küchengeräte gaben einen kurzen Power-Sound von sich, und die hellhäutig geschminkte Frau, die ihrem Geliebten eine Affäre vorwarf, kehrte in Großaufnahme auf den Bildschirm zurück. Vincent schaltete alles aus und schleppte sich ins Bett.