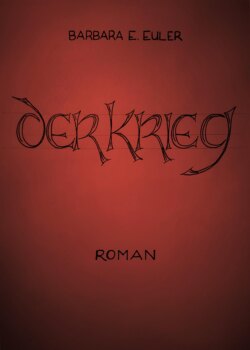Читать книгу Der Krieg - Barbara E. Euler - Страница 10
Siebtes Kapitel
ОглавлениеDes Morgens früh schon hatten die Wirte ihre Türen geöffnet. Rauchige, weinselige Luft drang aus den niedrigen Schenken auf die lärmige Straße und mischte sich mit dem Dunst von Dung und Kehricht, der aus den Gossen aufstieg. Herausfordernd stand Hieronymus Grootland, der Schwanenwirt, vor seiner Wirtschaft, als gelte es, einen Händel auszufechten, breitbeinig und beleibt, die befleckte grobgewebte Schürze prall über dem mächtigen Bauch gespannt, einen Krug in der wulstigen Hand und ein breites Grinsen im geröteten Gesicht unter der schmierigen Kappe. „Hereinspaziert, ihr edlen Leut’, s’ist ein Festtag heut und ein Fest muss man feiern“, rief er heiser und gierig und vergnügt, „s’ist nicht alle Tag’ ein Ehrenbegräbnis in der Stadt. Kommt und trinkt auf den edlen Ritter Gabriel, trinkt!“ Und er stieß den hölzernen, mit einem eisernen Fassriemen umspannten Krug gen Himmel, dass das trübe Grutbier schäumend herausschwappte und seinen angenehm hefigen Geruch appetitlich über die Zuschauer verströmte.
Kinder drängten sich zwischen der Menge hindurch zu dem Dicken vor, weil er lustig war und weil er ihnen manchmal ein Brötlein oder einen Pfennig zuwarf, wenn er in Stimmung war. Und das war er.
Grootland wusste um die magische Wirkung, die ein großes Begräbnis auf die Leute ausübte – diese wunderliche Mischung aus bangem Erschauern und überströmender Festlaune, die Menschen unwiderstehlich anzog und in Bann schlug. Und er, Grootland, sorgte dafür, dass sie hereinströmten in seine Wirtschaft und die prickelnde Erregung mit ein paar Krügen Bier besänftigten oder anstachelten, ganz wie es ihrer Natur entsprach. Grootland kannte beides und er wusste damit umzugehen. Gut gelaunt kramte er ein paar Münzen aus seinem Gewand hervor und ließ sie wie Sommerregen über den Kindern niedergehen. Er konnte es sich leisten. Heute bestimmt. Der Trauerzug würde direkt vor seiner Wirtschaft passieren.
Cornelis und Joris ergatterten die letzten freien Plätze. Behutsam setzte der Physikus seinen Freund auf der rohen Holzbank ab. „Suppe und ein Bier?“, fragte er. Joris Eijckhout nickte zufrieden, zog einen Lumpen aus seinem Hemd, spuckte darauf und rieb sich Hände und Gesicht sauber. Sie hatten einander lange nicht gesehen, aber der Arzt wusste es noch. Cornelis bestellte. „Und gebt ordentlich Fleisch hinein!“, rief er munter dem Wirt zu.
Erst kürzlich war er wieder einmal mit Collega Delacourt, dem Leibarzt der Königin, aneinander geraten. Doch wenn er mit Joris zusammen war, konnte er gar nicht schlechter Stimmung sein. Fröhlich plauderte der Alte von den Kindern und der Frau und von den Geschäften, die gut gingen, wenn die Stadt so voll war.
Das verschwitzte Schankmädchen setzte schwungvoll die Getränke auf den Tisch und der Arzt drückte ihr vier Kupfermünzen in die Hand, die sie hastig und froh in ihren Beutel warf. „Auf dein Wohl, Joris!“ Er hob den irdenen Becher mit rotem Wein. Joris tippte seinen Holzkrug dagegen. Sie tranken. „Ärger?“, fragte Joris und wischte sich Schaum von den Lippen. Cornelis sah auf den vergnügten Krüppel und winkte ab. Es war nicht wichtig. „Doctor Delacourt?“, half Joris nach. Cornelis zuckte mit den Schultern. Fast hatte er bei dem collega betteln müssen, um auch einen Blick auf den gefallenen Ritter werfen zu dürfen, dessen Tod Delacourt offiziell festgestellt hatte. Und dann hatte Delacourt ihn geradeheraus nach der Todesursache gefragt. „Der Stümper“, sagte Joris, als hätte Cornelis laut gesprochen. Der Arzt schüttelte den Kopf. „Er tut seine Arbeit, ich die meine“, erklärte er ruhig.
Wie es um Gabriel stand, hatte Cornelis bereits gewusst, ehe er ihn in der Burg aufgebahrt fand. Er hatte den verehrten Ritter taumeln sehen, als die Königin, die nach der siegreichen Schlacht selber im Felde erschienen war, die stolzen Kämpfer gegrüßt hatte. Besorgt war der Arzt näher getreten. Der Ritter hatte die schwere Rüstung abgelegt. Kein Blut, keine Verwundung war zu sehen, doch Gabriels Gesicht war fahl und schweißbedeckt. Sein Atem ging flach und hastig. Cornel of Clovesborough kannte ihn gut genug, um zu sehen, dass er Schmerzen litt. „Ihr braucht einen Arzt, Ritter“, hatte er ohne Umschweife gesagt, jeder Etikette ungeachtet. Nie würde er den Blick von Gabriels fiebrigen Augen vergessen. Ernst und wissend hatte der Ritter ihm zugenickt. „Ich habe keine Zeit mehr“, hatte Gabriel van der Velde gewispert, „lebt wohl… Cornel…“ und war mühevoll aufgesessen und davongeritten.
Stumm hatte der Arzt ihm nachgestarrt. Es würde nicht mehr lange dauern. Ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht. Die Wunden waren inwendig. Man konnte nichts tun. Cornelis’ starke Fäuste hatten sich um die blutige Schürze geballt. Gar nichts.
Auch als Leibarzt des Königs arbeitete Cornel of Clovesborough draußen im Feldlazarett, wann immer es möglich war. Das war seine Bedingung gewesen, damals, als der alte König Rodewig ihm die Stellung angeboten hatte. Früh war der Königshof auf den fahrenden Engländer aufmerksam geworden, der Leben rettete, wo niemand es für möglich gehalten hatte. Früh hatte sich auch herumgesprochen, dass er keineswegs der ungelehrte Bader war, für den er sich ausgab. Dass er mit dem gemeinen Volk auf der Straße lebte, bitterarm wie dieses trotz seiner Kunst, störte den exzentrischen Rodewig nicht. Er brauchte einen Heiler, keinen Händler. So war Cornelis schließlich zum Leibarzt des alten Königs avanciert – dem ersten, der blieb. Nach dessen Tod wurde er der Physikus des jungen Königs, Andurkan. Doch er war immer auch der Chirurg und Feldscher geblieben, als der er einst begonnen hatte. Den Spott, den ihm das bei den werten collegae eintrug, ertrug er geduldig. Meistens jedenfalls.
„Ihr esst nichts?“, fragte Joris und tauchte seinen Holzlöffel tief in die dampfende Suppe, die das Mädchen eben vor ihn hingestellt hatte. Cornelis schüttelte abwesend den Kopf. Schreibt: „innerlich verblutet“, war seine Empfehlung an den ratlosen Kollegen gewesen.
„Exsanguinatus internus“, hatte Delacourt ihn mitleidig korrigiert. Cornelis seufzte. Manchmal hatte er alles so satt.
Draußen erklangen Fanfaren. Die Menschen drängten an die trüben Fenster und schoben sich bald auf die Straße hinaus, wo Herolde in den Farben der Königin die Ankunft des Trauerzugs verkündeten. „Die Körbe“, sagte Hieronymus Grootland halblaut. Der Wirt war vorbereitet. Eifrig lief das Mädchen nach dem Keller und kam mit zwei großen Henkelkörben voll frischer Semmeln zurück, die appetitlich mit Kümmel und Koriander bestreut waren. Und mit Salz. Viel Salz. Hieronymus überprüfte die Zahl seiner Fässer. So ein Begräbnis machte durstig.
Joris aß ruhig weiter. Niemals würde er einen Rest Fleischsuppe zurücklassen. „Müsstet Ihr nicht beim Trauerzug sein?“, fragte er mit vollem Mund. Cornelis fuhr mit dem Zeigefinger durch eine Weinpfütze. „Gabriel braucht mich nicht mehr.“
Joris legte eine Hand auf die des Arztes und fischte mit der anderen das letzte Stück Fleisch aus seiner Suppe. „Esst“, sagte er, und Cornelis nahm das Fleisch, das wunderbar mürbe war und nach Lorbeer und Wacholder schmeckte. Er hatte gar nicht gewusst, wie hungrig er war.
„Gebt mir besser eure Börse“, meinte wenig später der Bettler, als sie endlich doch draußen zwischen den Schaulustigen standen. Der Arzt lugte zu seinem Freund hoch, der auf seinen Schultern saß. „Hast wohl einen Kumpel gesehen!“ Es war lange her, aber er hatte die Regeln der Straße nicht vergessen. Sein Geldbeutel enthielt nur wenige Münzen und er konnte ihn auf seiner Brust fühlen. Aber hier war Joris’ Revier. Gutmütig nestelte er den Beutel los und übergab ihn dem Bettler.
Hinter den Herolden streute Gesinde von einem behäbigen Karren Stroh auf die Straße, das den Dreck aufsog. Goldstaub flirrte in der Sonne. Joris nieste. Gleich würde der Zug kommen. „Gabrielsbrötchen – esst feine Gabrielsbrötchen! Nur heute! Nur drei Pfennige das Stück!“ Hieronymus schob das Schankmädchen mit den Körben in die Menge. „Gabrielsbrötchen!“ rief auch sie und hielt ein Brötchen hoch. „Ich nehme zwei Dutzend!“ rief der Leibarzt. „Gebt sie den Kindern!“ Mit dem Daumen wies er nach oben. „Er zahlt. Und er wird aufpassen, dass sie alles bekommen!“ Kinder. Hieronymus unterdrückte einen Fluch. „Frisches Bier! Frisches Bier!“, brüllte er umso lauter, den Arm voll schäumender Krüge. Der Physikus hörte die Kinder jauchzen und lächelte. Jetzt war er reich, aber er hatte nicht vergessen, was Hunger ist.
Wie Donner schlugen die Trommeln in das fröhliche Treiben. Es war soweit. Der Leichenzug kam. Hoch ragten die schwarzen Fahnen auf, schwer und samtig an goldglänzenden Stangen in den strahlend blauen Himmel gereckt. Den Engländer durchfuhr ein Zittern. Bis jetzt hatte er nicht gewusst, ob er es würde ertragen können. Nun war er mittendrin. „Ruhig“, sagte Joris und drückte seine Hand. Starr sah Cornelis auf die mit vergoldetem Schnitzwerk übersäte Sänfte, die langsam hinter den Trommlern an der Menge vorbeischwankte. Herigold selber war es, der verehrte Großmeister, der den Begräbniszug anführte. Segnend hielt er seine Hand aus dem Fenster. Andächtig knieten die Menschen nieder und bekreuzigten sich. Auch Cornelis mit seiner kleinen Last auf den Schultern beugte gehorsam die Knie. Er war ein kräftiger Mann und hatte keine Mühe damit.
Hinter der Sänfte schritt der Oberpriester, prachtvoll gewandet. Schwer schleifte seine goldbestickte Schleppe durch das feuchte Stroh. Ein Knabe im weißen Gewand hielt ein silbernes Gefäß, in das der mächtige Kleriker im Takt der schweren Trommeln den Aspergill eintauchte, um die Menge mit Weihwasser zu besprengen. Still standen die Menschen und spürten den Segen auf ihrer Haut.
Nun kamen die Priester und Unterpriester, Bischöfe, Vikare, Äbte, Pröbste, Kanoniker, Mönchen, Nonnen, Messdiener, in ihren weißen, violetten, purpurnen, schwarzen, braunen Gewändern, schwere Kreuze auf der Brust, aus rohem Holz oder aus Gold und funkelnden Steinen, die Häupter bedeckt mit Kappen, Kapuzen, Hauben, Hüten, Mitras, Biretten, die Pilger- und Krummstäbe hoch aufgerichtet, zahllose Weihrauchfässer schwenkend, feierlich, im trägen Rhythmus ihrer monotonen Gesänge, die ein vorausgehender Mönch mit bedächtigen Handzeichen leitete. Wie Nebel hüllte der scharfwürzige Weihrauch die Menschen ein. Viele bekreuzigten sich abermals.
Dann folgten die Rösser. Dreiundzwanzig schwarz glänzende Rappen mit den Vertretern aller Ritterschaften des Landes. Stumm und stolz paradierten sie ihre Wappen, ihre Farben, ihre Harnische, Zimire, Mäntel, Schilder, Schwerter, Wimpel, Fahnen; Pelz, Atlas, Seide, Silber, Gold glänzten unter der Mittagssonne und machten Cornelis’ Augen brennen, dass er blinzelte und sich auf die Lippen biss, ein prunkvoller Aufzug und eine Ehre, die nur den Großen unter den Rittern zuteil wurde; den Größten.
„Ruhig“, sagte Joris.
Ein Raunen ging durch die Menge, weil sie jetzt Gabriel herantrugen. Goldbeschlagen der schwere ebenhölzerne Sarg, von Gabriels samtenem Wappenkleid überflossen und beschirmt von seinem prächtigen Paradeschild, getragen von acht Männern in voller Rüstung, Silberglanz unter schweren Mänteln, ernste Augen unterm geöffneten Visier, gedämpftes Klirren von Sporen im Stroh. „Farewell, my friend“, murmelte Cornel of Clovesborough.
Hinter dem Sarg sah er nun Gabriels Knappen gehen, Matthies, sehr allein und sehr aufrecht, mi-parti in des Ritters Farben gekleidet, ohn’ alle Waffen und jeder Rüstung bar, das Haupt entblößt, die Augen leer. In seinen geöffneten Handflächen präsentierte er Gabriels Schwert, das Ledergehänge sorgsam um die Edelholzscheide gewunden, deren Silberintarsien das Sonnenlicht fingen. Ein kostbares Erbstück. Wer würde es bekommen? Gabriel hatte nicht Frau noch Kind, nicht Bruder noch Schwester, sein Vater war tot, seine Mutter gestorben bei seiner Geburt, er stammte nicht einmal von hier. Tief sog Cornelis die Luft ein, die nach Sonne roch und Weihrauch, nach Bier und Schweiß und nach Pferden. Ein Fremdling wie er. „Lass uns gehen.“ Er hievte Eijckhout von seinen Schultern und reckte sich.
Schon erhob sich auch die Menge, weil jetzt als letztes die Dienerschaft herantrottete und danach der dichte Strom des Volks folgte, der immer neue Menschenmassen in sich aufsog. „Bringt Ihr mich zur Kathedrale?“, bat der Bettler. Cornelis nickte. Die Geschäfte mussten weitergehen. Und Trauer machte freigiebig. Der Physikus nahm den Freund auf den Rücken und begann, sich gegen die herbeiströmenden Menschen einen Weg zu bahnen. Viele erkannten den groß gewachsenen Arzt und grüßten ehrerbietig. Für Joris setzte es manch derben Scherz. Der Bettler gab tüchtig zurück, dass Cornelis durch die Tränen schmunzelte.
Endlich waren sie allein. Nur struppige Hunde begleiteten sie noch auf ihrem Weg. Schnell und sicher lief Cornelis durch die verlassenen, übel riechenden, engen Nebengassen, die nie ein Sonnenstrahl berührte. Jeden Weg und jeden Steig kannte er hier, immer noch. Gewiss, wenn er in die Stadt kam, war es vor allem die große Apotheke an der Hauptstraße, die er aufsuchte, um Kräuter, Salben und Essenzen zu erstehen und sich mit Meister Apothecarius Philippus Stroobandt und seiner Frau Rieke über Rezepturen und Heilmethoden auszutauschen. Doch immer wieder tauchte er auch in das unruhige Gewebsel der kleinen Gässchen ein, um sich nach dem Bader durchzufragen. Dem Bader, dem er damals seinen Wagen überlassen hatte, als er dem Ruf des Königs gefolgt war. Jeremiah Tobit Zand.
Jeremiah Tobit Zand war der Sohn eines Henkers und niemand wusste, woher er gekommen war. Cornelis war vollkommen sicher gewesen, dass er der Richtige war. Der Junge war mit all den intimen Kenntnissen der Anatomie begabt, die der Beruf mit sich brachte. Er war sanftmütig und wissbegierig und tapfer. Er hatte den Stolz der Geächteten. Doch die Liebe zu Strick und Beil, Streckbank und Würgeisen, die seinen Vater beseelte, Jeremiah hatte sie nie empfinden können und schließlich hatte er es aufgegeben: Auch wenn er immer eines Henkers Sohn blieb – er würde kein Henker sein.
Jeremiah hatte gewusst, was das bedeutete. Ein Leben lang waren Leute vor ihm auf die andere Straßenseite gewichen. Zum Henker wurde man geboren. Es gab keine andere Arbeit für ihn. Wahrscheinlich würde er untergehen. Aber er würde erhobenen Hauptes untergehen. Und so war er von zu Hause fortgerannt. Weit, weit fort.
Als er auf seiner Flucht Cornelis in die Arme gelaufen war, hatte der englische Bader den halb verhungerten Jungen ohne Zögern zu seinem apprentice gemacht und seine kargen Mahlzeiten mit ihm geteilt. Der Junge hatte rasch gelernt und mit Freuden. Und in den gut zehn Jahren, die er nun schon alleine arbeitete, war Zand zur Vollkommenheit gereift. Fast alles, was Cornelis damals getan hatte, hatte auch Zand schon getan, und prächtig. Vom Stechen des Stars verstand Zand mehr als er. Von Geschäften sowieso. Wenn der Physikus heute zu ihm kam, dann nicht als Lehrmeister, sondern als Kollege. Und als Freund. „Wo ist Zand?“, fragte er den Bettler, doch der wusste es nicht.
Der erste Glockenschlag fiel wie ein Stein. Der düstere Hall blieb zwischen den Hauswänden hängen. Cornelis fühlte ihn in seinen Eingeweiden. Er presste die Lippen zusammen und beschleunigte seinen Schritt. Mit einem Mal wankten von überall her unstete Gestalten heran, Blinde, Lahme, Alte, Kranke, schemenhaft, grau kamen sie aus den Häusern, vom Klang der schweren Glocken zur letzten Anspannung getrieben, hin zur Kathedrale vor der Stadt, wo, so hatten die Ausrufer es schon tagelang verkündet, nach der Begräbnismesse Almosen für alle ausgeteilt würden, die der Feier beigewohnt hatten, Brot und Münzen, heilkräftige Bildchen und geweihte Blechkreuzlein, dem Toten zur Ehre und den Lebenden zu Wohlgefallen. Machtvoll quoll jetzt der dunkle Glockenklang in die engen Gassen hinab. „Schneller“, sagte Joris.
Endlich schwemmten die dumpfen Schallwellen die beiden in die helle Sonne durch das Stadttor hinaus, die Allee entlang, hin zu dem großen Platz, auf dem sich der mächtige, von Glockenschlägen vibrierende Turm der Klosterkirche in den frühlingsblauen Mittagshimmel emporschwang. Sie blinzelten. Der große Arzt schob sich durch die Massen, die zur Kathedrale strömten, bis zu den breiten Eingangsstufen, deren flache Tritte wie gemacht für Berittene waren, Ritter, Edelleute, Könige. Er stieg die Treppe hinauf. „Eure Börse“, sagte Joris und hielt ihm den Beutel hin. Cornelis schüttelte den Kopf und setzte den Bettler neben dem mächtigen, filigran ziselierten Granitportal ab, dessen schwere Eichentüren weit geöffnet waren. „Es ist nicht viel.“
„Habt tausend Dank, Doctor!“ Entzückt steckte Eijckhout den Beutel wieder ein, rückte sich zurecht, zog die Bettelbüchse heraus und begann mit geübter, klarer Stimme um Almosen zu bitten. Cornelis blieb stehen und starrte geradeaus. Joris unterbrach sich „Nun geht schon hinein“, raunte er dem Arzt zu. „Tut’s um meinetwillen, der ich hier draußen zu arbeiten habe, dass ich’s auch erlebe… durch Euch - - - Almosen! Gebt Almosen, liebe Leute! Der Himmel wird es euch danken!“
Cornelis nickte und zog sich zurück. Ein reicher Freund verdarb das Geschäft. „Doctor!“ rief es da halblaut hinter ihm. Er drehte sich um. Joris winkte mit einer Münze. „Für die Kollekte!“ Die Kollekte. Natürlich. Er war lange in keiner Messe gewesen.