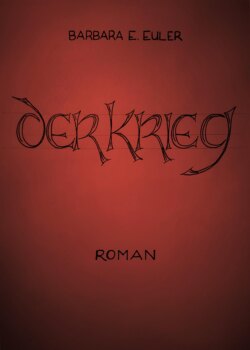Читать книгу Der Krieg - Barbara E. Euler - Страница 4
Erstes Kapitel
ОглавлениеEr erreichte die Kathedrale, als die ersten schweren Tropfen fielen. Wie in Trance drückte er das hohe Portal auf, taumelte über den marmorbelegten Mittelgang und sank auf eine durch langen Gebrauch blank gewetzte eichene Chorbank, während draußen grüngraue Wolken wuchtige Wasserströme entließen.
Das himmelhohe Dämmerdunkel der Klosterkirche umfing Gabriel und barg ihn sanft. Er schloss die Augen und überließ sich den Liebkosungen der silbrigen Orgelklänge, die von ferne an sein Ohr drangen. So würde es sein… vielleicht… vielleicht…
Als ein Schatten auf ihn fiel, erwachte er. Ein Priester stand vor ihm. Gabriel sah ihn an. „Ich sterbe, Vater“, sagte er leise und ohne Bedauern. Die Schlacht war siegreich gewesen und seine Königin hatte ihn in Ehren entlassen. Er hatte einen guten Anteil am Töten und Verwunden gehabt und nun war er selbst an der Reihe. Es würde nicht mehr lange dauern – ein paar Stunden, ein paar Tage. Wenn nur der Schmerz ein wenig nachließe.
Wenn nur der Schmerz ein wenig nachließe.
Erschrocken beugte der Priester sich zu ihm herab und wollte ihm aufhelfen. Gabriel schüttelte sanft den Kopf. Berührt oder gar bewegt zu werden, bereitete ihm mehr Schmerzen, als er noch ertragen konnte.
Aber da war noch etwas, das er sagen musste. Gabriel schloss die Augen. Von Stunde zu Stunde wurde es schwerer, klar zu denken. In seinem Kopf stürzte alles durcheinander, wahllos, haltlos. Es wäre leichter, jetzt zu gehen. Aber er durfte nicht.
Schließlich befreite ein gnädiger Engel ihn von dem verworrenen Geflecht seiner Gedanken und legte mit zarten Händen den reinen Kern dessen bloß, was von ihm geblieben war, das, weshalb er es bis hierher geschafft hatte trotz allem. Ja, das war es. Gabriel richtete seinen Blick auf den Priester und sagte: „Holt Schwester Agnes.“
Die Verrückte.
Der Priester zuckte zusammen. Keine der Schwestern durfte das nahe gelegene Kloster je verlassen außer der Schwester Oberin, und die Verrückte schon gar nicht. Agnes. Schwester Agnes. Jede andere wäre längst dem Scheiterhaufen zum Opfer gefallen, doch über diese hier hatte die Obrigkeit ihre schützende Hand gehalten, Gott weiß, warum. Und jetzt wollte dieser wappengeschmückte Kämpfer, dass sie herauskäme. „Nein“, sagte der Priester rundweg und wandte sich zum Gehen. Er würde später nach ihm sehen. Vielleicht wäre er dann schon... Und kein Wort von Agnes. Zu niemandem.
„Das ist ein Befehl“, sagte der Ritter unerwartet scharf. Der Priester fuhr herum und sah in das fahle Gesicht des Verwundeten. „Oder… der letzte Wunsch… eines Sterbenden“, ergänzte dieser matt, aber lakonisch. Sucht es Euch aus, hätte er hinzugefügt, wenn er noch die Kraft dazu gehabt hätte, doch der Priester verstand ihn auch so.
Klopfenden Herzens warf der Priester seinen Mantel über und durchschritt den prasselnden Wolkenbruch, um zum Kloster hinüberzugehen. Schwester Oberin ließ ihn ein. Er schluckte und versuchte, die Worte „Bringt Schwester Agnes zu mir“ hervorzubringen, doch da hörte er sie schon schreien. „Schwester Agnes“, sagte Schwester Oberin entschuldigend. „Bringt sie zu mir“, würgte der Priester hervor. „Das ist unmöglich, Hochwürden“, wollte Schwester Oberin wahrheitsgemäß und mit der gebotenen Höflichkeit antworten, doch das war nicht nötig, denn da kam sie schon, kreischend und um sich schlagend und die zwei kräftigen Schwestern, die sie an den Armen halten wollten, entschlossen abschüttelnd. Jetzt stand sie vor ihm, wilden Blickes, außer Atem, stumm und zum Gehen bereit, als sei dies das Selbstverständlichste auf der Welt. „Wir sind gleich zurück“, keuchte der Priester, packte Agnes bei der Schulter und eilte mit ihr hinaus und war schon von den dunklen Regenmassen verschluckt, ehe Schwester Oberin ihre Stimme wiedergefunden hatte.
Sie war da. Mühsam richtete Gabriel seinen Blick auf die Frau. Sie war da. Jetzt würde alles viel leichter werden und viel schwerer. Gerne hätte er seine Tränen niedergekämpft, doch er musste sich auf andere Dinge konzentrieren. Im tropfnassen Habit stand sie vor ihm. „Habt… keine…“, er atmete hastig. „Ich habe keine Angst, Herr“, versicherte ihn das Mädchen. Entschieden löste es sich aus dem Griff des neben ihm stehenden atemlosen Priesters. „Bitte lasst uns alleine, Hochwürden“, sagte es bescheiden, aber fest. „Ich komme dann zu Euch… in die Sakristei…“. Da war etwas in ihrer beider Blicke, das Gabriel irritierte, aber er wusste, dass er keine Zeit mehr haben würde, es zu ergründen. Der Priester nickte und zog sich zurück.
„Guten Tag… Goedele“, flüsterte Gabriel (sprich: chúddele). Wehrlos brach da die Frau in die Knie, ohne ihren Blick von dem Mann zu lösen. Goedele. Keiner hatte sie so genannt, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war. Auf einmal begriff sie. Das war er. Er, nach dem sie sich verzehrt hatte, er, nach dem sie gefragt und geschrien hatte, solange sie zurückdenken konnte. Ihr Bruder. Sie hatte wirklich einen Bruder. Alle hatten sie gelogen. Es war alles wahr, alles, was sie gedacht und gefühlt hatte.
Plötzlich war auch sein Name wieder da.
„Lelle“, hauchte sie.
Gabriel nickte. „Oh, du mein Gott…“, wisperte Agnes und berührte den Mann an der Wange, sehr sachte nur. Zum Kloster gehörte ein Hospital und sie hatte genug Elende gepflegt, um zu wissen, dass sie einen Sterbenden vor sich hatte, der Qualen litt. Lelle. Mein Gott, Lelle… „Ich hole Hilfe“, stammelte sie. Gabriel schüttelte den Kopf. Jetzt musste er es sagen. „Wir sind Zwillinge, Goedele“, flüsterte er. Agnes erstarrte und schlug die Hände vor den Mund.
Zwillinge waren Teufelszeug, von Müttern geboren, die es mit zwei Männern zugleich getrieben hatten. Sie mussten getötet werden oder zumindest einer von ihnen. Und ihre Mütter… wurden als Hexen verbrannt. Die seltsamen Blicke, das Getuschel, die hämischen Gesichter, die vielen Verbote, plötzlich bekam alles einen Sinn. Aber ihre Mutter war nicht tot. Ab und zu brachte jemand Kunde von ihr.
Längst war der silberhelle Klang der Orgel erstorben. „Madeleine… sie ist nicht… unsere Mutter“, sagte Lelle in die Stille hinein. Er konnte ihre Gedanken lesen. Goedele sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. „Und unsere Mutter… wurde sie…?“ Lelle nickte. Er dachte an alle, die um das Geheimnis wussten und wie er sie in Schach gehalten hatte dank seines Ranges und seines Geldes und dass er Goedele nun nicht mehr würde schützen können vor den gierigen Griffen der unersättlichen Henker. Er wollte so viel erklären, doch er konnte nicht. „Flieh…“, flüsterte er nur und zu seinem Erstaunen nickte sie voller Vertrauen.
Das war gut. Gabriel schloss die Augen. Nun kam das Schwerste und er wusste nicht, ob er es können würde. Aber er musste. Er musste…
Sein Bewusstsein kam und ging jetzt in Wellen, deren Abstände immer größer wurden. Aber sie war da – sie – sie! und er konnte sich an ihr festhalten. Als die nächste Welle kam, heftete er fest seinen Blick auf die Schwester und sagte ruhig: „Nimm mein Gewand.“
Mein Gott.
Diese Bedachtheit. Dieser Mut. Goedele wusste, dass die kleinste Bewegung Lelle unsägliche Schmerzen bereitete, doch er wollte es für sie wagen. Jetzt konnte auch sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Nein. Nein! Er sollte so nicht leiden.
Er musste nicht.
Sie zog ein irdenes Fläschchen aus den durchnässten Falten ihres Habits. Wenn die Männer über sie kamen – oh du mein lieber Gott, sei gepriesen dafür, dass Lelle das nie erfahren würde – trank sie davon. Man spürte keinen Schmerz. Und man vergaß. Sie nahm oft davon.
Sie bereitete den Trank selber. Sie hatte Geschick mit Heilpflanzen und nach einer Weile hatte Schwester Oberin sie gewähren lassen, weil ihre Gebräue, Salben und Pillen den Siechen halfen. Sie musste es von ihrer Mutter haben. Einer „Hexe“… Vage nahm sie wahr, wie sich auf einmal alles zu einem Ganzen fügte.
Sie entkorkte das Fläschchen und hielt es Lelle behutsam an den Mund. Der schwarze, bittere Trank tropfte auf seine Zunge und zu ihrem Erstaunen schluckte er ihn voller Vertrauen.
Während sie ihm den starken Sud einflößte, beobachtete sie ihn aufmerksam. Sie hatte selber mit der Menge experimentiert und mehr als einmal war sie beinahe über die Grenze gegangen, weil die Fühllosigkeit und das Vergessen nicht kommen wollten. Aber Lelle brauchte mehr. Viel mehr.
Wie weit konnte sie gehen? Sie wollte nicht diejenige sein, die ihn tötete.
Aber vielleicht war es das ja. Vielleicht sollte sie seine Erlöserin sein. Vielleicht musste sie es tun…
„Du musst es nicht tun“, sagte Lelle sanft. „Es ist meine Sache“. Goedele nickte stumm. Langsam verschloss sie das Fläschchen und barg es unter ihrem Gewand. Sie sahen einander lange an. Mit Blicken bedeutete Lelle ihr schließlich, dass sie anfangen konnte. Goedele nickte und wischte die Tränen fort. Sie legte ihr durchnässtes Skapulier ab und rollte die weißen Ärmel ihres Unterkleides hoch. Vorsichtig schlug sie Lelles schwarzen, brokatsamtenen Umhang mit dem ritterlichen Wappenemblem zurück. Sie hatte eine Menge Blut erwartet, aber da war nichts. Sie wusste, was das bedeutete. Er verblutete innerlich. Es gab keine Hilfe. Keine.
Große Schweißperlen sammelten sich auf Lelles Gesicht, als sie behutsam begann, den gepolsterten Gambeson zu öffnen, den Ritter unter ihrer Rüstung tragen. Lelle war aschfahl, aber bei Bewusstsein. Er atmete hastig und sah sie an, um Trost ringend. Jede Berührung durchfuhr seinen Leib wie der harte Stoß von Isobolds Lanze, der ihn im Galopp gefällt und ihm die Eingeweide zerrissen hatte.
Agnes arbeitete zügig, mechanisch, sie hatte gelernt, wie man alles ausblendet, was dabei stört, Geräusche, Gerüche, Gedanken. Gefühle. Als sie in Lelles wächsernes, schweißgebadetes Gesicht sah, begann sie unwillkürlich zu murmeln, einen Singsang, den sie kannte, den sie erinnerte, eine hypnotisierende Weise, sie hatte nicht gedacht, dass sie es können würde. Dass sie es versuchen würde. Es war Teufelszeug, Tobi hatte es getan, der schwarze Sklave, den man ihnen eines Tages gebracht hatte, tödlich geschwächt von einer Krankheit, die nicht zu heilen war – Heimweh. Er hatte ihre Nähe gesucht. Er hatte sie erkannt mit ihren Gaben. Er hatte ihr gezeigt, wie man mit Worten und Gesang tröstlichen Schlaf bringt. Sie hatte gelauscht, erschrocken und entzückt, hatte wohl auch daran gedacht, es ihm gleichzutun, doch sie wusste: Der pechschwarze Mann war des Teufels. Ihn aufzunehmen, war Christenpflicht, doch wer seinen Lehren anhing, war der Hölle gewiss. Und jetzt war sie hier und ihre Zunge und ihr Herz liefen über von dem heilenden Gesang, der in ihr gewesen war die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Für diesen einen Augenblick. Und Lelle wurde ruhig, seine Gesichtszüge entspannten sich und die Lider wurden ihm schwer. „Danke, Tobi“, flüsterte Goedele, als sie ihren Bruder behutsam aus den Kleidern schälte.
Lelle schlug die Augen auf. „Nimm... das… hier…“. Er versuchte etwas unter dem leinenen Hemd hervorzuziehen, doch er war zu schwach. Goedele ergriff seine Hand und half ihm, während unablässig der weiche Singsang aus ihrer Kehle strömte. Ihrer beider Hände ertasteten eine lederne Kapsel, die an einem Riemen um seinen Hals hing. Goedele öffnete die Kapsel. Sie enthielt ein gesiegeltes Schreiben der Königin. „Zeig es… den Wachen…“, wisperte Lelle matt, „… verlier… es nicht…“. Goedele nickte und verstaute den kostbaren Passierschein wieder in der Kapsel und nahm Lelle das Kleinod behutsam ab und streifte den Riemen über ihren Kopf. Dabei fasste sie an das grobe Holzkreuz um ihren Hals, an dem man die Mitglieder des Ordens genauso gut erkannte wie an ihrem Habit. Hastig riss sie es ab und berührte damit behutsam Lelles schweißnasse Brust unter dem Leinhemd. Gott segne dich. Gott segne dich. Dann legte sie das Kreuz auf das Skapulier am Boden. Sanft breitete sie den dicken Umhang über den in seinem weißen Untergewand daliegenden Ritter.
Lelle versuchte den Kopf zu schütteln. „Du… brauchst ihn“, hauchte er. Goedeles Augen brannten, während sie die grobleinene Tunika ablegte und in Beinkleider, Gambeson und Stiefel schlüpfte. Steh uns bei, Herr. Steh uns bei.
Der Gambeson war weich gepolstert und warm. Sie zog die Schlaufen über ihrem Körper fest, der schmal war wie der eines Knaben, und schnürte die Stiefel. Langsam hob sie jetzt den schützenden, weit wallenden, schweren Umhang vom Körper ihres Bruders und hüllte sich hinein. Dann erstarb ihr Gesang. Es war vollbracht.
Sie stellte ihr irdenes Fläschchen neben Lelle auf die Chorbank. „Danke“, sagten seine Augen. Goedele richtete sich auf, das zusammengeknüllte, nasse Skapulier mit dem Kreuz unter dem Arm. „Begrab es…“ brachte er kaum hörbar hervor. Sie nickte.
Die Zwillinge sahen einander ein letztes Mal an. Lelle bewegte die Lippen.
Drei Worte. Komm schon. Nur noch drei Worte. Das kannst du. Für sie kannst du das.
„Geh nach Norden!“, sagte er endlich, sehr deutlich und sehr fest. Dann schloss er die Augen.
Sacht machte Goedele ein Kreuzzeichen auf seiner Stirn. Dann zog sie die Kapuze über ihr feines Antlitz und trat ins Freie. Auf dem Friedhof war ein frisches Grab. Entschlossen schob sie die weiche, sandige Erde beiseite, legte ihr Habit hinein und häufte die Erde wieder darüber.
Der Regen hatte aufgehört und eben brach ein erster Sonnenstrahl durch die Wolken. Goedele erhob sich von dem Grab und schritt durch das Friedhofstor hinaus.
Der Pfarrer kam aus der Sakristei zurück. Agnes war verschwunden. Der Ritter lag bewegungslos, im weißen leinenen Untergewand. Durch die bunten Glasfenster fiel ein Sonnenstrahl auf sein lächelndes Gesicht.