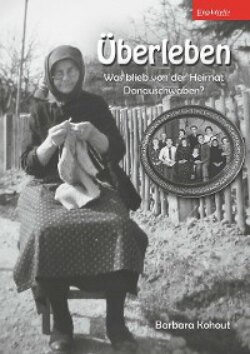Читать книгу Überleben – Was blieb von der Heimat Donauschwaben? - Barbara Kohout - Страница 16
Ein Poker um die richtige Staatsbürgerschaft, – der Not gehorchend Auswanderung
ОглавлениеMein Großvater war kein ungarischer Staatsbürger. Als „Serbe“ deutscher Abstammung sollte er sich innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob er die ungarische Staatsbürgerschaft annehmen wollte. Er litt aber unter der Ablehnung und den absichtlichen Kränkungen durch seine früheren ungarischen Freunde. Zudem war die finanzielle Absicherung der Familie mehr als ungewiss. Für ihn war es unter diesen Umständen undenkbar, die ungarische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Es stellte sich die Frage, ob die Familie nicht nach Stanischitsch übersiedeln sollte. Dort wären die Bedingungen für meinen Großvater besser. Aber meine Großmutter konnte kaum Deutsch. Das Wenige, das sie im deutschen Unterricht gelernt hatte, konnte die Umgangssprache Ungarisch nicht ersetzen. Wie sollte sie in Stanischitsch zurechtkommen?
In Serbien handhabte man die Frage der Staatsbürgerschaft großzügiger. Die Minderheitengruppen hatten eine mehrjährige Bedenkzeit, ob sie serbische Staatsbürger werden wollten. Einige wollten es, weil damit Privilegien verbunden waren. Auch stand ihnen der Staatsdienst offen. Doch viele wollten es nicht. Sie behielten ihre deutsche oder ungarische Staatsbürgerschaft bei.
Meine Großmutter war ein lebensfroher Mensch, der sich gern mit anderen unterhielt. Sie interessierte sich weniger für ihre rechtliche Situation in Serbien. Weit wichtiger war für sie die Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Und sie hatte die offene Verachtung nicht vergessen, mit der die deutsche Verwandtschaft die Bekanntgabe ihrer Verlobung aufgenommen hatte. Sie wehrte sich zunächst verzweifelt gegen den Vorschlag ihres Mannes, nach Serbien auszuwandern. Sie war fest entschlossen, niemals ihre ungarische Staatsbürgerschaft aufzugeben.
1922 wurde meinen Großeltern ein zweites Mädchen geboren. Die wirtschaftliche Situation meiner Großeltern war weiterhin problematisch. Oft gab es nicht ausreichend Essen. Deshalb war Elisabeth zart und kränklich. Immer wieder stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Es musste eine Entscheidung getroffen werden. Schließlich stimmte meine Großmutter schweren Herzens und der Not gehorchend der Auswanderung zu. Sie erschien als das kleinere Übel. Meine Großeltern verkauften ihr Geschäft in Baja – unter diesen Umständen zu einem Schleuderpreis – und wanderten nach Stanischitsch aus. Vorübergehend konnten sie im Elternhaus meines Großvaters ein kleines Zimmer bewohnen. Das ungeschriebene Gesetz der Gastfreundschaft musste auch die Schwägerin Eva zähneknirschend einhalten.
Meine Großmutter war eine Kämpfernatur. Sie wollte sich nichts schenken lassen. So schnell wie möglich wollte sie wieder einen eigenen Hausstand haben. Der Schwägerin ging sie aus dem Weg so gut es ihr möglich war. Die verächtlichen Blicke und kritischen Bemerkungen zu ihrer fatalen Situation kränkten sie, was natürlich auch die Absicht der Schwägerin war. Nach dem Umtausch des Verkaufserlöses für ihren Besitz in Baja hatten meine Großeltern die Mittel, um ein kleines Grundstück in Stanischitsch in der Wassergasse zu kaufen. Gemessen an dem, was mein Großvater einmal besessen hatte, an seinen beruflichen Aussichten in der Zeit vor dem Krieg und den finanziellen Möglichkeiten der Verwandtschaft, war es ein winziger Besitz. Er lag neben einem Graben, der sich im Herbst und im Frühjahr mit Wasser füllte und einen Teich bildete. Im Sommer war der Graben zwar ausgetrocknet. Aber die feuchte, sumpfige Umgebung war Brutstatt für Millionen Mücken.
Doch mit viel Mut und Hoffnung starteten meine Großeltern ihr neues Leben. Das Haus errichteten sie überwiegend in Eigenleistung. Trotzig und unermüdlich arbeitete auch meine Großmutter jede freie Minute auf der Baustelle. Natürlich wurden sie von der Familie unterstützt. Dies galt als selbstverständlich. Die Verwandtschaft war jedoch nicht übereifrig. Das geplante Haus war, entsprechend der finanziellen Mittel, klein. Es wurde nach der Tradition der ersten Siedlerhäuser errichtet: Die Giebelseite des Hauses hatte jeweils ein Fenster, das „Gassenfenster“, und rechts daneben befand sich die Eingangstüre. Diese führte aber nicht direkt ins Haus, sondern zu einem Säulengang, von dem man in die einzelnen Zimmer gelangte. (Inzwischen sind alle Häuser, die ich während meiner Serbienreise besucht habe, erweitert worden, indem dieser Gang zugemauert wurde, wodurch sich die Räumlichkeiten um diesen Platz vergrößern. Das ist an den Fassaden sowie an der Dachstruktur noch deutlich zu erkennen.) Die erste Tür war der Eingang zur „Gassenstube“, dem Paradezimmer. Es wurde nur zu besonderen Anlässen genutzt. Daneben lag die Schlafkammer. Begrenzt wurde der Flur durch den Eingang zur Sommerküche. Sie war der Arbeits- und Wirtschaftsraum. Meine Großmutter pflanzte an jede der fünf Säulen einen Weinstock. Sie ließ ihn unverschnitten ranken. An heißen Sommertagen genossen wir den Schatten, zu Beginn des Herbstes die köstlichen, süßen Trauben. Der Zugang von der Straße zum Hof wurde durch ein großes hölzernes Tor versperrt.
Hinter jedem Siedlungshaus war der Wirtschaftshof mit den Schweine- und Hühnerställen und Geräteschuppen sowie der Lagerraum für Brennholz. Daran anschließend kam der Gemüse- und Nutzgarten. Ich erinnere mich vor allem an einen Quittenbaum in Großmutters Garten. Er war für unsere Familie geradezu legendär, weil er so reichliche Früchte trug. Nach relativ kurzer Bauzeit konnten sie ihr Haus beziehen, auch wenn es noch längst nicht fertig war. Was machte das schon? Sie waren wieder ihr eigener Herr im Haus.
Mein Großvater begann erneut als “Balbier“ zu arbeiten. Er fuhr mit dem Fahrrad auf die Dörfer und warb um Kundschaft. Er musste schon um vier Uhr morgens aus dem Haus, denn die Bauern waren sonst nicht mehr anzutreffen. Meist bekam er Naturalien als Lohn. Es gab durchaus feste Tarife. Die Zahlung bestand in einer bestimmten Menge Zucker, Mehl, Eiern oder anderen Erträgen aus der Landwirtschaft und was er der Jahreszeit entsprechend aushandeln konnte. Geld bekam er nur für das Schneiden der Haare. Auf diese Weise hatte die Familie wenigstens etwas zu essen. Wenn meine Großmutter Brot backen wollte, brauchte sie für 5 Para Hefe, die sie oft nicht hatte. 100 Para waren 1 Dinar. Das ist vergleichbar damit, dass eine Hausfrau heute keine 5 Eurocent besitzt, um etwas Hefe zu kaufen.
Meine Großeltern waren der Verwandtschaft als Ausgleich für die Hilfe selbstverständlich verpflichtet. Großmutter musste im Kolonialwarengeschäft ihres Schwagers einkaufen. Aber um Kredit oder Zahlungsaufschub zu bitten, verbot ihr der Stolz. Andererseits bedrängte sie Großvater mit Tränen oder Vorwürfen, weil sie Geldsorgen so unglücklich machten. Dies half beiden auch nicht weiter. Es war eine harte Zeit.
Von Großvater erwarteten seine Brüder, dass er zum Haareschneiden oder zum Rasieren ins Haus kam. “Der arme Michl bekam dann als besondere Gunsterweisung eine Tasse Kaffee“, lese ich auf einer hellblauen Serviette, die ich offensichtlich bei einem Familientreffen aus Mangel an Notizpapier beschrieben hatte. Das Motto meiner Vorfahren hieß: „Sich regen bringt Segen.“ Das zahlte sich auch bei meinen Großeltern aus und es wurde nach und nach leichter für sie. Meine Großmutter schaffte sich ein paar Hühner, Enten und Gänse an. Besonders die Enten und Gänse nutzten im Frühjahr den Teich vor dem Haus. Im Garten wuchsen Gemüse und Salat. Im zweiten Jahr wurde zum Winter bereits ein Schwein geschlachtet. Die Versorgung wurde zunehmend besser. Der Großvater war bald wieder bei seiner Kundschaft beliebt. Seine Frohnatur setzte sich durch, und er erzählte wieder leutselig als lebendes Tagblatt alles, was es an Tratsch und Neuigkeiten zu verbreiten gab. Aber es blieb schwierig. Vor allem belastete meine Großeltern die Hypothek, die auf dem Haus lag.
Als es im Herbst 1924 kühl wurde, wollte Ama für ihre beiden Mädchen Strümpfe stricken. Um Wolle zu kaufen, war kein Geld da. Also besorgte sie Zuckersäcke, die aus feinem, weißem Hanf gewebt waren. Diese Fäden wickelte sie auf Knäuel und strickte damit Strümpfe. Am Tag hatte sie dafür aber keine Zeit. Um Petroleum für die Lampe zu sparen, saß sie in mondhellen Nächten ohne Licht im Bett und strickte nach Gefühl. Dann schlief sie 3 – 4 Stunden bis Ata wieder aufstehen musste, um zur Arbeit zu fahren. In dieser Zeit war sie wieder schwanger. Im Dezember wurde dann meine Tante Susanna geboren, die Susitante, wie ich sie nach donauschwäbischem Brauch nenne. Ata nutzte die Gelegenheit zu einem kleinen Nebenerwerb und begann im Winter, in Gasthäusern zum Tanz aufzuspielen. Auch bei Hochzeiten ließ er sich engagieren.
Wegen des kalten Winters waren die Mädchen oft erkältet. Elisabeth war besonders anfällig. Doch es fehlte das Geld für ausreichend Medizin. Als es endlich Frühling wurde, war Elisabeth abgemagert, blass und hatte kaum Appetit. Ende Mai wurde sie wieder schwer krank. Sie bekam hohes Fieber. Die Familie und auch die Verwandten machten sich große Sorgen um sie.
Als Elis im Juni 1925 starb, fühlte sich meine Mutter entsetzlich schuldig. Sie dachte, Elis sei gestorben, weil sie sich das gewünscht hatte, um auch ein Stückchen von der Schokolade zu bekommen, die ihr die Tante Eva gebracht hatte. Wie grausam sind Zeiten, in denen Eltern so mit Sorgen beladen sind, dass sie die emotionalen Bedürfnisse und Nöte ihrer Kinder nicht mehr wahrnehmen. Solche Wunden heilen nie. Meine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt, als sie bereits 80 Jahre alt war!
Das Haus meiner Großeltern war damals recht einsam am Dorfrand gelegen. Deshalb haben sie sich einen Bernhardiner Hund zugelegt. Im Juni hatte es sehr viel geregnet und der Teich vor dem Haus war vollgelaufen. Meine Mutter spielte dort in der Nähe unbeaufsichtigt, während die Familie in ihrer Trauer um den Tod des kleinen Mädchens im eigenen Kummer gefangen war. Das Ufer des Teiches war schlammig und glitschig. Plötzlich rutschte Katharina aus und fiel in den Teich. Der Hund hat das beobachtet und sprang ihr nach. Er packte sie bei ihrem Hemdchen und fing laut an zu winseln. Er konnte sie nicht mit eigener Kraft ans Ufer ziehen. Zum großen Glück hörte Ama schließlich sein Winseln und schaute nach. Wie froh war sie, dass es nicht noch eine Beerdigung geben musste.
1925 war für meine Großmutter ein unendlich schweres Jahr. Neben den Geldsorgen drückten die Sorgen um das kranke Kind und sein Tod. Sie wusste nicht, wie sie die tiefe Trauer darüber abschütteln sollte. Die kleine Susanne war bei Elises Tod erst 6 Monate alt und vielleicht war sie die Lebensretterin von Ama, denn das Baby brauchte seine Mutter. Doch nicht genug damit, litt Ama auch unter der Isolation. Einmal suchte sie Trost beim Pfarrer. Doch dieser konnte sie nur nach dem Weltbild der damaligen Zeit „trösten“. Unglück, das den Menschen widerfuhr, konnte nur eine Strafe Gottes für heimliche Sünden sein. Die sollte sie bekennen und bereuen, dann würde ihr Gott vergeben. Aber noch mehr Schuldgefühle konnte meine Großmutter nicht gebrauchen. Nach diesem Gespräch betrachtete sie Pfarrer als persönliche Unglücksboten. Wenn ihr einer begegnete, unternahm sie an dem Tag nichts mehr. Sie sagte, er sei so gefährlich wie eine schwarze Katze. Außerdem glaubte sie an den Spruch: „Wer einen Vetter im Himmel hat, kommt auch hinein.“
Langsam drohte sie in Schwermut zu versinken. Ata schimpfte sie aus. Sie sollte doch an ihr eigenes Zuhause denken, dann wüsste sie, wohin es führt, wenn sie sich nicht zusammenreißt. Ata erinnerte sie an die psychisch Kranken, die von seinem Schwiegervater zu Hause mit einer „Beschäftigungstherapie“ betreut wurden. Die Kranken mussten zum Beispiel Besteck polieren – den ganzen Tag. Wenn sie einmal damit fertig waren, mussten sie wieder von vorne anfangen. Da man mit dem medizinischen Wissen von damals Depression noch teilweise als Schwachsinn oder Geisteskrankheit oder Irrsinn bezeichnete, gab man sich zwar alle Mühe, die Betroffenen zu verwahren und vielleicht zu beschäftigen, aber verstanden hat man diese bedauernswerten Menschen gewiss nicht.