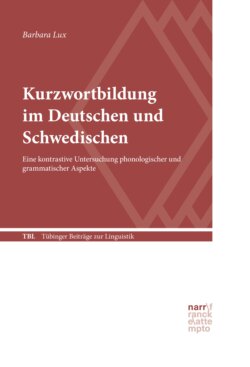Читать книгу Kurzwortbildung im Deutschen und Schwedischen - Barbara Lux - Страница 24
2.4.1 Forschung zu deutschen Kurzwörtern
ОглавлениеGrundlegend für die neuere Forschung zur Kurzwortbildung im Deutschen ist Henrik Bergstrøm-Nielsens Artikel von 1952 „Die Kurzwörter im heutigen Deutsch“. Darin erfolgt statt einer bis dahin vorherrschenden lediglich sprachstilistischen Kritik eine der ersten sachlichen Untersuchungen des Phänomens. Aufbauend auf der in Kapitel 2.3 bereits erörterten Unterscheidung zwischen auf die Schrift beschränkten Abkürzungen und Kurzwörtern, die auch eine lautliche Kürzung aufweisen, differenziert Bergstrøm-Nielsen die Kurzwörter weiter und teilt sie in vier Typen ein, die er ausführlich bespricht und unter anderem unter den Aspekten Orthografie, Genus, Flexion, Artikelgebrauch und Wortbildungsmöglichkeiten betrachtet. Damit stellt sein Artikel eine sehr ausgewogene Arbeit dar, die das Phänomen der Kurzwortbildung von vielen Seiten beleuchtet. Im Unterschied zur vorliegenden Arbeit berücksichtigt Bergstrøm-Nielsen jedoch auch Kunstwörter wie Persil < Perborat + Silikat und Osram < Osmium + Wolfram. Eine zum Entstehungszeitpunkt der Kürzung tatsächlich vorhandene Vollform scheint für ihn kein Kriterium für die Wertung eines Belegs als Kurzwort gewesen zu sein; sein Kurzwortbegriff ist also deutlich weiter gefasst als in der vorliegenden Arbeit.
Zu deutschen Kurzwörtern sind bislang fünf Dissertationen erschienen, die das Phänomen der Kurzwortbildung aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Schwerpunkten beleuchten. Es handelt sich dabei um Hofrichter (1977), Vieregge (1978), Kobler-Trill (1994), Steinhauer (2000) und Balnat (2011). Die erste Dissertation über Kurzwörter im Deutschen war Werner Hofrichters Arbeit „Zu Problemen der Abkürzung in der deutschen Gegenwartssprache“ (Hofrichter 1977). Im Titel klingt bereits an, dass Hofrichters Interesse über Kurzwörter an sich hinausgeht. Abkürzung ist für ihn der Oberbegriff für sämtliche gekürzten Formen, ob sie nun graphisch und lautlich oder nur graphisch gekürzt sind (12). Kurzwörter sind für ihn „ihrer Herkunft nach Abkürzungen“ (34), die jedoch „auf Grund lautlicher, semantischer und morphologischer Besonderheiten“ eine Zwischenstellung zwischen Abkürzungen und Vollformen einnehmen. In Hofrichters Arbeit kann man einen Versuch sehen, alle relevanten Aspekte der Kurzwortbildung zu bearbeiten: Von einer Klassifikation der Abkürzungen über Morphologie und Semantik thematisiert Hofrichter viele interessante Aspekte, wobei er jedoch aufgrund der Abgrenzung seines Untersuchungsgegenstands stets auch reine Schriftkürzungen im Blick hat. Hofrichter erarbeitet eine gründliche und systematische Klassifikation für Kurzwörter und Abkürzungen, die jedoch wenig intuitiv ist und zu sehr komplizierten Ergebnissen führt. Die Klassifikation erfolgt auf mehreren Ebenen: Zunächst werden prozess-orientiert, d.h. nach der Bildungsweise, verschiedene Abkürzungstypen wie linear, nicht-linear etc. unterschieden. Erst als zweites Kriterium folgt die Existenz einer eigenen Lautform. Bergstrøm-Nielsens grundlegende Unterscheidung zwischen Kurzwörtern und Abkürzungen spielt also für Hofrichter durchaus eine Rolle, allerdings ist die Existenz einer gekürzten Lautform nur ein Kriterium unter vielen. Schließlich wird bei Hofrichter noch nach Getrennt- oder Zusammenschreibung und Groß- oder Kleinschreibung differenziert. Abkürzungen mit gleichen Merkmalen fasst Hofrichter zu sogenannten Kombinationsklassen zusammen, die er mit unterschiedlichen Kennzeichnungen für die verschiedenen Klassifikationsebenen versieht. Dies liefert ihm Kennzeichnungen wie 1.1 A I a für ein Buchstabierwort wie Lkw < Lastkraftwagen (64). Diese Art der Klassifikation ist zwar sehr präzise, aufgrund der sehr sperrigen Kennzeichnungen aber für die konkrete Kurzwortdiskussion kaum nutzbar.
Ein Jahr nach Hofrichters Arbeit erschien die Dissertation von Werner Vieregge mit dem Titel „Aspekte des Gebrauchs und der Einordnung von Kurz- und Kunstwörtern in der deutschen Sprache – eine Analyse mit Hilfe einer EDV-Anlage“ (Vieregge 1978). Darin sieht Vieregge Abkürzungen als Oberbegriff für reine Schriftkürzungen, Maßeinheiten, Kurzwörter sowie Kunstwörter. Er differenziert zwar zwischen Kurzwörtern und Kunstwörtern, behandelt in seiner Arbeit jedoch im Gegensatz zu der vorliegenden Arbeit auch Letztere, fasst den Untersuchungsgegenstand also ebenfalls weiter. Es werden die „Kurzwortgruppen“ der Abbreviationen, Kunstwörtern und fremdsprachlichen Kürzungen unterschieden (42). Bei Vieregges Abbreviationen, die im Wesentlichen den Kurzwörtern im Sinne der vorliegenden Arbeit entsprechen, wird schließlich weiter nach Kurzwörtern aus Initialen, Kurzwörtern aus größeren Bestandteilen, Klappwörtern aus einer Initiale und einem Lexem wie U-Boot < Unterseeboot, Kopfwörtern und Endwörtern differenziert. Auch Vieregge betrachtet Kurzwörter unter einer Reihe von Aspekten wie Klassifikation, Flexion und Beziehung zur Vollform. Er beschäftigt sich mit dem bereits bei Hofrichter (1977:19f.) erwähnten Phänomen, dass die Beziehung zwischen Kurzwort und Vollform nicht statisch ist und sich ein Kurzwort zunehmend verselbständigen und eventuell sogar seine Vollform verdrängen kann (z.B. Vieregge 1978:66ff.). Die Grundlinie seiner Arbeit ist eine Argumentation für den Wortstatus von Kurzwörtern, wie auch etwas später in Vieregge (1983).
Zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die Arbeiten von Hofrichter und Vieregge erschienen zwei Artikel von Günter Bellmann (Bellmann 1977 und Bellmann 1980), die eine neue Kurzwortklassifikation mit einer Unterteilung in unisegmentale und multisegmentale Kurzwörter mit jeweils mehreren Untertypen vorstellen, die bis heute von vielen Autoren übernommen wurde.
Auch die Arbeiten von Albrecht Greule lassen Bellmanns Einfluss erkennen. Nachdem er sich in Greule (1983/84) und Greule (1986) zunächst nur mit i-Bildungen auseinandergesetzt hatte, weitete er sein Interesse anschließend auf das gesamte Kurzwort-Phänomen aus und behandelte in einer Reihe von Aufsätzen (Greule 1992, 1996 und 2007) Kurzwortbildung als Teil der Wortbildung. Er entwickelte eine neue Typologie, in der Kurzwörter zunächst danach unterschieden werden, welcher Art die aus der Vollform übernommenen Segmente sind. Dabei differenziert Greule zwischen Buchstaben-Kurzwörtern, Silben-Kurzwörtern, Mischtypen und Morphem-Kurzwörtern (Greule 1992:60f. und Greule 1996:197f.). Erst an nachgeordneter Stelle folgt dann eine von Bellmann inspirierte Unterscheidung zwischen unisegmentalen und multisegmentalen Kurzwörtern.
Eine umfassende und richtungsweisende Dissertation zur Kurzwortbildung im Deutschen erschien 1994 mit Dorothea Kobler-Trills Arbeit „Das Kurzwort im Deutschen. Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung“. Neben einer ausführlichen Diskussion der bisher erfolgten Kurzwortforschung und einer ebenfalls detaillierten Abgrenzung von verwandten Phänomen liegt der Schwerpunkt von Kobler-Trills Arbeit auf der Erstellung einer neuen Kurzworttypologie. In ihrer grundsätzlichen Einteilung folgt Kobler-Trill Bellmann, indem sie Kurzwörter zunächst nach der Anzahl ihrer Segmente klassifiziert, also unisegmentale von nicht-unisegmentalen Kurzwörtern unterscheidet. Letztere teilt sie wiederum in multisegmentale und partielle Kurzwörter auf. Anschließend wird nach der Qualität dieser Segmente (Buchstaben, Silben etc.) und ihrer Position in der Vollform differenziert (Kobler-Trill 1994:87). Ein Großteil der Klassifizierungskriterien sind demnach in den Arbeiten von Kobler-Trill und Greule identisch und unterscheiden sich lediglich in der Priorisierung, was dennoch zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Einteilung von Kurzwörtern führt. Neben der Vorstellung ihres typologischen Ansatzes enthält Kobler-Trills Arbeit außerdem auch einen empirischen Teil, der sich jedoch auf die nicht-unisegmentalen Kurzworttypen beschränkt. Die Dissertation von Kobler-Trill wurde stark rezipiert und dürfte vermutlich eine der am häufigsten zitierten Arbeiten zum Thema Kurzwortbildung im Deutschen darstellen. Auch in zwei späteren Artikeln beschäftigte sich Kobler-Trill weiter mit der Thematik der Kurzwörter (Kobler-Trill 1997 und 2002).
Zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie Kobler-Trills Dissertation entstand die Habilitationsschrift von Elke Ronneberger-Sibold mit dem Titel „Die Lautgestalt neuer Wurzeln. Kürzungen und Kunstwörter im Deutschen und Französischen“ (Ronneberger-Sibold 1992). Diese Arbeit ist eine kontrastive Untersuchung von Kurzwörtern und Kunstwörtern im Deutschen und Französischen mit umfangreichen auf der Grundlage von Wörterbüchern erstellten Korpora, deren Belege vor allem im Hinblick auf phonologische Kriterien wie Silbenzahl und -struktur ausgewertet werden. Ronneberger-Sibolds Hauptthese ist, dass die Bildung von Kurzwörtern und Kunstwörtern Sprachbenutzern die Möglichkeit bietet, losgelöst von den Regularitäten des Normalwortschatzes und des regulären Sprachwandels einen alternativen Wortschatz mit neuen Wörtern zu schaffen, die sich strukturell vom Normalwortschatz unterscheiden und phonologisch für Artikulation und Perzeption optimiert sind. In ihrer Klassifikation der Kurzwörter folgt Ronneberger-Sibold interessanterweise weder Bellmann noch Greule, sondern erarbeitet eine eigene Typologie, bei der zwischen Kurzwörtern im engeren Sinne, Akronymen und Sonderfällen unterschieden wird.1 Bei der Habilitationsschrift von Ronneberger-Sibold handelt es sich meines Wissens um die erste längere kontrastive Arbeit zur Kurzwortbildung, der auch die vorliegende Arbeit hilfreiche Anregungen verdankt. Im Gegensatz zu Ronneberger-Sibolds Arbeit stützen sich die Korpora dieser Arbeit jedoch nicht nur auf Wörterbuchdaten, sondern auch auf Zeitungsdaten, wodurch auch Aussagen zu Gebrauchsfrequenzen möglich sind.
Auf Ronneberger-Sibolds Habilitationsschrift folgten in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von kürzeren Arbeiten zum Thema Kurzwortbildung (z.B. Ronneberger-Sibold 1995a, 1995b, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 und 2007). Auch in diesen Arbeiten liegt der Schwerpunkt meist auf der phonologischen Struktur der Kurzwörter; in einigen Fällen wird Kurzwortbildung auch im Zusammenhang mit Sprachwandel erörtert.
Aus dem Jahr 2000 stammt Anja Steinhauers Dissertation „Sprachökonomie durch Kurzwörter. Bildung und Verwendung in der Fachkommunikation“ (Steinhauer 2000), die mit der Betrachtung von Kurzwörtern in Fachsprachen einen neuartigen Schwerpunkt setzt. Auch Steinhauer beschäftigt sich eingehend mit der Klassifikation von Kurzwörtern. So findet sich bei ihr eine ausführliche Diskussion von Kobler-Trills Ansatz, den sie letztlich aufgrund einiger Unstimmigkeiten verwirft (vgl. Steinhauer 2000:34–42). Für ihre eigene Arbeit greift Steinhauer schließlich auf die Arbeiten von Albrecht Greule zurück und erstellt eine modifizierte Klassifikation in Anlehnung an ihn, auf die wiederum Greule (2007:120) zurückgreift. Später folgten von Steinhauer noch zwei allgemeinere Artikel zur deutschen Kurzwortbildung (Steinhauer 2001 und 2007). Des Weiteren ist Anja Steinhauer seit der 5. Auflage die Herausgeberin des Duden-Wörterbuchs der Abkürzungen (Steinhauer 2005). Darin werden im einleitenden Kapitel Kurzwörter einerseits von Abkürzungen und andererseits von Kunstwörtern abgegrenzt. Im Register sind Abkürzungen, Kurzwörter und Kunstwörter dann jedoch ohne weitere Kennzeichnung gemeinsam aufgeführt.
Einige Arbeiten widmen sich speziell den i-Bildungen, so Werner (1996), Féry (1997) und Köpcke (2002). Diese Autoren diskutieren Belege, die nach der Typologie der vorliegenden Arbeit zu den Pseudoableitungen, Kopfwörtern und Silbeninitialwörtern gehören, sowie Belege, die außerhalb des Rahmens der Kurzwortbildung in meinem Sinne stehen. In den erwähnten Arbeiten wird deutlich, dass die Outputorientierung bei i-Bildungen eine große Rolle spielt, d.h. durch verschiedene Prozesse werden i-Bildungen mit einer bestimmten Struktur erzeugt, nämlich einem zweisilbigen Trochäus auf -i.
In mehreren Artikeln widmet sich Sascha Michel der Kurzwortbildung im Deutschen (Michel 2006, 2011 und 2014), zum Teil auch mit einem Schwerpunkt auf Fachsprachen (Girnth/Michel 2008 und Michel 2009). Dabei plädiert er für eine stärkere Berücksichtigung der parole bei der Erstellung von Definitionen und Typologien und bemängelt eine zu starke Fixierung der existierenden Kurzwortforschung auf die Ebene der langue, die den tatsächlichen Sprachgebrauch nicht berücksichtigt (z.B. Michel 2006:71f.).2
Nach Ronneberger-Sibolds oben angeführter Habilitationsschrift zu Kurzwörtern im Deutschen und Französischen von 1992 sind nur noch wenige weitere kontrastive Arbeiten zur Kurzwortbildung erschienen. Dabei handelt es sich mit Nübling (2001) um einen deutsch-schwedischen Vergleich und mit Leuschner (2008) um einen Vergleich deutscher und niederländischer Kurzwörter. Des Weiteren existieren Abschlussarbeiten, die ebenfalls deutsche Kurzwörter sprachvergleichend behandeln: Wahl (2002) mit einem Vergleich mit dem Schwedischen und Lemey (2002) mit einem Vergleich mit dem Niederländischen. Aufgrund ihres Status als Abschlussarbeiten beinhalten diese Arbeiten jedoch keine ausführlichen und systematischen Belegsammlungen. Detaillierte Vergleiche deutscher Kurzwörter mit den Kürzungen anderer Sprachen sind demnach also bislang sehr selten. Diese Lücke schließt die vorliegende Arbeit mit der Analyse deutscher und schwedischer Kurzwörter auf empirischer Grundlage.
Bei der neuesten Dissertation zu deutschen Kurzwörtern handelt es sich um Vincent Balnats „Kurzwortbildung im Gegenwartsdeutschen“ (Balnat 2011). Auf einen ausführlichen Forschungsbericht folgt eine kritische Diskussion von Kobler-Trills Kurzwortbegriff und -definition, wobei Balnat selbst einen recht weiten Kurzwortbegriff vertritt: „Als KW werden nicht nur traditionelle Bildungstypen […] betrachtet, sondern auch graphische Abkürzungen, Klappwörter, Wortkreuzungen und einige Kunstwörter.“ (Balnat 2011:288) Wie schon Michel (2006) plädiert auch Balnat für eine prototypische Definition von Kurzwörtern. Demnach haben prototypische Kurzwörter gewisse Eigenschaften, während nicht-prototypische Kurzwörter nicht alle dieser Kriterien erfüllen (vgl. Balnat 2011:145). Für sein Kurzwortkorpus berücksichtigt Balnat wiederum nur prototypische Kurzwörter. Es ist jedoch festzustellen, dass Balnats Datenauswahl für sein Kurzwortkorpus keine systematische Grundlage zu haben scheint (9). Seine Belege sind eher zur Illustration geeignet und erlauben aufgrund der willkürlichen Datenzusammenstellung aus diversen Quellen keine quantitativen Aussagen zur Frequenz verschiedener Kurzworttypen. Generell fasst Balnat das Untersuchungsfeld seiner Dissertation recht weit. So berücksichtigt er nicht nur entlehnte Kurzwörter, die keine deutsche Vollform haben, sondern auch chatspezifische Kürzungen wie hdl < hab dich lieb, GN8 < Gute Nacht, g < grins und als nichtsprachliche Kurzformen sogar Smileys wie :-). Der Großteil dieser chatspezifischen Kürzungen sind für Balnat allerdings nur Kurzformen und keine Kurzwörter. Diesen Charakteristika der Chatkommunikation widmet er ein ganzes Kapitel seiner Arbeit und hat eigens ein Korpus dazu erstellt, sodass sich letztlich ein nicht geringer Teil der Arbeit nicht mit Kurzwörtern im eigentlichen Sinn, sondern mit einem benachbarten Phänomen beschäftigt. Eine derartige Beschäftigung mit nicht-prototypischen Kurzwörtern und verwandten Phänomenen ist sicher sinnvoll, da gerade die neuen Medien Kommunikationsformen hervorbringen, die ein spannendes und lohnenswertes Untersuchungsfeld darstellen. Nichtsdestotrotz ist ein solches Vorgehen nicht für einen Vergleich mit einer Sprache wie dem Schwedischem geeignet, zu der noch kaum Kurzwortforschung vorhanden ist. Da für das Schwedische zunächst Grundlagen der Kurzwortforschung etabliert werden müssen, sollte sich auch die den Vergleich liefernde deutsche Seite vor allem auf grundsätzliche Fragen und prototypische Kurzwörter konzentrieren.
Trotz der vielen einschlägigen Veröffentlichungen3 zur Kurzwortbildung im Deutschen hat sich bislang keine einheitliche Terminologie herausgebildet, da die einzelnen Autoren das Phänomen der Kurzwortbildung unterschiedlich abgrenzen. So zählen manche Autoren auch Kunstwörter (z.B. Ronneberger-Sibold 1992) und/oder Lehnkurzwörter zur Kurzwortbildung (z.B. Balnat 2011). Während auf ein Morphem gekürzte Kurzwörter wie Ober < Oberkellner für manche Autoren einen eigenen Kurzworttyp darstellen (z.B. für Greule 1992) oder unabhängig davon, dass der gekürzte Teil ein Morphem ist, unter andere Kurzworttypen subsumiert werden (z.B. von Schippan 1963), sind sie für andere Autoren überhaupt kein Bestandteil der Kurzwortbildung (z.B. für Ronneberger-Sibold 1992). Diese Beispiele machen deutlich, dass die Auffassungen einzelner Autoren darüber, was genau Gegenstand der Kurzwortbildung ist, teils erheblich voneinander abweichen. Auch bei der Klassifikation der Kurzworttypen finden sich zum Teil beträchtliche Unterschiede zwischen den Arbeiten verschiedener Verfasser. Obwohl in vielen Arbeiten durchaus Themen wie das Flexionsverhalten oder die Wortbildungsmöglichkeiten von Kurzwörtern angesprochen werden, stehen im Zentrum der Diskussion der deutschsprachigen Kurzwortforschung meist typologische Fragen. Eine empirisch basierte Arbeit, die sowohl phonologische als auch auch grammatische Aspekte näher beleuchtet, war bislang ein Desiderat, das die vorliegende Arbeit erfüllen soll.